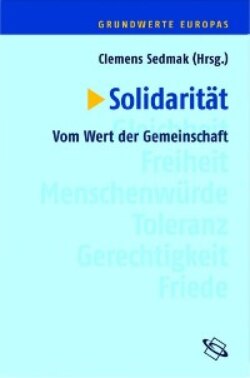Читать книгу Solidarität - Группа авторов - Страница 21
7. Ambivalente Solidarität
ОглавлениеNoch vor zwei Jahrzehnten haben wir uns mit der Unterscheidung leichter getan: das Alte gegen das Neue, das Traditionelle gegen das Moderne. Wir hätten damals auch vermutet, dass es unaktuell sei, sich mit obskuren Phänomenen wie dem Nationalismus zu befassen. Mittlerweile hat uns die Geschichte belehrt, dass es voreilig ist, traditionelle Residuen einfach abzutun. Immer noch allerdings besteht eine Tendenz dazu, politische Gebilde als rationale Konstruktionen zu betrachten und starke Wir-Gefühle als Atavismen abzutun. Aber ein beträchtlicher Teil der politischen Konflikte der Gegenwart resultiert daraus, dass die Reichweite von Solidaritätsgefühlen eine andere ist als die Reichweite politischer Machtausübung. Mit anderen Worten: Die Modernisierungstheorie hat seinerzeit schon darauf hingewiesen, dass ein erfolgreicher Konsolidierungsprozess für eine moderne politische Einheit nur möglich ist, wenn „Nationsbildung“ erfolgt: die Auflösung von Solidaritäten gegenüber Clans und Stämmen, die Bildung von nationaler Solidarität im Rahmen des Gemeinwesens. Afrikanische Bürgerkriege, südostasiatische Guerillakämpfe oder die Auseinandersetzungen im südlichen Gürtel der früheren Sowjetunion sind die negativen Beispiele, weil in ihnen die „nationalstaatliche Solidarisierung“ nicht gelungen ist. „Nationale Solidarität“ muss nicht nur Superioritäts- und Expansionsgelüste auslösen, sondern kann auch als Voraussetzung einer demokratisch-modernen Entwicklung verstanden werden, weil andere Zugehörigkeiten dahinter zurücktreten. Diese nationale Solidarität gerät dann unter besonderem Stress, wenn, wie dies in den Zeiten einer neuen Völkerwanderung der Fall ist, nicht nur die nationalstaatlichen Container friedlich nebeneinander bestehen sollen, sondern die ganze Welt innerhalb des eigenen Lebenskreises vertreten ist. Die steigende soziale Heterogenisierung senkt die Wahrscheinlichkeit von Solidarität, die doch auf Gemeinschafts- und Verständigungserfahrungen beruht; zumal jede ethnische, sprachliche, religiöse oder kulturelle Differenz im Zuge von Skandalisierungs- und Verfeindungsstrategien politischer „Entrepreneur“ zu einem Stolperstein für das Zusammenleben gemacht werden kann.
Gerade weil sich die Postmoderne weder „Religion“ noch“ Gemeinschaft“ als praktikable gesellschaftliche Kraft vorstellen kann, ist sie manchen Phänomenen gegenüber hilflos: Welche Art von „Solidaritätsgefühlen“ brauchen Selbstmordattentäter, um ihre Entscheidung – das Opfer des Lebens – fällen zu können? Schließlich wäre es peinlich, wenn aus der Sicht der reichen Länder jede Art von Solidarität nur noch mit fundamentalistischer Irrationalität verbunden würde, nur deswegen, weil es für moderne Menschen als selbstverständlich angesehen würde, im Wesentlichen den eigenen Interessen zuzuarbeiten und die „Caritas“ allein der Caritas zu überlassen. Religionen entfalten offenbar stärkere Bindungskraft als viele andere Kulturelemente, nicht so sehr im säkularisierten Europa (wo die Religion, wenn überhaupt, als eine Variante individualisierter Lebensgestaltung überlebt),36 aber überall sonst auf der Welt. Noch vor zwei Jahrzehnten hätten die Sozialwissenschaftler die integrations- und solidaritätsstiftende Kraft der Religionen gering veranschlagt, weil sie auch diese geistigen Gebilde als Überbleibsel angesehen haben, die im Zuge der Modernisierung vertrocknen. Mittlerweile findet die Religion wieder als eine wesentliche gruppenkonstituierende Kraft Beachtung, und manche behaupten, dass sich die globale Landkarte nach diesen Gruppenbildungen (und den „clashes“ zwischen ihnen) zeichnen lässt.37
Offensichtlich ist es auch das Problem der Europäischen Union, dass sie eine Vergesellschaftungs-Initiative mit allzu wenig Vergemeinschaftungs-Elementen ist: eine rationale Angelegenheit zur Vermeidung eines Krieges und zur Schaffung eines Marktes. Natürlich könnte Solidarität den nationalen Rahmen überschreiten. „Zu den nützlichen Marktbeziehungen soll dann eine stärkere Bindekraft treten: Solidarität, die auf Identifikation beruht. Wird diese stark genug sein, um Polen, Portugiesen und andere Mitglieder der Europäischen Union genauso so unterstützen wie heute die ostdeutschen Länder, die sich ja noch nicht genug unterstützt sehen?“38 Das Gefühl, dass die europäischen Länder eine solidarische Gemeinschaft darstellen, hat sich in den Köpfen der Europäer und Europäerinnen allerdings noch nicht durchgesetzt. Auch die tatsächlich stattfindenden Redistributionen sind nicht so sehr Ausdruck gesamteuropäischer Solidarität, sondern finden außerhalb der Aufmerksamkeit, jedenfalls aber ohne sachgerechte Einschätzung der europäischen Bürger und Bürgerinnen statt. All das Gerede, das sich um die „europäische Identität“ und um die „europäischen Werte“ dreht, strebt zur Vergemeinschaftung, will das Zusammenleben an eine Substanz knüpfen, die außer Streit oder jedenfalls nicht zur Disposition steht. Deswegen ist das Gerede um das Wesen Europas nicht nur Podiumsdiskussionsgeschwätz; es handelt sich um den Versuch, eine „imagined community“39 zu erschaffen, die Integration gewährleistet und Solidarität vermittelt.
Es ist ein gemischtes Bild, das sich letzten Endes bietet. Heiner Keupp hat schon Recht, wenn er kritisiert, dass viele Erörterungen der Frage nach Individualität und Solidarität an empirisch haltlosen Polaritäten kranken: Auflösung traditioneller Gemeinschaftlichkeit = Isolation; Individualisierung = Abbau von Solidaritätspotentialen = Egoismus.40 In Wahrheit verweisen Optionen und Ligaturen,41 individuelle Gestaltung und solidarische Bezogenheit aufeinander. Die modernen Individuen sind nicht gänzlich vereinzelt, sondern leben in Netzwerken und Subkulturen. Die Zerstörung lokaler Subkulturen bringt zwar einen Verlust von Gemeinschaft und Solidarität mit sich, es entwickeln sich aber auch neue Typen von solidarischem Handeln, freiwillig und engagiert. Dass materielle Armut mit einem höheren zwischenmenschlichen Beziehungsreichtum aufgewogen wird, ist jedoch ein Märchen. Sozial schlechter gestellte Schichten tun sich mit den flexiblen Beziehungsverhältnissen, unter denen soziales Kapital bewusst aufgebaut werden muss, besonders schwer.42 Insofern sind es nicht die besonders individualisierten (gutgestellten) Schichten, in denen solidarisches Engagement besonders schrumpft, sondern jene, die unter stärkerem sozialen Druck stehen. Die Möglichkeiten für einen „kooperativen Individualismus“ oder eine „kommunitäre Individualität“ sind wohl gegeben, aber sie sind anspruchsvoll, und vorderhand scheinen die Aussichten auf eine Verbreitung solcher Modelle nicht allzu gut zu sein. Für den Mainstream gilt, dass dann, wenn die sozial-moralischen Milieus zerfallen, ein allgemeines Schrumpfen der Reichweite und Spannkraft solidarischen Handelns einsetzt; es kommt zu einem Rückzug auf den sozialen Nahbereich, während die Perspektive des Gemeinwohls dahinschwindet.43
1 Vgl. Munoz-Dardé, Véronique, Brüderlichkeit und Gerechtigkeit, in: Bayertz, Kurt (Hg.), Solidarität. Begriff und Problem. Frankfurt am Main 1998, 146–171.
2 Vgl. Hitzler, Ronald/Bucher, Thomas/Niederbacher, Arne, Leben in Szenen. Formen jugendlicher Vergemeinschaftung heute. Opladen 2001.
3 Vgl. Friedrichs, Jürgen/Jagodzinski, Wolfgang, Soziale Integration. Opladen 1999.
4 Vgl. Heitmeyer, Wilhelm (Hg.), Was hält die Gesellschaft zusammen? Frankfurt am Main 1997; Heitmeyer, Wilhelm (Hg.), Was treibt die Gesellschaft auseinander? Frankfurt am Main 1999.
5 Vgl. Eigelsreiter-Jashari, Gertrude, Frauenwelten – Frauensolidarität. Reflexionen über Nord-Süd-Begegnungsreisen. Frankfurt am Main 2004.
6 Vgl. Birnbacher, Dieter, Zukunftsverantwortung und Generationensolidarität. Würzburg 2001.
7 Vgl. Guggenberger, Bernd, Sein oder Design. Im Supermarkt der Lebenswelten. Reinbek bei Hamburg 2000.
8 Vgl. Metz, Karl H., Solidarität und Geschichte. Institutionen und sozialer Begriff der Solidarität in Westeuropa im 19. Jahrhundert, in: Bayertz, Kurt (Hg.), Solidarität. Begriff und Problem. Frankfurt am Main 1998, 171–194; Bayertz, Kurt, Begriff und Problem der Solidarität, in: Bayertz, Kurt (Hg.), Solidarität. Begriff und Problem. Frankfurt am Main 1998, 11–53; Hondrich, Karl Otto/Koch-Arzberger, Claudia, Solidarität in der modernen Gesellschaft. Frankfurt am Main 1992; Kaufmann, Franz-Xaver/Krüsselberg, Hans-Günter (Hg.), Markt, Staat und Solidarität bei Adam Smith. Frankfurt am Main u.a. 1984; Prisching, Manfred, Solidarität in der Moderne. Zu den Varianten eines gesellschaftlichen Koordinationsmechanismus, in: Journal für Sozialforschung 32 (1992) 267–281.
9 Vgl. Tönnies, Ferdinand, Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie. Neudr. [der] 8. Aufl. von 1935, 3., unveränd. Aufl. Darmstadt 1991.
10 Hondrich/Koch-Arzberger, Solidarität in der modernen Gesellschaft, 10.
11 Vgl. Vierkandt, Alfred, Solidarität, in: Bernsdorf, Wilhelm (Hg.), Wörterbuch der Soziologie. 2., neubearb. u. erw. Ausg. Stuttgart 1969, 944–946; Kaufmann, Franz-Xaver, Solidarität als Steuerungsform. Erklärungsansätze bei Adam Smith, in: Kaufmann, Franz-Xaver/Krüsselberg, Hans-Günter (Hg.), Markt, Staat und Solidarität bei Adam Smith. Frankfurt am Main u.a. 1984, 158–184; Cooley, Charles Horton, Social organization. A study of the larger mind. New York 1909.
12 Vgl. Hechter, Michael, Principles of group solidarity. Berkeley (Calif.) u.a. 1988.
13 Nullmeier, Frank, Entsolidarisierungsprozesse und der Triumph der Mikromoralen, in: Hettlage, Robert/Vogt, Ludgera (Hg.), Identitäten in der modernen Welt. Wiesbaden 2000, 327–346, hier: 332.
14 Vgl. Prisching, Manfred, Bilder des Wohlfahrtsstaates. Marburg 1996.
15 Vgl. Etzioni, Amitai, The spirit of community. Rights, responsibilities, and the communitarian agenda. New York (N.Y.) 1993.
16 Vgl. Prisching, Manfred, Die umwölkte Stadt auf dem Hügel. Wirtschaftslage, Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsskultur in den Vereinigten Staaten, in: Wirtschaft und Gesellschaft 24,1 (1998) 73–97; Prisching, Manfred, Schlechte Träume. Der „American Dream“ unter Globalisierungsdruck, in: Althaler, Karl S. (Hg.), Primat der Ökonomie? Über Handlungsspielräume sozialer Politik im Zeichen der Globalisierung. Marburg 1999, 283–310.
17 Vgl. Junge, Matthias, Individualisierung. Frankfurt am Main u.a. 2002.
18 Vgl. Abels, Heinz, Identität. Über die Entstehung des Gedankens, dass der Mensch ein Individuum ist, den nicht leicht zu verwirklichenden Anspruch auf Individualität und die Tatsache, dass Identität in Zeiten der Individualisierung von der Hand in den Mund lebt. Wiesbaden 2006.
19 Vgl. Gross, Peter, Die Multioptionsgesellschaft. Frankfurt am Main 1994.
20 Vgl. Hitzler, Ronald/Honer, Anne, Bastelexistenz, in: Beck, Ulrich/Beck-Gernsheim, Elisabeth (Hg.), Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften. Frankfurt am Main 1994, 307–315.
21 Vgl. Durkheim, Emile, Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer Gesellschaften. Frankfurt am Main 1992.
22 Vgl. Müller, Hans-Peter/Schmid, Michael, Arbeitsteilung, Solidarität und Moral. Eine werkgeschichtliche und systematische Einführung in die „Arbeitsteilung“ von Emile Durkheim, in: Durkheim, Émile, Über soziale Arbeitsteilung. Frankfurt 1988, 481–521.
23 Hondrich, Karl Otto, Der neue Mensch. Frankfurt am Main 2001, 56.
24 Neckel, Sighard, Status und Scham. Zur symbolischen Reproduktion sozialer Ungleichheit. Frankfurt am Main 1991, 174.
25 Nullmeier, Entsolidarisierungsprozesse und der Triumph der Mikromoralen, 340.
26 Vgl. Riesman, David, Die einsame Masse. Eine Untersuchung der Wandlungen des amerikanischen Charakters. Darmstadt 1956.
27 Vgl. Bauman, Zygmunt, Liquid modernity. Cambridge 2000.
28 Vgl. Sennett, Richard, Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin 71998.
29 Hondrich/Koch-Arzberger, Solidarität in der modernen Gesellschaft, 24.
30 Meyer, Thomas, Solidarität und kulturelle Differenz. Erinnerung an eine vertraute Erfahrung, in: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.), Was hält die Gesellschaft zusammen? Frankfurt am Main 1997, 313–232, hier: 322.
31 Vgl. Granovetter, Mark S., Getting a job. A study of contacts and careers. Cambridge (Mass.) 1974.
32 Vgl. Hitzler/Bucher/Niederbacher, Leben in Szenen.
33 Vgl. ebd.; Hitzler, Ronald, Individualisierte Wissensvorräte. Existenzbastler zwischen posttraditionaler Vergemeinschaftung und postmoderner Sozialpositionierung, in: Tänzler, Dirk/Knoblauch, Hubert/Soeffner, Hans-Georg (Hg.), Zur Kritik der Wissensgesellschaft. Konstanz 2006, 257–276.
34 Bauman, Zygmunt, Leben in der flüchtigen Moderne. Frankfurt am Main 2007, 121f.
35 Vgl. Gebhardt, Winfried (Hg.), Events. Soziologie des Außergewöhnlichen (Erlebniswelten, 2). Opladen 2000.
36 Vgl. Knoblauch, Hubert, „Jeder sich selbst sein Gott in der Welt“. Subjektivierung, Spiritualität und der Markt der Religion, in: Hettlage, Robert/Vogt, Ludgera (Hg.), Identitäten in der modernen Welt. Wiesbaden 2000, 201–216.
37 Vgl. Huntington, Samuel P./Harrison, Lawrence E. (Hg.), Streit um Werte. München 2004.
38 Hondrich, Der neue Mensch, 28.
39 Vgl. Anderson, Benedict R., Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism. London u.a. 21991.
40 Vgl. Keupp, Heiner, Die Suche nach Gemeinschaft zwischen Stammesdenken und kommunitärer Individualität, in: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.), Was hält die Gesellschaft zusammen? Frankfurt am Main 1997, 279–312.
41 Vgl. Dahrendorf, Ralf, Lebenschancen. Anläufe zur sozialen und politischen Theorie. Frankfurt am Main 1979.
42 Vgl. Keupp, Die Suche nach Gemeinschaft zwischen Stammesdenken und kommunitärer Individualität.
43 Vgl. Meyer, Solidarität und kulturelle Differenz.