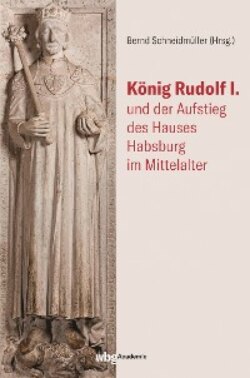Читать книгу König Rudolf I. und der Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter - Группа авторов - Страница 11
Ehre und Wiederherstellung des Reiches: Neue Instrumente der Königspolitik unter Rudolf von Habsburg
ОглавлениеDie Ehre des Reiches
„Deshalb bestätigen wir vor den Anwesenden und halten hier mit unverhülltem Angesicht fest, dass er für die Ehre der königlichen Majestät, damit er in vollem Umfang die Ernsthaftigkeit seiner Zuneigung zeige, die er jenem König gegenüber in bekannter Weise hegt, dieses Mal eine bemerkenswerte Nichtberücksichtigung übergangen hat, nichtsdestoweniger öffentlich bekundend, dass dem Besitz dieses Rechts oder der Tatsache des Sitzplatzes, den er hat, durch die Tatsache dieses Verzichts in Zukunft kein Abbruch dürfe, noch dürfe für ihn oder seine Mainzer Kirche daraus in irgendeiner Weise ein Nachteil entstehen.“1
Mit dieser etwas gedrechselten Feststellung trat der Pfalzgraf bei Rhein am Tag der Krönung Rudolfs von Habsburg für die Rechte des Erzbischofs von Mainz ein. Die unerschrockene Rechtswahrung galt dem Mainzer Anspruch auf einen Sitzplatz zur Rechten des Königs beim Krönungsmahl. Der Streit der Erzbischöfe um den Sitzplatz an der Tafel führte nach dem Bericht der Sächsischen Weltchronik zu einer Verschiebung des Krönungsmahls.2 Der Zwischenfall lässt ahnen, worauf Rudolf von Habsburg sich eingelassen hatte. Wenn der Erzbischof von Mainz, der die Königswahl umsichtig vorbereitet hatte, wegen eines Streites um den Sitzplatz bereit war, das Krönungsessen ausfallen zu lassen, und damit als bedeutendster Kirchenmann des Reiches immerhin ein zentrales christliches Ritual verweigerte, dann zeigte das, auf welch dornigen Weg der Graf von Habsburg sich begab. Sein Personal war der Aufgabe zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz gewachsen. Offenbar hatte er keinen umsichtigen Truchsess im Gefolge, der solche Rangeleien im Vorfeld diskret erledigte. Und das obwohl die Spezialisten für die Fragen des herrschaftlichen Rituals darauf verweisen, dass solche sensiblen Fragen durch vorherige Absprachen geklärt wurden.3 Damit sind wir bei Rudolfs tatsächlichem Problem – oder bei der Herausforderung, vor der er nun stand. Rudolf und die Habsburger – dies war eine Aufstiegsgeschichte. Das war das erste Instrument seiner beginnenden Herrschaft im Reich: Rudolf musste sich behaupten. Aber ein Wort braucht es noch zu dem neuen Umfeld, in dem Rudolf künftig seine Abendessen würde einnehmen müssen. Zumindest von Zeit zu Zeit.4
Der Streit um den Sitzplatz, der den König und den Pfalzgrafen bei Rhein nötigte, gleich zwei Urkunden auszustellen, die festhielten, dass die getroffene Sitzplatzentscheidung kein Präzedenzfall sei, zeigte, dass es im Kreis der Reichsfürsten keine Routine für solche Vorgänge gab. Tatsächlich hatten die wichtigsten Fürsten des Reiches seit Jahrzehnten keine Gelegenheit gehabt, in abgestimmter Ordnung gemeinsam am Tisch ihres Königs zu sitzen. Das letzte große Ereignis dieses Formats lag fast 40 Jahre zurück: der Hoftag Friedrichs II. in Mainz 1235, der Kaiser den Reichslandfrieden verkündete.5 Seitdem hatten sich die Fürsten untereinander oder miteinander gegen den König, oder gegeneinander mit unterschiedlichen Königen bekämpft oder in verschiedenen Zusammensetzungen Bündnisse geschlossen.6 Diese Streiterfahrungen hatten die Fürsten ernüchtert. So rangen sie sich nach dem Tod Richards von Cornwall – des Engländers, der 1256 im Streit zum deutschen König gewählt worden war – dazu durch, eine einmütige Königswahl abzuhalten.7 Der Konsens der Fürsten stand vor dem Kandidaten. Rudolf von Habsburg kam dann aus der Tiefe des süddeutschen Raumes, wobei er wichtige Eigenschaften für einen möglichen Erfolg mit sich brachte. Er war zäh, und er war ein erfahrener Krieger. Er hatte die bewegten Verhältnisse des Interregnums für den Ausbau seines Hauses entschlossen und durchaus rücksichtslos genutzt. Und er verkörperte in vertretbarer Weise die staufische Tradition, ohne dadurch bei der Kurie Anstoß zu erregen. Seine Loyalität zu Konradin lag lange zurück und er konnte als ein treuer Sohn der Kirche gelten.8 Karl-Friedrich Krieger hat in diesem staufischen Image Rudolfs ein entscheidendes Moment für Rudolfs Nominierung gesehen.9 Das galt in zweifacher Weise. Einmal konnte dieses staufische Image Rudolf bei den Ministerialen und den Reichsstädten helfen und es bedeutete gleichzeitig, dass Rudolf kein junger Mann mehr war. Die Stauferzeit lag länger zurück. Rudolf war zum Zeitpunkt seiner Wahl mit 55 Jahren in einem Alter, in dem römisch-deutsche Könige in der Regel aus ihrem Amt schieden. Nur wenige Könige wurden älter. Sein Alter wird die Wahlentscheidung der Fürsten durchaus erleichtert haben. Die Wähler mussten nicht davon ausgehen, dass sie eine Entscheidung für Jahrzehnte trafen. Es kam anders, und damit kommen wir nun zu der ersten der drei Herrschaftstechniken, die Rudolf für seine Königsgeschichte nutzbar machte:
Abb. 1: Speyer 1291: Bestätigung des Mainzer Reichslandfriedens Kaiser Friedrich II. von 1235 durch König Rudolf (Stadtarchiv Speyer, 1 U Nr. 17)
Selbstbehauptung und Behauptung des Königtums
Um sich in seiner neuen Rolle höchst königlich zu bewähren, musste Rudolf zunächst einmal am Leben bleiben. Das ist nicht ganz so banal oder anthropologisch gemeint, wie es klingt. Auf dem Thron war Rudolf ein Aufsteiger. Und das Schicksal der Aufsteiger auf dem deutschen Königsthron deutet an, dass das Amt Risiken barg, wenn man nicht an einem Königshof geboren war. Und selbst dann war das Königtum im beginnenden Spätmittelalter eine gefahrvolle Aufgabe. Man denke an die Staufer Philipp von Schwaben (1198–1208), den Sohn eines Kaisers, der ermordet wurde, und Heinrich (VII.) (1220–1235), der wohl den Selbstmord wählte (1242), um dem väterlichen Kerker zu entkommen.10 Wilhelm von Holland (1248–1256) und Adolf von Nassau (1292–1298) gelangten als Grafen auf den deutschen Königsthron und starben eines gewaltsamen Todes.11 Albrecht I. (1298–1308), der Sohn Rudolfs, den die Kurfürsten zunächst übergangen hatten, um ihm dann doch den Weg auf den Thron zu ebnen, wurde ermordet.12 Heinrich VII. (1308–1313), der als Graf von Luxemburg auf den Thron gelangte, starb nicht durch Gewalt, aber er starb jung auf einem Italienzug, den er angetreten hatte, um seine schwache Königsposition aufzuwerten. Seine Frau Margarete war auf demselben Zug noch vor ihm gestorben.13
Alle diese Todesfälle hatten durchaus ihre individuellen Züge. Aber bei dem Blick auf diese Schicksale zeigt sich doch, dass der Griff nach der Krone Gefahren barg, wenn die Nachfolge nicht eindeutig war. Die neuen Könige mussten ihren Thron mit dem Abklingen der staufischen Dominanz und nach dem Ende der Dynastie in einem schwierigen Umfeld behaupten. Wir dürfen annehmen, dass Rudolf als ein gradliniger und frommer, aber eher handfester Graf sich in dem angedeuteten Milieu schwer tat.14 In einem Milieu, in dem auch die ranghöchsten Männer der Kirchen Sitzordnungen für wichtiger hielten als die direkten Vorgaben des Evangeliums. Als Sohn eines Grafen galt er dort nicht als ebenbürtig. Zwar waren auch die streitenden Erzbischöfe von Köln und von Mainz Söhne von Grafen, aber sie vertraten die höchsten geistlichen Fürstentümer des Reiches.15 Und in dieser Rolle legten sie besonderen Wert auf ihren Rang. Das Gerangel um die Sitzplätze war Ausdruck dieser spannungsreichen Situation.16 Neuzugänge wurden kritisch in Augenschein genommen. Und Rudolf als neuer König wurde besonders kritisch gesehen. Denn er hatte den geistlichen Fürsten gegenüber einen grundsätzlichen Vorteil: er konnte seine ganze Familie in den Fürstenstand erheben, indem er seine Söhne oder einen Sohn mit einem Fürstentum belehnte. Diese Möglichkeiten hatten die Erzbischöfe nicht. Sie konnten Familienangehörige protegieren, aber das Prinzip der Wahl in die hohen kirchlichen Ämter setzte ihrem familiären Engagement gewisse Grenzen. Daher gingen die Möglichkeiten des königlichen Amtes aus dynastischer Perspektive deutlich über die Reichweite der geistlichen Fürsten hinaus. Im Grunde saß nun eine neue aufstrebende Familie mit an dem Tisch, um dessen Sitzordnung so entschieden gestritten wurde.17 Und Rudolf verfügte über einige Söhne, die er im Falle freiwerdender Lehen auf Fürstensitze berufen konnte, was ja schließlich auch geschah. Daher auch die frühen Vorbehalte. Die attraktiven Ländereien waren eine begrenzte Größe. In diesem konkurrierenden Milieu musste Rudolf bestehen. Wer in diesen Kreis reüssieren wollte, musste an Tischen und auch an Höfen zurechtkommen. Und er musste sich auf Kampfplätzen behaupten.
Im Rückblick scheint Vieles für Rudolfs Wahl zum König zu sprechen. Aber im Oktober 1273 sah es wahrscheinlich anders aus. Ein Sohn und ein Enkel Kaiser Friedrichs II. hatten sich nicht auf dem deutschen Thron behaupten können, zwei Konkurrenten aus dem gräflichen Milieu waren vorzeitig im Amt gestorben und zwei gewählte Könige aus namhaften europäischen Königsfamilien hatten nicht überzeugt. Sie hatten in Deutschland keine Spuren hinterlassen. Seit dem Tod Friedrichs II. hatte es sechs Versuche gegeben, die ambitionierte staufische Tradition fortzuführen. Die Kandidaten konnten auf das Geld der Kurie oder die Mittel ihrer königlichen Familien zurückgreifen. Es hatte nicht geholfen. Nun kam ein Mann, der nach den Standards des Königtums in Deutschland im fortgeschrittenen Alter stand. Sein Blut mochte bei der richtigen Beleuchtung bläulich schimmern. Seine Mittel waren bescheiden. Seine Aussichten erscheinen im Rückblick besser, als sie es damals waren. Rudolfs Griff nach der Krone war ein Wagnis.
Das Wagnis zahlte sich aus. Und Rudolfs Erfolg wurde zu einem bedeutenden Kapitel der europäischen Geschichte. Seine Selbstbehauptung wurde zur Selbstbehauptung eines neuen Königtums. Die Folgen seines Ausgreifens nach Österreich prägten die europäische Geschichte der Frühen Neuzeit tiefgehend.18 Das Königtum Rudolfs von Habsburg wurde zu einer Richtungsentscheidung. Es hatte ja Alternativen gegeben. Karl von Anjou hatte Philipp III. von Frankreich ins Spiel gebracht, dabei allerdings keine Rücksicht auf die deutschen Verhältnisse genommen.19 Dennoch muss man darauf verweisen, dass das englische und das französische Königshaus in dieser Phase eine Verbindung eingingen, deren Folgen Frankreich bis weit in das 15. Jahrhundert viele blutige Kriegszüge bescherte.20 Edward I. von England, der seinen Sohn gegen Ende seiner Herrschaft mit der Tochter Philipps von Frankreich verheiratete und so die Voraussetzungen für den Hundertjährigen Krieg schuf, hatte seine Herrschaft ein Jahr vor Rudolf begonnen.21 Die europäische Bühne bot Möglichkeiten.
Die deutschen Fürsten verzichteten 1273 auf einen weiteren Versuch mit einem europäischen Königshaus. Dabei zeigte ein goldener König, Ottokar von Böhmen, ein deutliches Interesse. Ottokar hätte dem Thron Glanz verliehen. Rudolf von Habsburg war für ihn nur ein „ungeeigneter Graf“. Als Wähler verweigerte Ottokar ihm seine Stimme, dann seine Huldigung und den Treueschwur. König Ottokar, Gebieter über einen strahlenden Hof in Prag, ignorierte die Entscheidung der Kurfürsten und die Mahnungen des Papstes.22 Er vermochte nicht zu akzeptieren, dass die Kurfürsten in Frankfurt ihre Stimmen einmütig auf einen wenig geeigneten Grafen vereint hatten.23 Der Papst könne es nicht hinnehmen, dass die Spitze des Reiches so einem Herabgestürzten und Niederen übertragen werde.24 Diese Einmütigkeit war auch nur zustande gekommen, weil man ihn übergangen hatte.
Hier zeigt sich die Dimension von Rudolfs Aufgabe. Er hatte wenig in der Hand, und er hatte auch keinen königlichen Apparat, der ihn unterstützte, um seine Aufgabe als oberster Richter des Reiches wahrzunehmen. Von manchen Gegnern schlug ihm einfach Verachtung entgegen. Entsprechend vorsichtig ging er seine neue Aufgabe an. Die Formel von der „Ehre und Wiederherstellung des Reiches“ tritt uns in sehr bescheidener Aufmachung knapp vier Monate nach seiner Wahl entgegen.25 In Hagenau erwirkte Rudolf einen Fürstenspruch, dass kein Fürst ein Lehen des Reiches, das er von ihm und dem Königreich innehabe, dem Reich entfremden dürfe, nisi nostro interveniente consensu. Ohne die Einwilligung des Königs durften die Fürsten keine Reichsgüter an sich ziehen. Ein Verdikt war das nicht. Eher eine vorsichtige Einschränkung. So musste niemand beunruhigt sein. Auch Ottokar war es nicht. Diese Unterschätzung seines Gegners war Ottokars größter Fehler.
Ottokar und Rudolf standen sich schließlich auf dem Schlachtfeld gegenüber. Denn Ottokar verlor seine Reichslehen am Ende durch seine konsequente Ablehnung von Rudolfs Amtsgewalt und die Verweigerung der Huldigung und Lehnsnahme. Ottokar akzeptierte Rudolfs Richterspruch in dieser Sache einfach nicht. Und so musste er nach Verhandlungen, Schlichtungen und neuem Zerwürfnis schließlich um seine Lehen kämpfen. Auf dem Schlachtfeld von Dürnkrut wurde im August 1278 die Frage entschieden, ob ein ungeeigneter Graf mit einem Königstitel über einen Goldenen König richten konnte.26 Es war ein Kampf in der Kategorie der Schlacht von Bouvines am Anfang des Jahrhunderts. Der Ausgang des Kampfes war ebenso eindeutig und seine historische Wirkung war es auch. Bei Dürnkrut verlor Ottokar Sieg und Leben. Es war eine blutige Schlacht. Rudolf behauptete sich als König, und er war nach diesem Sieg eine Größe, die Respekt einfordern konnte. Der Sieg eröffnete ihm die Möglichkeit, die frei gewordenen Lehen Österreich und Steiermark, Kärnten, Krain und Windische Mark schließlich feierlich an seine eigenen Söhne zu vergeben und damit seine Familie in den Reichsfürstenstand zu erheben.27 Dabei trat er mit fast staufischer Wortgewalt als Moderator Romani Imperii ab observantia legis solutus auf. Aber ein Moderator Imperii war doch kein Imperator, auch wenn es so klingen sollte. Es soll an dieser Stelle nicht erneut um die Revindikationspolitik Rudolfs gehen, die schon eine Reihe kompetenter Bearbeiter gefunden hat.28 Die Auftritte Rudolfs in diesem Rahmen waren jeweils mit seinen Wählern abgestimmt. Doch in der Folge seiner Behauptung als König trat Rudolf seit etwa der Zeit, in der er seine Söhne in den Fürstenstand erhob, als Erneuerer des Reichslandfriedens von Friedrich II. auf. Er hatte nach dem Sieg ausreichend Statur gewonnen und es rundet sein Königtum eindrucksvoll ab, dass die letzte Urkunde aus dieser Serie der Erneuerungen kurz vor seinem Tod in Speyer vorgenommen wurde.
Die Politik der Einbindung
Die Selbstbehauptung als König war indes nicht nur Schlachtenglück, sondern sie war die Konsequenz einer umsichtig organisierten Einbindungspolitik. Sie war in dieser Form das zweite neue Herrschaftsinstrument. Diese Einbindungspolitik zog maßgebliche Unterstützer von Ottokar ab und Rudolf gelang es, als Vollstrecker einer Allianz fürstlicher Interessen gegen den böhmischen König aufzutreten.29 Auf dem Nürnberger Hoftag, ein gutes Jahr nach seiner Wahl, eröffnete Rudolf die letzte Runde im Kreis zahlreicher Bischöfe, auch des Erzbischofs von Mainz und des Pfalzgrafen bei Rhein – mithin der ranghöchsten deutschen Fürsten. Die Fürsten richteten ein Ultimatum an Ottokar, der auch nach Jahr und Tag seine Lehen nicht aus der Hand des neuen Königs empfangen hatte.30 Sorgfältig, jeden Schritt durch den Konsens der Fürsten abgesichert, machte Rudolf seine Züge. Tatsächlich ließ er die Fürsten machen, allen voran seinen neuen Schwiegersohn, den Pfalzgrafen Ludwig. Ludwig überstellte das präzise berechnete Ultimatum an Ottokar. Das Nürnberger Dokument, das durch einen Speyerer Codex überliefert ist, ist frei von herrschaftlicher Rhetorik oder rhetorischer Kraftmeierei. Das präzise Protokoll der Schritte gegen Ottokar erscheint geradezu formalistisch. Der König nahm sich selber in diesem Prozess nach außen weitgehend zurück. Er überließ den Richterspruch dem Pfalzgrafen bei Rhein, dessen Zuständigkeit er zunächst von den anwesenden Fürsten feststellen ließ. Dabei ging es um eine entscheidende Frage für seine Zukunft: Darum, die Kräfte des Reiches gegen Ottokar hinter sich zu versammeln. Mit diesem Vorgehen lieferte Rudolf sein Meisterstück als König ab. Es hätte Alternativen gegeben. Er hätte seine Rolle als König hervorheben können. Er verzichtete umsichtig darauf und organisierte so die Unterstützung der Fürsten und relevanter Großer wie des Grafen von Görz-Tirol.31
Diese Unterstützung entband ihn nicht davon, das Urteil über Ottokar mit eigenen Kräften zu vollstrecken. In Verbindung mit einer umsichtigen Heiratspolitik, die auf weitgespannte europäische Hochzeiten verzichtete und die die eigene Familie schon am Wahltag mit dem Pfalzgrafen und dem Herzog von Sachsen verknüpfte, schuf Rudolf so ein Modellkönigtum für eine Übergangsphase. Handlungsfähig aber zurückhaltend, zielorientiert aber nicht geltungsbedürftig. In einem sehr weitgefassten Vergleich war seine Situation mit der Heinrichs I. nach dem Ende der Karolinger im Osten des Frankenreichs vereinbar. In einer etwas modernistischen Formulierung wäre Rudolf nicht der Erste unter gleichen, nicht der primus inter pares, sondern der Gleichere unter Gleichen, der parior inter pares. Angesichts der Position, von der er begonnen hatte, war das ein enormer Erfolg.
Kommunikation auf der Höhe der Zeit
Rudolf sicherte dieses Königtum durch eine besondere Strategie der Kommunikation ab, die ein drittes Instrument seiner Königspolitik war. Sie verband Rudolfs Möglichkeiten mit den Erfordernissen der sozialen Welt des 13. Jahrhunderts, denen der Staufer Friedrich II. sich mit einem herrscherlichen Gestus entzogen hatte, der bis heute eine eigentümliche Faszination entfaltet. Rudolf von Habsburg suchte dagegen die Nähe zu Franziskanern und Dominikanern. Er tat es darin dem französischen König Ludwig IX. gleich oder auch den englischen Königen. Sie nutzten die Strukturen und die Vernetzungen der Bettelmönche, um in ihren Königreichen Untersuchungen der Lebensbedingungen durchzuführen. Es war ein Bündnis mit einer dynamischen Kraft des 13. Jahrhunderts, die die Herzen vieler Zeitgenossen erreichte und bewegte.32 Es war auch ein Brückenschlag in die bewegte Welt der Städte und ihrer Bewohner, die Friedrich II. eher gemieden hatte.33 Der Erfolg dieser Verbindung schlug sich in der von Bettelmönchen maßgeblich mitgeprägten Überlieferung von Rudolfs Königtum in der Chronistik und der Legendenbildung nieder, die Rudolfs Königtum ein Gesicht gab und eine Traditionsbildung ermöglichte. Für die Wirkung dieses neuen Königstypus war dies ein bedeutender Beitrag. Annette Kehnel hat diese Entwicklung überzeugend skizziert und dabei auch auf Rudolfs Rücksichtslosigkeit und Brutalität in der Zeit als aufsteigender Graf verwiesen.34 Das sollte man in der Tat im Hinterkopf behalten. Mit dem Blick auf das Königtum aber vollzog Rudolf den erfolgreichen Wandel vom harten Krieger zum umsichtigen Politiker. Ein Wandel, den die Geschichte von Heinrich I. bis zu Yitzak Rabin von manchem bedeutenden Akteur kennt. Die Verbindung Rudolfs zu den Franziskanern schlug sich auch in einer weiteren bedeutenden Aufstiegsgeschichte nieder. Dass der Handwerkersohn Heinrich Knoderer aus Isny, der als Franziskaner zu einem engen Berater und Vertrauten Rudolfs wurde, erst Bischof von Basel, dann sogar Erzbischof von Mainz wurde, war eine untypische Karriere.35 Sie wurde möglich in Rudolfs Zeit.
Das Königtum Rudolfs von Habsburg wird in der Regel aus der Perspektive der salisch-staufischen Tradition bewertet. Daher liegt das Hauptaugenmerk auf der Rückgewinnung alter Größe, der Reformatio imperii oder der Revindicatio. In dieser Perspektive geht es dann um die Frage, ob Rudolf ein kleiner oder doch ein großer König gewesen sei.36 Man kann es auch anders sehen. Denn Rudolfs Geschichte zeigt den Versuch der deutschen Akteure, in Bezug auf das Königtum handlungsfähig zu bleiben. Das ist keine Feststellung in einem nationalen Sinne. Aber die Wahl des Grafen Rudolf war der bewusste Versuch der großen Familien im Reich nördlich der Alpen, trotz aller bestehenden Rivalitäten im eigenen Land einen König zu finden. Aus dem Kreis der fürstlichen Familien war das nicht möglich, die Konkurrenz ließ es nicht zu. So eröffnete die Wahl Rudolfs eine neue Perspektive. Sie war eine Aufstiegsgeschichte. Es gab diese Geschichten auch im Kreis der Fürsten. Der hohe Klerus rekrutierte sich auch aus Grafenfamilien. Aber beim Königtum ging es um einen weiteren Schritt. Ein König stieg als Individuum auf, aber wenn die Umstände günstig waren, konnte er seine Familie in den Fürstenstand erheben. Die Aufstiegsgeschichte Rudolfs von Habsburg hätte scheitern können. Dann wären möglicherweise schwerere Konflikte die Folge gewesen, wie der blutige Konflikt mit Ottokar zeigte. Dass Rudolf von Habsburg die geringe Chance, die man ihm bot, mit Umsicht und Entschlossenheit nutzte, eröffnete dem Königtum nördlich der Alpen eine arbeitsfähige Zukunft. Dass Rudolf nicht Kaiser wurde, war sicher nicht geplant. Aber für die deutsche Geschichte war es eher ein Glück. Durch die Einbindung der Fürsten in seine Politik, auch durch seine Heiratspolitik, beschränkte er den Radius des Königtums weitgehend auf Deutschland. Das war angesichts der bescheidenen Mittel von Vorteil. Er wuchs in die Rolle des Königs langsam hinein und zeigte sich lernfähig, obwohl er bei seiner Krönung vergleichsweise alt war. Die Erneuerung des Reichslandfriedens von Friedrich II. und das bewusste Sterben in Speyer rundeten diese erfolgreiche Aufsteigergeschichte ab. Rudolf konnte sein Schicksal bis zum Ende maßgeblich mitbestimmen. Seine Königsherrschaft zeigte anderen Familien der zweiten Reihe, dass das Königtum das Risiko wert war, das es mit sich brachte. Das späte Mittelalter verlief in Deutschland trotz seiner Größe vergleichsweise unblutig, und damit friedlicher als in Frankreich oder England, wo der Kampf der Großen um das Königtum zu blutigen Jahrzehnten führte. Dass Deutschland nach dem Ende der großen Dynastien zu einer funktionsfähigen und vergleichsweise friedlichen Regierung fand, ging auch auf das Königtum Rudolfs von Habsburg zurück.
1 Charta Comitis Palatini, in: Rudolfi regis constitutiones, hg. von Jakob SCHWALM, in: MGH. Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, Bd. 3, Hannover/Leipzig 1904–1906, Nr. 13, S. 15f.
2 Sächsische Weltchronik, Sächsische Fortsetzung, Kap. 4, hg. von Ludwig WEILAND, in: MGH. Deutsche Chroniken und andere Geschichtsbücher des Mittelalters, Bd. 2, Hannover 1877, S. 286; vergleiche auch Regesta Imperii VI. Die Regesten des Kaiserreichs unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273–1313, Abt. 1, hg. von Johann Friedrich BÖHMER/Oswald REDLICH, Innsbruck 1898, n. 4d; vergleiche dazu Oswald REDLICH, Rudolf von Habsburg. Das deutsche Reich nach dem Untergange des alten Kaisertums, Innsbruck 1903, 168f.
3 Zur Frage der Inszenierung öffentlicher Herrschaftshandlungen vgl. etwa: Gerd ALTHOFF, Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, 2. Auflage Darmstadt 2013; Spektakel der Macht. Rituale im alten Europa 800–1800, hg. von Barbara STOLLBERG-RILINGER/Matthias PUHLE/Jutta GÖTZMANN/Gerd ALTHOFF, Darmstadt 2008; Venedig als Bühne. Organisation, Inszenierung und Wahrnehmung europäischer Herrscherbesuche, hg. von Romedio SCHMITZ-ESSER/Knut GÖRICH/Jochen JOHRENDT, Regensburg 2017.
4 Vgl. etwa Egon BOSHOF, Hof und Hoftag König Rudolfs von Habsburg, in: Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im späteren Mittelalter, hg. von Peter MORAW (Vorträge und Forschungen 48), Stuttgart 2002, S. 387–415.
5 Zum Mainzer Hoftag 1235 vergleiche Wolfgang STÜRNER, Friedrich II. Der Kaiser, Darmstadt 2000, S. 309–316; Ernst KANTOROWICZ, Kaiser Friedrich II., Berlin 1927, S. 375–378 (allerdings nicht unproblematisch).
6 Für eine Übersicht über diese Jahre vergleiche etwa Wolfgang STÜRNER, Handbuch der Deutschen Geschichte, Bd. 6: Das 13. Jahrhundert 1198–1273, 10. Auflage Stuttgart 2006; Martin KAUFHOLD, Deutsches Interregnum und europäische Politik. Konfliktlösungen und Entscheidungsstrukturen 1230–1280 (MGH. Schriften 49), Hannover 2000; knapp: Martin KAUFHOLD, Die Könige des Interregnums: Konrad IV., Heinrich Raspe, Wilhelm, Alfons, Richard, in: Die deutschen Herrscher des Mittelalters. Historische Portraits von Heinrich I. bis Maximilian I. 919–1519, hg. von Bernd SCHNEIDMÜLLER/Stefan WEINFURTER, München 2003, S. 315–339.
7 Vergleiche dazu REDLICH, Rudolf von Habsburg (wie Anm. 2), S. 5–130; Peter MORAW, Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter 1250–1490 (Propyläen Geschichte Deutschlands 3), Berlin 1985, S. 211–218; Karl-Friedrich KRIEGER, Rudolf von Habsburg (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance), Darmstadt 2003, S. 9–89; KAUFHOLD, Deutsches Interregnum (wie Anm. 6), S. 433–457.
8 Zu Rudolfs Person vergleiche etwa REDLICH, Rudolf von Habsburg (wie Anm. 2), S. 77–130; KRIEGER, Rudolf von Habsburg, S. 229–241 (wie Anm. 7).
9 KRIEGER, Rudolf von Habsburg (wie Anm. 7), S. 100.
10 Zu diesen Toden: Regesta Imperii V,1,1. Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV, Friedrich II, Heinrich (VII), Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard 1198–1272, hg. von Johann Friedrich BÖHMER/Julius FICKER, Innsbruck 1881, n. 185a (Philipp von Schwaben, 21. Juni 1208); Regesta Imperii V,1,2. Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV, Friedrich II, Heinrich (VII), Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard 1198–1272, hg. von Johann Friedrich BÖHMER/Julius FICKER, Innsbruck 1882, n. 4383n (Heinrich (VII.) 12. Februar 1242). Vergleiche dazu STÜRNER, Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. 6 (wie Anm. 6), S. 175 f und S. 243.
11 Zu Wilhelms von Holland Tod: Regesta Imperii V,1,2. Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV, Friedrich II, Heinrich (VII), Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard 1198-1272, hg. von Johann Friedrich BÖHMER/Julius FICKER, Innsbruck 1882, n. 5286b (28. Januar 1256); zum Tod Adolfs von Nassau: Regesta Imperii V,2. Die Regesten des Kaiserreichs unter Rudolf, Adolf, Heinrich VII. 1272–1313, hg. von Vincenz SAMANEK, Innsbruck 1948, n. 1002.
12 Zum Mord an Albrecht I. durch seinen Neffen: Die Chronik des Matthias von Neuenburg, hg. von Adolf HOFMEISTER, in: MGH. Scriptores Rerum Germanicarium, Nova Series, Bd. 4, Berlin 1924–1940, S. 344f. (1. Mai 1308).
13 Zum Tod der Kaiserin (in Genua im November 1311) und zum Tod des Kaisers (in Buonconvento im August 1313) siehe die Chronik des Giovanni Villani, Buch 9, Kap.×28 und 52: Croniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani, Bd. 1 (Biblioteca Classica Italiana Secolo XIV 21), Triest 1857, S. 227 und S. 233.
14 Zu Rudolf von Habsburg vergleiche die bereits zitierte klassische Studie von Oswald REDLICH, Rudolf von Habsburg (wie Anm. 2); Karl-Friedrich KRIEGER, Rudolf von Habsburg (wie Anm. 7); Rudolf von Habsburg 1273–1291. Eine Königsherrschaft zwischen Tradition und Wandel, hg. von Egon BOSHOF/Franz-Reiner ERKENS (Passauer Historische Forschungen 7), Köln/Weimar/Wien 1993; knapp: Thomas ZOTZ, Rudolf von Habsburg, in: SCHNEIDMÜLLER/WEINFURTER, Die deutschen Herrscher des Mittelalters (wie Anm. 6), S. 340–359, S. 587 f; Martin KAUFHOLD, Rudolf I, in: Neue deutsche Biographie, Bd. 22, Berlin 2005, S. 167–169.
15 Zu Engelbert von Valkenburg in Köln vergleiche etwa Wilhelm JANSSEN, Das Erzbistum Köln im späten Mittelalter 1191–1515, Teil 1, Köln 1995, S. 174–182; zu Werner von Eppstein in Mainz vergleiche Regina SCHÄFER, Werner von Eppstein. Erzbischof von Mainz (1259–1284), in: Neugestaltung in der Mitte des Reiches. 750 Jahre Langsdorfer Verträge. 1263/2013, hg. von Ursula BRAASCH-SCHWERSMANN/Christine REINLE/Ulrich RITZERFELD, Marburg 2013, S. 207–222.
16 Vergleiche zu den Rangfragen im fürstlichen Milieu etwa die Publikationen der Arbeitsgruppe von Jörg Peltzer in Heidelberg „Rang und Ordnung/RANK“: Princely Rank in Late Medieval Europe. Trodden Paths and Promising Avenues (Rank 1), hg. von Thorsten HUTHWELKER/Jörg PELTZER/Maximilian WEMHÖFER, Ostfildern 2011; Jörg PELTZER, Der Rang der Pfalzgrafen bei Rhein. Die Gestaltung der politisch-sozialen Ordnung des Reiches im 13. und 14. Jahrhundert (Rank 2), Ostfildern 2013; Die Performanz der Mächtigen. Rangordnung und Identität in Gesellschaften des späten Mittelalters (Rank 5), hg. von Klaus OSCHEMA/Cristina ANDENNA/Gerd MELVILLE/Jörg PELTZER, Ostfildern 2015.
17 Vergleiche zur Dynamik des hohen Adels dieser Zeit Karl-Heinz SPIESS, Familie und Verwandtschaft im deutschen Hochadel des Spätmittelalters. 13. bis Anfang des 16. Jahrhunderts, 2. Auflage Stuttgart 2015.
18 Die österreichische Geschichte dieser Zeit ist nicht das Thema dieser kurzen Skizze. Vergleiche dazu Heide DIENST, Geschichte Österreichs bis zum Ende der Babenberger, Wien 1991; Alphons LHOTSKY, Geschichte Österreichs seit der Mitte des 13. Jahrhunderts 1281–1358, Wien 1967; Karl-Friedrich KRIEGER, Die Habsburger im Mittelalter, 2. Auflage Stuttgart 2004; Bernd SCHNEIDMÜLLER, Rang und Land. Bayern und Österreich vom 12. bis zum 14. Jahrhundert, in: Verbündet Verfeindet Verschwägert: Bayern und Österreich. Bayerisch-Oberösterreichische Landesausstellung 2012. Burghausen, Braunau, Mattighofen, 27. April bis 4. November 2012, hg. vom Haus der Bayerischen Geschichte, München 2012.
19 Vergleiche eine Zusammenfassung bei REDLICH, Rudolf von Habsburg (wie Anm. 2), S. 151–153.
20 Zur Geschichte der ersten Jahrzehnte des Hundertjährigen Krieges vergleiche Jonathan SUMPTION, The Hundred Years War, Bd. 1: Trial by Battle, Philadelphia 1990; Anne Elizabeth CURRY, The Hundred Years War, Basingstoke 2003; Joachim EHLERS, Der Hundertjährige Krieg, 2. Auflage, München 2012.
21 Caroline BURT, Edward I and the Governance of England. 1272–1307, Cambridge 2012.
22 Zu König Ottokar siehe Jörg K. HOENSCH, Premysl Otakar II. von Böhmen. Der goldene König, Graz 1989.
23 Litterae Regis Bohemiae ad Papam, in: Rudolfi regis constitutiones, hg. von Jakob SCHWALM, in: MGH. Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, Bd. 3, Hannover/Leipzig 1904–1906, Nr. 16, S. 19 (Schreiben Ottokars an den Papst).
24 Ebenda, S. 20.
25 Sententia de Feudis Imperii non Alienandis, in: Rudolfi regis constitutiones, hg. von Jakob SCHWALM, in: MGH. Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, Bd. 3, Hannover/Leipzig 1904–1906, Nr. 26, S. 28: Volentes igitur ob honorem et reformationem collapsi status imperii principum nostrorum et hominum super hec audire sententiam […].
26 Zur Schlacht bei Dürnkrut siehe etwa Karl-Friedrich KRIEGER, Die Schlacht bei Dürnkrut 1278, in: Höhepunkte des Mittelalters, hg. von Georg SCHEIBELREITER, Darmstadt 2004, S. 154–165; 700 Jahre Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen. Ausstellung im Schloss Jedenspeigen, 13.05—29.10.1978, hg. von Gottfried STANGLER, Wien 1978; zur Vorgeschichte der Schlacht mit etwas unterschiedlichen Akzenten: Gerd ALTHOFF, Rudolf von Habsburg und Ottokar von Böhmen. Formen der Konfliktaustragung und Beilegung im 13. Jahrhundert, in: Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, hg. von Gerd ALTHOFF, Darmstadt 1996, S. 85–98; Martin KAUFHOLD, Deutsches Interregnum (wie Anm. 6), S. 357–401.
27 Privilegium Regis Primum, in: Rudolfi regis constitutiones, hg. von Jakob SCHWALM, in: MGH. Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, Bd. 3, Hannover/Leipzig 1904–1906, Nr. 339.
28 Zu Rudolfs Revindikationspolitik vergleiche zuletzt etwa Franz-Reiner ERKENS, Zwischen staufischer Tradition und dynastischer Orientierung. Das Königtum Rudolfs von Habsburg, in: ERKENS/BOSHOF, Rudolf von Habsburg (wie Anm. 14), S. 33–58; Karl-Friedrich KRIEGER, Rudolf von Habsburg (wie Anm. 7) und Thomas ZOTZ, Rudolf von Habsburg (wie Anm. 14).
29 Zu Rudolfs Einbindungspolitik vergleiche etwa KAUFHOLD, Deutsches Interregnum (wie Anm. 6), S. 357–457.
30 Constitutiones editae, in: Rudolfi regis constitutiones, hg. von Jakob SCHWALM, in: MGH. Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, Bd. 3, Hannover/Leipzig 1904–1906, Nr. 72.
31 Zu den Grafen von Görz-Tirol siehe etwa Josef RIEDMANN, Die Grafen von Görz-Tirol und Ottokar sowie der Einfluß des Böhmenkönigs auf Nordostitalien, in: Böhmischösterreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert, hg. von Marie BLÁHOVÁ/Ivan HLAVÁCEK, Prag 1998, S. 147–162; Hermann WIESFLECKER, Meinhard der Zweite. Tirol, Kärnten und seine Nachbarländer am Ende des 13. Jahrhunderts, Innsbruck 1955.
32 Zu der Bewegung der Bettelmönche vergleiche etwa Clifford Hugh LAWRENCE, The Friars: the impact of the early mendicant movement on Western society, 2. Auflage London 2013.
33 Zum weiten Thema Bettelorden und Städte gibt es zahlreiche Einzelstudien, für eine allgemeine Perspektive vergleiche etwa Caroline Astrid BRUZELIUS, Preaching, building and burying: friars and the medieval city, New Haven 2014; vergleiche auch die ältere Studie: Thomas Michael MARTIN, Die Städtepolitik Rudolfs von Habsburg, Göttingen 1976.
34 Annette KEHNEL, Rudolf von Habsburg im Geschichtswerk der Colmarer Dominikaner, in: Studia Monastica. Beiträge zum klösterlichen Leben im Mittelalter. Gert Melville zum 60. Geburtstag, hg. von Reinhard BUTZ/Jörg OBERSTE, Münster 2004, S. 211–234.
35 Vergleiche Helmut BINDER, Heinrich von Isny. Franziskaner, Erzbischof von Mainz, Erzkanzler des Reichs unter Rudolf von Habsburg um 1220–1288, in: Lebensbilder aus Schwaben und Franken, hg. von Max MILLER/Robert UHLAND/Gerhard TADDEY, Bd. 16, Stuttgart 1986, S. 9–37; Alfred RITSCHER, Heinrich von Isny. Spuren des Vertrauten König Rudolfs von Habsburg, Basler Bischofs und Mainzer Erzbischofs in der zeitgenössischen Publizistik, in: Quellen, Kritik, Interpretation. Festgabe zum 60. Geburtstag von Hubert Mordek, hg. von Thomas Martin BUCK, Frankfurt am Main 1999, S. 219–235.
36 Den Begriff des „kleinen Königs“ hat Peter Moraw für die Könige nach dem Interregnum in seiner magistralen Darstellung eingeführt: Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung (wie Anm. 7), S. 211–218 und grundsätzlich zum Königtum, S. 149–175, Seitdem nehmen die biographischen Arbeiten über Rudolf zu dieser Frage Stellung. Bei der Zurückweisung des Begriffs „kleiner König“, der mir nach wie vor nicht unpassend erscheint, sollte man auch bedenken, dass Moraw in demselben Band von den deutschen Königen grundsätzlich als den „überforderten Königen“ spricht: Von offener Verfassung, S. 155–169.