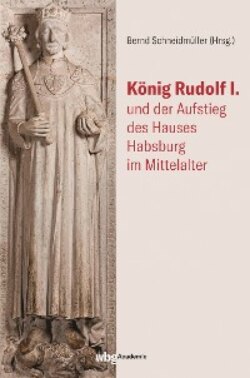Читать книгу König Rudolf I. und der Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter - Группа авторов - Страница 12
MARTINA STERCKEN Herrschaft gestalten Die Anfänge der Habsburger
ОглавлениеDas Werden der habsburgischen Herrschaft ist ein Prozess, der besonders seit der Zeit Rudolfs von Habsburg als Erfolgsgeschichte gilt. Dieser wird nicht nur als Lichtgestalt der deutschen Geschichte nach dem Interregnum betrachtet, weil es ihm gelang, als Aufsteiger die Königswürde zu erlangen und – anknüpfend an die Staufer – die königliche Macht erfolgreich zu restituieren; er ist auch als derjenige in die Geschichte eingegangen, der die Herrschaftsbasis der Habsburger maßgeblich erweitert hat.1 Wesentliche Aspekte sind dabei der Erwerb des Herzogtums Österreich und die damit verbundene Ausdehnung habsburgischer Macht Richtung Osten gewesen, aber auch der Beitrag, den Rudolf zur Intensivierung der Herrschaft im Südwesten des Reiches geleistet hat und seine glückliche Hand, wenn es darum ging, Situationen des Machtvakuums auszunutzen und allfällige Konkurrenten auszuschalten.2
Mit den folgenden Überlegungen zu den Anfängen der Habsburger bis in die Zeit Rudolfs von Habsburg wird eine regionale Perspektive eingenommen. Referiert werden sollen indes nicht ältere Beobachtungen zur beeindruckenden Fülle akkumulierter Herrschaftstitel, mit denen die Habsburger vor allem über Ankauf, Lehen und Heirat ihre Herrschaftsschwerpunkte am Oberrhein und im Aargau ausdehnten sowie intensivierten; und auch soll es nicht um ihre Rolle als Akteure in den immer ergebnisoffenen Aushandlungsprozessen um die Macht in dieser Region gehen (Abb. 1).3 Vielmehr werden gegenwärtige Interessen der Geschichtswissenschaft an den Prozessen und Phänomenen, die zur Gestaltung von politischer Ordnung beigetragen haben, aufgegriffen und die Kommunikation von Herrschaft zum Ausgangspunkt für die Frage nach der Herrschaftsbildung gemacht.4
Konkret wird an neueren Untersuchungen zur herrschaftlichen Praxis der Habsburger angeknüpft, die Formen der Vermittlung von Herrschaft nachgehen und dabei physische Anwesenheit, Stellvertreterschaft, familiäre Memoria und Schriftgebrauch als personale, materielle und immaterielle Präsenzformen von Herrschaft in Betracht ziehen.5 Diese sollen weiter akzentuiert werden, indem nach den frühen Formen der Vergegenwärtigung habsburgischer Herrschaft gefragt und der Blick so auf die Mittel gerichtet wird, mit denen politischen Ansprüchen zwischen Oberrhein und Alpenkamm Ausdruck verliehen wurde. Dabei sollen vor allem drei offensichtlich wesentliche Praktiken des Sichtbarmachens von Herrschaft erörtert und auf ihre Rolle im Rahmen des lang gestreckten Prozesses der Etablierung herrschaftlicher Strukturen befragt werden: Dies sind zunächst einmal evidente Marker von Raumherrschaft, wie Burgen und kleine Städte, aber auch Klöster, die als Stiftung des Adels oder als Ort adeliger Memoria auf herrschaftliche Verhältnisse verweisen. Dies ist ferner die Fixierung und Dokumentation von Herrschaft durch Urkunden und Urbare, die jeweils auf spezifische Art darauf hindeuten, dass die Verschriftlichung von Ansprüchen zu einem immer wichtigeren Mittel der Herrschaftsausübung wurde. Und dies sind schließlich historiographische Werke, mit denen adelige Herrschaft herausgestellt, narrativ gedeutet und legitimiert werden konnte.
Abb. 1: Habsburgischer Machtbereich um 1282 (nach Krieger, Die Habsburger, S. 72, Ausschnitt)
Raummarker
Mit den bisherigen Überlegungen zur frühen Herrschaftspraxis der Habsburger wurde durchaus auf Klöster, Burgen und Städte als Fixund Ansatzpunkte einer zunehmend auf die Fläche ausgelegten Herrschaft hingewiesen.6 Der jeweils unterschiedlichen Rolle und Halbwertszeit solcher Raummarker als Formen der Vergegenwärtigung des adeligen Geschlechts der Habsburger ist hingegen wenig Rechnung getragen worden. Zwar wurde beobachtet, dass diese zu bestimmten Zeiten aufkommen und in jeweils unterschiedlicher Weise zur Etablierung von Herrschaft beitragen, doch ist den Permanenzen und Brüchen ihrer Bedeutung im lang gestreckten Prozess der Herrschaftsbildung erst genauer nachzugehen.7
Als eine wesentliche Begründung für Stiftungen, Klostergründungen und Grablegen gilt die Sorge um das individuelle und familiäre Seelenheil, das durch die Geistlichkeit vor Ort gewährleistet werden sollte.8 Wie andere adelige Geschlechter ihrer Zeit nutzten indes auch die Habsburger das Totengedächtnis nicht nur, um für das Jenseits vorzusorgen; die Vergegenwärtigung der Verstorbenen unter den Lebenden diente gleichzeitig dazu, Herkommen, Macht und Ansprüche zukunftsgerichtet zu legitimieren.9 Dafür stehen die benediktinischen Klöster von Muri und Ottmarsheim, die in die erste Hälfte des 11. Jahrhunderts datiert werden. Als Eigenkirchen und Grablegen der habsburgischen Ahnen Radbot beziehungsweise Rudolf, welche die alten habsburgischen Herrschaftsschwerpunkte des Geschlechts im Oberelsass und im Aargau markierten, deuten sie darauf hin, dass adelige Geschlechter ihre familiäre Memoria nicht notwendig an einem Ort konzentrierten, sondern diese bereits früh räumlich diversifizierten (Abb. 2 und 3).10 Die enge Verknüpfung von sakralen mit herrschaftlichen Interessen an solchen Orten findet in besonderer Weise im Kirchenbau des Benediktinerinnenklosters in Ottmarsheim ihren Ausdruck. Hier orientieren sich die als oktogonaler Zentralbau konzipierte Anlage und das Marienpatrozinium offensichtlich am Vorbild der kaiserlichen Pfalzkapelle in Aachen und lassen insofern hohe Ansprüche der Stifter erkennen. In dieselbe Richtung deutet die Weihe der Kirche im Jahre 1049, die durch einen Papst, den aus dem Elsass stammenden Leo IX., vollzogen wurde.11
Abb. 2: Abtei Muri, Johann Kaspar Winterlin, 1615 (Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung, Muri AG I, 4)
Sind in dieser frühen Zeit die Stiftergräber bescheiden und die Überlieferung zur adeligen Schutzmacht begrenzt, so spiegeln die Orte habsburgischen Totengedächtnisses seit der Regierungszeit Rudolfs von Habsburg eine sich im 13. Jahrhundert entfaltende memoriale Kultur des Adels wider, die Verstorbene figural präsent werden lässt – und dies einmal mehr an verschiedenen Orten (Abb. 4).12 Dies zeigt sich nicht nur mit dem Grab König Rudolfs und der markant gestalteten Grabplatte in Speyer, deren Gestaltung bis in die Gegenwart diskutiert wird.13 Dies lässt bereits das Grabmal der ersten Gemahlin Rudolfs von Habsburg, Königin Anna, erkennen, die 1281 in Wien starb, jedoch – wohl aus politischen und familiären Gründen – nach 1282 im Basler Münster ihre letzte Ruhestätte fand.14 Ursprünglich vermutlich beim Hauptaltar und damit an einem zentralen liturgischen Ort im Basler Münster platziert, vergegenwärtigt die Grabplatte der Sandstein-Grabtumba die aufrecht stehend und gleichzeitig liegend konzipierten idealisierten Gestalten Königin Annas und ihres kleinen Sohnes Karl. Darüberhinaus macht das Grabmal durch die Wappen des Reiches, der Herzogtümer Österreich und Steiermark, der Grafen von Habsburg und der Herkunftsfamilie Annas, der Grafen von Hohenberg, auf königlich-landesherrlich und auch dynastisch-familiäre Aspekte des habsburgischen Herrschaftsverständnisses aufmerksam.15
Abb. 3: Abteikirche Ottmarsheim (Matthäus Merian, Topographia Alsatiae, Frankfurt a. M. 1643/44, S. 41, Ausschnitt, Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung T 137:a)
Abb. 4: Grabmal der Anna von Habsburg im Basler Münster (Marquard Herrgott, Rusten Heer, Martin Gerbert, Monumenta Augustae domus Austriacae, Tom. 4, 1–2: Taphographia Principum Austriae, St. Blasien 1772, Bd. 2, 1, Tab. IX)
Die habsburgische Partizipation an der jeweils zeitspezifischen Memorialkultur wird überdies in besonderer Weise mit dem Kloster Königsfelden deutlich, das nach Muri zur familiären Grablege in den aargauischen Stammlanden wurde (Abb. 5). In Erinnerung an die Ermordung von Rudolfs Sohn Albrecht I. im Jahre 1308 gestiftet, entwickelte sich dieses – wenn auch nicht zur einer verbindlichen Familiengrablege – so doch zu einer spektakulären Stätte familiärer Memoria und herrschaftlichen Selbstverständnisses der Habsburger als königliche Sippe.16 Durch familiäre Stiftungen ermöglicht, entstand hier ein Ort des Gebetsgedenkens an verstorbene Habsburger durch die Ordensgemeinschaften der Klarissinnen und der Franziskaner vor Ort. Zugleich wurden mit einem zentral angelegten Grabmal (dem Zugang zur Gruft) und mit den für franziskanische Kirchen ungewöhnlich kostbaren Glasfenstern im Chor der Klosterkirche die Habsburger in den Landen westlich des Arlbergs als gute Herrscher präsent gemacht und ihre enge Verbindung zum franziskanischen Orden vor Augen geführt.
Abb. 5: Kloster Königsfelden, Albrecht Kauw, 1669
In anderer Weise funktionieren Burgen als Kennzeichen früher habsburgischer Herrschaft. Dass den exponiert gelegenen, steinernen Anlagen als Ausdruck adeligen Standes sowie als Symbole von Macht und Wehrhaftigkeit eine wesentliche Bedeutung im Rahmen des hochmittelalterlichen Herrschaftsausbaus zukommt, ist vielfach hervorgehoben worden.17 Auch die Habsburger markierten auf diese Weise die frühen Kernzonen ihres Besitzes weithin sichtbar, wenngleich wohl weniger systematisch und architektonisch einschlägig als dies die ältere Forschung angenommen hat.18 Beispiel dafür bietet vor allem die Habsburg, während die Burganlagen von Wildegg, Brunegg und Schenkenberg, die zusammen mit der Stammburg als habsburgisches ‚Burgensystem‘ begriffen wurden, offenbar später entstanden sind und von Ministerialen der Habsburger erbaut wurden. Zudem lassen sich Burgen und steinerne Türme an Flussübergängen – zum Beispiel in Laufenburg am Rhein, in Brugg am Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat sowie in Freudenau an der Aare – mit dem Beginn des habsburgischen Herrschaftsausbaus verbinden. Besser belegt sind solche Burgen, die im 13. Jahrhundert von den Habsburgern errichtet oder von ihnen erworben wurden, wie die Neu-Habsburg am Nordwest-Ufer des Vierwaldstättersees, die Burg Lagenberg bei Laax/Graubünden, die Burg Hohlandsberg bei Colmar wie auch die Burgen in Baden und Lenzburg im Aargau sowie die Kyburg im Zürcher Hinterland.19
Abb. 6: Die Habsburg in Jakob Fuggers ‚Ehrenspiegel des Hauses Österreich‘, 1555 (München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 895)
Als dauerhaft namengebende Burg für das Geschlecht spielt die Habsburg beim Zusammenfluss von Aare und Reuss eine besondere Rolle, deren Anfänge als Stammburg der Habsburger in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen regionalen Chronistik mit farbigen Erzählungen festgehalten werden (Abb. 6).20 Der Name dieser Burg, deren Entstehung in das beginnende 11. Jahrhundert datiert wird,21 ist seit der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert erstmals urkundlich in Verbindung mit der Bezeichnung der Grafen bezeugt.22 Wie archäologische Ausgrabungen gezeigt haben, wurde die auf einem Felssporn angelegte Habsburg bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts immer weiter ausgebaut und muss als Doppelburg ein beeindruckendes Bauwerk dargestellt haben, bevor sie in nachhabsburgischer Zeit verfiel.23 Warum sie als Familiensitz in den zwanziger und dreißiger Jahren des 13. Jahrhunderts aufgegeben und zu Lehen gegeben wurde, wird damit begründet, dass die Burganlage den Ansprüchen eines immer bedeutenderen Herrschergeschlechts nicht gerecht wurde. Dies mag zutreffen. Ebenso bemerkenswert aber erscheint die Tatsache, dass die Habsburger grundsätzlich wenige Burgen zum Ausgangspunkt der räumlichen Fixierung ihrer Herrschaft gemacht haben. Ab der Mitte des 13. Jahrhunderts begannen sie vielmehr das Potential von Städten auszuschöpfen, die in der Folgezeit zunehmend als Großburgen und temporäre Residenzen im Herrschaftsgebiet, als Mittelpunkte der Verwaltung habsburgischen Besitzes in den neu entstehenden Ämtern, aber auch als wirtschaftlich interessante Märkte und als Reservoir an militärischer und finanzieller Unterstützung dienten (Abb. 7).24
Abb. 7: Habsburgische Stadtgründungen des 13. Jahrhunderts (nach Stercken, Städte der Herrschaft, S. 31, Ausschnitt)
Bezeichnend für die Habsburger erscheint, dass diese weniger als Städtegründer hervortraten, sondern – zumal ihr Herrschaftsausbau vergleichsweise spät erfolgte – sukzessive eine große Anzahl unter anderen Herrschaftsträgern entstandene, mehrheitlich junge Städte mit begrenzten Entwicklungschancen erwarben, die das Siedlungsnetz des Voralpenlandes um die Mitte des 13. Jahrhunderts verdichteten.25 Zu den habsburgischen Gründungen bis um 1300 gezählt werden Brugg, Bremgarten, Meienberg und Waldshut, die – wie viele Stadtgründungen anderer Herrschaftsträger auch – erst im Verlaufe der Zeit überhaupt als Städte in Erscheinung treten. Lediglich im Falle von Schwarzenbach lässt sich die gezielte Anlage einer Stadt nachweisen. Dieses wurde durch Rudolf von Habsburg als politisches Druckmittel im Rahmen einer Fehde mit dem Abt von St. Gallen vor 1289 gegründet und war als Gegengründung zu Wil, einem jungen Residenzstädtchen des Abtes, gedacht. Schwarzenbach entwickelte sich auch nur so lange auf Kosten Wils, bis der Konflikt 1301 beigelegt wurde.
Die Anlage von Schwarzenbach ist Teil einer in besonderem Maße seit der Regierungszeit Graf Rudolfs IV. fassbaren Politik der Habsburger, über Erbe, Kauf und Reichspfandschaften die Stadtherrschaften westlich des Arlbergs auszubauen. Dieses Vorgehen war offenbar nicht nur mit geostrategischem Kalkül verbunden, sondern auch mit Geschick, wenn es darum ging Gelegenheiten auszunutzen.26 Ein bedeutender Vorgang in diesem Kontext war zum Beispiel die Aneignung einer Reihe von Städten im Aargau und Thurgau, die mit dem sogenannten Erbe der Grafen von Kyburg-Dillingen nach 1264 in den Besitz der Habsburger gelangten. Wie Urkunden, urbarielle Aufzeichnungen und Rödel um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert deutlich werden lassen, konnte Rudolf den Besitzanspruch über die ehemals kyburgischen Güter und Rechte erfolgreich gegen die Ansprüche des Grafen Peter von Savoyen durchsetzen, der ebenfalls mit den Kyburgern verwandt war und auf die Erbschaft aspirierte.
Dass Rudolf Möglichkeiten zur Erweiterung des Stadtbesitzes wahrnahm, lassen verschiedene Ankäufe von Städten aus dem Besitz finanziell unter Druck geratener Herrschaftsträger vermuten. So kaufte er 1274 von Gräfin Anna, Tochter des Grafen Hartmann d. J. von Kyburg, und Graf Eberhard von Habsburg-Laufenburg die ehemals kyburgischen Städte Mellingen, Aarau, Lenzburg, Zug und Sursee sowie die habsburgisch-laufenburgischen Städte Willisau und Sempach. Und wenig später, nämlich 1277, veräußerte dasselbe Paar die von den Kyburgern ererbte, ehemals zähringische Stadt Freiburg im Üchtland an Albrecht, Hartmann und Rudolf, Söhne des nunmehrigen Königs Rudolf von Habsburg. Hingegen waren im Falle von Luzern vogteiliche Rechte Ausgangsbasis für den Ankauf der Stadt durch König Rudolf zuhanden seiner Söhne Albrecht und Rudolf aus der Hand des bisherigen Stadtherrn, des offenbar hoch verschuldeten Abts von Murbach, im Jahre 1291.
Dass mit dem Stadtbesitz als raumwirksames Herrschaftsmittel auch Vorstellungen von der Herrschaft über Städte verbunden waren, lassen die habsburgischen Stadtrechtsprivilegien des ausgehenden 13. Jahrhunderts erkennen, die Stadtherrschaften zu vereinheitlichen tendierten. Die Rechtsausstattung von Winterthur durch Rudolf von Habsburg setzte den Standard für nachfolgende Privilegien für Städte, die ihrerseits den herrschaftlichen Zugriff auf die Schultheißen- und Leutpriesterwahl – und damit auf die bürgerlichen Gemeindevorstände – fixierten.27 Diese Haltung führte übrigens in den wenigen größeren Städten – zum Beispiel Freiburg i. Ue. und Luzern – um 1300 und in den kleinen Städten dann im ausgehenden 14. Jahrhundert zu Konflikten zwischen Bürgerschaft und habsburgischen Stadtherren. Zugleich signalisieren die Stadtrechtsprivilegien ein weiteres, seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wesentliches Gestaltungselement der frühen habsburgischen Herrschaft, nämlich die zunehmende schriftliche Fixierung von Ansprüchen.
Beurkundung
Die Auseinandersetzung mit der vor allem in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wachsenden Produktion von Schriftgut hat die zunehmende Bedeutung der Verschriftlichung von Ansprüchen in den Aushandlungsprozessen der politisch unruhigen Zeiten der ausgehenden Stauferzeit und des Interregnums ins Blickfeld gerückt. Gezeigt wurde, dass diese als Mittel der Herrschaftsstabilisierung gegenüber Beherrschten und Konkurrenten, aber auch als Instrument begriffen wurde, um die herrschaftliche Verfügungsgewalt über eine kulturelle Praktik materiell sichtbar zu machen.28 Versucht man nachzuvollziehen, wie die habsburgische Herrschaft bis ins 12. Jahrhundert in der schriftlichen Überlieferung fassbar wird, so muss man sich mit einer prekären Tradition befassen. Hauptquelle dafür nämlich sind die Acta Murensia, eine Sammel-Handschrift aus dem Kloster Muri, die in die Zeit um 1150 datiert wird, allerdings lediglich in einer spätmittelalterlichen Fassung erhalten ist.29 Auf diese Überlieferung, die unter anderem Quelle für frühe Besitzansprüche der Habsburger in der Region ist, wird noch einzugehen sein. Betrachtet man indes die davon unabhängige urkundliche Überlieferung zu den habsburgischen Grafen aus, so zeigt sich folgendes Bild:
Die wachsende Bedeutung dieses Grafengeschlechts in der Region wird zunächst einmal über kaiserliche und königliche Urkunden aus der ersten Hälfte des 12. und dem beginnenden 13. Jahrhunderts fassbar, die sie insbesondere als Zeugen von Schenkungen zu Gunsten von Klöstern – so etwa Einsiedeln, Engelberg, Kreuzlingen oder St. Blasien – ausweisen.30 Des Weiteren lässt die päpstliche Urkundenüberlieferung zu Beginn des 13. Jahrhunderts den Bedeutungszuwachs der Habsburger auf reichspolitischer Ebene erkennen, so im Thronstreit zwischen dem Welfen Otto und Philipp von Schwaben.31 Urkunden des Papstes Innozenz IV. aus den Jahren 1247/1248 an verschiedene geistliche Herren machen hingegen deutlich, dass die habsburgischen Grafen auch eine Rolle in den regionalen Parteiungen im Konflikt zwischen Papst und Kaiser um die Mitte des 13. Jahrhunderts spielten und zwar teils auf päpstlicher und teils auf kaiserlicher Seite.32
Erst aber seit der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert und in der Zeit Rudolfs II. († 1232), Albrechts IV. († 1239) und Rudolfs III. († 1249), also von Großvater, Vater und Onkel des späteren Königs Rudolf von Habsburg, treten die Habsburger immer mehr selbst als Aussteller von Urkunden in Erscheinung. In dieser Zeit sind es vor allem Stiftungen an klösterliche Gemeinschaften, die vom ansteigenden Bedarf an Schriftlichkeit bei der Dokumentation von Herrschaftstiteln zeugen und auf Herrschaftsansprüche in der Region schließen lassen.33 Zugleich werden die Habsburger mit den Urkunden anderer Herrschaftsträger in ihrer Rolle als Landgrafen im Elsass und als keineswegs unbedeutendes Adelsgeschlecht greifbar.34
In diesem Kontext erscheint eine Urkunde auffällig, die einen offenbar länger andauernden Teilungsprozess des habsburgischen Besitzes in den dreißiger Jahren des 13. Jahrhunderts markiert und eine sich sukzessive vollziehende Trennung der habsburgischen Familie in zwei Linien anzeigt.35 Diese hält die vor Bischof Lüthold von Basel, Graf Ludwig von Froburg und weiteren Edelleuten erfolgte Annahme eines Schiedsspruchs durch Albrecht IV. und Rudolf III. fest (Abb. 8). Aufschlussreich ist diese Urkunde nicht allein, weil sie zumindest in Bezug auf eine begrenzte Anzahl größerer und kleinerer Herrschaftsrechte recht detailreich festhält, was wem zusteht und was gemeinsam verwaltet wird: Darunter wird die Landgrafschaft im Elsass genannt, die vorerst gemeinsam durch die beiden Grafen gehalten werden soll; es werden ferner weniger bedeutende Ansprüche erwähnt, wie etwa der Besitz von Häusern und Türmen, Eigenkirchen, Vogteirechten oder Rechten über die Leute im Aargau. Der Urkunde kommt auch insofern ein besonderer Stellenwert zu, als die schriftlich fixierten Abmachungen zwischen den habsburgischen Grafen Albrecht IV. und Rudolf III. in deutscher Sprache verfasst sind. Sie dokumentiert damit die mit der wachsenden Bedeutung von Urkunden in Rechtsverkehr und Herrschaftspraxis insgesamt verbundene Tendenz, bei wichtigen Texten, die womöglich vorgelesen wurden, die Volkssprache und nicht die übliche lateinische Gelehrten- und Kanzleisprache zu nutzen.36 Sie deutet gleichermaßen darauf hin, dass sich dieser Prozess, der auf der Ebene des Reiches zum Beispiel mit dem in lateinischer sowie deutscher Fassung überlieferten Mainzer Reichslandfrieden von 1235 sichtbar wird, bereits früh im Südwesten des Reiches und im habsburgischen Kontext abspielte.
Abb. 8: Volkssprachliche (Teilungs-)Urkunde von 1238/1239 (Archives de l‘ancien Evêché de Bâle)
Auffallend ist ebenso, dass die Dynamik der Urkundenproduktion in der Folgezeit, während der Regierung Graf Rudolfs IV., nochmals stark zunahm. Wie bereits die Zusammenstellung in den ‚Regesta Habsburgica‘ deutlich macht, wurde der Urkundengebrauch auf alle möglichen Rechtsgeschäfte ausgedehnt und waren auch die Frauen der habsburgischen Herrschaftsträger mehr und mehr am Handeln mit Schrift beteiligt.37 Nach wie vor ist insbesondere die Stiftung von Gütern und Rechten an regionale Klöster Gegenstand der habsburgischen Urkunden; doch wird nunmehr auch in anderen Kontexten begonnen, Anspruch auf ein vielfältiges Konglomerat an Herrschaftsrechten zu fixieren, das unter anderem Grafschaftsrechte, Klostervogteien, Grundbesitz, Burgen, Städte, Mühlen, Gerichts-, Zoll-, Münz-, und Marktrechte beinhaltet.38
Abb. 9: Habsburgischer Rodel über Einkünfte und Verpfändungen, um 1273 (Staatsarchiv Zürich, Stadt und Landschaft Nr. 3228)
Mit diesem offensichtlich steigenden Interesse an einer Verschriftlichung und Systematisierung von Herrschaftstiteln im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts fanden habsburgische Herrschaftsansprüche neue Formen des Ausdrucks: Ungefähr um die Zeit der Königswahl Rudolfs von Habsburg wurde begonnen, Einkünfte aufzuzeichnen und mit Verpfändungen auch eine immer üblicher werdende Form der Kommerzialisierung von Rechten und Besitz festzuhalten (Abb. 9).39 Vor allem aber lässt das augenscheinlich groß angelegte Projekt des sogenannten ‚Habsburgischen Urbars‘ zu Beginn des 14. Jahrhunderts eine neue Qualität der Herrschaftsorganisation erkennen. Hier werden detailreich Eigenleute und Besitz ausgewiesen und Anspruch auf finanzielle Erträge der Habsburger aus Gericht, Hoheitsrechten und Steuern fixiert. Auch wird mit diesem Urbar die Verfestigung einer in Ämter gegliederten Verwaltung herrschaftlicherseits beanspruchten Gebiets fassbar, die Streubesitz und verschiedenartige Rechte in eine Suprastruktur einpasste.40
Chronikalische Verankerung
Die frühe regionale Chronistik lässt deutlich werden, dass habsburgische Herrschaft nicht nur über raumwirksamen Besitz und urkundlich beziehungsweise urbariell fixierte Ansprüche konstituiert wird, sondern auch über Darstellungen, die griffige Deutungen von Ursprüngen und Legitimation adeliger Geschlechter, mithin also Begründungsnarrative für Herrschaft, zur Verfügung stellen.41 Es sind die im Kloster Muri entstandenen und bereits kurz erwähnten ‚Acta Murensia‘, die erstmals die Frühgeschichte von Kloster und habsburgischer Stifterfamilie dokumentieren (Abb. 10).42 Diese wurden mit der Neuedition von 2012 in die Mitte des 12. Jahrhunderts datiert, sind aber lediglich in einer Handschrift aus der Zeit um 1400 überliefert, die genealogische, chronikalische und urbarielle Aufzeichnungen zusammenstellt. In ihrer Heterogenität bietet die Tradition der Acta das Material, das einem klösterlichen Interesse an einer Geltungsgeschichte entgegenkommt, die Anfänge und Rang des Klosters mit einem vielversprechenden Gründungsgeschlecht verbindet, und das zugleich adelige Geschlechter seit dem Hochmittelalter offenbar benötigen, um ihren Herrschaftsanspruch historisch zu begründen: Eine Genealogie führt die Ahnen der Habsburger auf und macht damit nicht nur Herkunft und Verbindungen einer adeligen Familie im regionalen, aber (mit Lothringern und Welfen) auch überregionalen Kontext namentlich fassbar, sondern bezeugt auch ihre Formierung zum bedeutenden Adelsgeschlecht.43 Eine detailreiche Geschichte der Klostergründung durch Ita und Radbot weist die Stiftung als Sühneleistung für vorangehende Missetaten vor Ort aus. Sie erzählt eingängig von den herrschaftlichen Verhältnissen in Muri und liefert darüber hinaus einen Kontext für die hier mit den genannten Stiftern einsetzende Herrscher-Memoria.
Abb. 10: Acta Murensia, Genealogia, um 1150, Abschrift um 1400 (Staatsarchiv Aarau AA/4947)
Wie Kloster und Herrschergeschlecht von der Genealogie und der Gründungsgeschichte Gebrauch machten, lässt sich indes konkreter erst seit dem ausgehenden Mittelalter feststellen, also nach der spätmittelalterlichen Abschrift der Acta.44 Dann nämlich werden die Acta Murensia Bezugspunkt der klösterlichen Gemeinschaft vor Ort, die sie in prekären Zeiten nutzten, um auf die alte Beziehung des Klosters zu den habsburgischen Schutzherren hinzuweisen, welche zwar in der Region nunmehr an Macht verloren hatten, aber im europäischen Kontext immer mehr an Bedeutung gewannen. Noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts deutet ein emphatisch angelegter Kupferstich auf die überkommenen Herrschaftsbeziehungen und verschiedene Aspekte habsburgischer Gestaltung von Herrschaft hin. Der ‚Prospectus Monasterii Murensis‘, von Leodegar Mayer in Muri konzipiert, verbindet die Darstellung der aktuell bestehenden, nunmehr barock um- und ausgebauten Klosteranlage von Muri nicht nur über Wappendarstellungen mit der Stifterfamilie, sondern auch, indem sie verschiedene Dimensionen der habsburgischen Ursprungsgeschichte zusammenführt: zum einen durch eine Burganlage, die offenbar auf die Habsburg als Stammburg des Geschlechts verweisen soll, zum anderen durch die von einem Engel mit Posaune gehaltenen Acta Murensia, mit der wiederum eine Kette verbunden ist, deren Glieder die in dieser Überlieferung fixierten Namen habsburgischer Ahnen bis hin zu König Rudolf I. ausweisen (Abb. 11).45 Die Acta werden aber auch mit der humanistischen Geschichtsschreibung im Umfeld der Habsburger seit dem 16. Jahrhundert rezipiert, wenn es darum ging, frühe Ursprünge und die Bedeutung des adeligen Geschlechts herzuleiten.46
Von den Acta Murensia, die die habsburgische Herrschaft genealogisch zu begründen, historisch zu legitimieren und regional zu verankern ermöglichen, unterscheidet sich die chronikalische Bewertung der habsburgischen Herrschaft seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur nimmt die Produktion von Historiographie zu und wird zum städtischen Phänomen, auch richtet die Geschichtsschreibung ihr Interesse nunmehr in erster Linie auf die Figur des Grafen und Königs Rudolf von Habsburg.47 Sowohl die Chronistik im herrschaftlichen Umfeld wie auch die Geschichtsschreibung der oberdeutschen Städte und der dort beheimateten, Habsburg nahen Bettelorden entwerfen im Wesentlichen das langfristig gültig bleibende Bild eines strengen, weisen und friedliebenden Königs. Gleichzeitig setzt mit Gedichten, Liedern und anderer volkstümlicher Überlieferung eine Popularisierung solcher Zuschreibungen ein. Verbreitung finden damit Vorstellungen von einem zur Königswürde aufgestiegenen Grafen, der die Bodenhaftung einfacherer Herkunft mit königlichen Fähigkeiten verbindet.48 Kleine Begebenheiten schildernd, bringen sie das Ideal eines schlichten, frommen und bürgernahen Herrschers mit Witz in die Erinnerungskultur ein, lassen aber auch panegyrische Formen der Herrschaftsinszenierung erkennen. So zeichnen Gedichte des wohl im Kloster Muri erzogenen Konrad von Mure († 1281), Leiter der Schule am Zürcher Großmünsterstift, das verklärende Bild Rudolfs als eines christlichen Königs von ausnehmender Rechtschaffenheit, der die Armen beschützt.49 Sie machen aber auch deutlich, dass Rudolf von Habsburg durchaus bereits von den Zeitgenossen als Retter-Gestalt verstanden wurde, die in wirren Zeiten für Sicherheit sorgt. Konrad von Mure vergleicht ihn mit einem strahlenden Gestirn, das dem Volk, das Schiffbruch erleidet, einen sicheren Hafen zu finden ermöglicht.50
Abb. 11: Prospectus Monastery Murensis, Kupferstich nach Leodegar Mayer, Muri 1750 (Staatsarchiv Aargau GS/00644-2)
Vermittlungsformen von Herrschaft
Mit dem Fokus auf Formen der Vermittlung von Herrschaft lässt sich der Beginn der habsburgischen Machtentfaltung im Südwesten des Reiches als ein Prozess der Vervielfältigung und Intensivierung von Medien der Herrschaftsstabilisierung beschreiben, der offenbar in Zeiten erhöhten Konkurrenzdrucks an Fahrt aufnimmt. Klöster und Memorialstätten, Burgen und Städte, Schrifttum und Historiographie haben sich dabei als pragmatische oder artifiziell angelegte Präsenzformen von Herrschaft erwiesen, die in unterschiedlicher Herrschaftsnähe entstanden sind, die über ein je verschiedenes Potential an Öffentlichkeit und Wirkung verfügten und die in ihrer Bedeutung für die Habsburger eine jeweils andere Halbwertszeit besaßen.
Der Wandel im Gebrauch von Herrschaftsmitteln – die Ablösung von Burgen durch Städte als Herrschaftsmarker, die Verschriftlichung von Ansprüchen, die zunehmend aufwändig personalisierten Inszenierungen von Stiftergräbern und die Diversifizierung chronikalischer Deutungen – charakterisiert sicher nicht nur die habsburgische Sphäre. Doch scheinen die Habsburger vergleichsweise früh und – in besonderem Maße mit der Regierungszeit und dem Königtum Rudolfs – gezielter als andere Grafengeschlechter zeitspezifische Formen der Stabilisierung von Herrschaft eingesetzt zu haben. Dies gilt mit Blick auf die Verschriftlichung von Herrschaftsansprüchen und die Memorialpraktiken, vor allem wohl aber auf die Einbeziehung von Städten in die Herrschaftspraxis.
Zwar lassen sich die Wirkmöglichkeiten solcher Vermittlungsformen habsburgischer Ansprüche im Einzelnen nur annähernd einschätzen und bleiben Momente ihrer Wahrnehmung durch die Zeitgenossen, wie sie weniger in der urkundlichen als vielmehr in chronikalischer und dichterischer Überlieferung tradiert sind, begrenzt. Doch hat die für viele Zeitgenossen augenscheinlich erstaunliche Wahl Graf Rudolfs zum König offenbar einen gewissen Boom in der Produktion von Schriftgut ausgelöst, welches auch Deutungen der habsburgischen Herrschaft anbot. Von offenbar nachhaltiger Wirkung waren insbesondere die über populäre Verbreitungsformen zirkulierenden Vorstellungen von Rudolfs pragmatisch-bodenständiger, in der göttlichen Ordnung aufgehobener Herrschaftspraxis, zugleich aber auch verklärte Idealbilder seiner Person als eines christlichen Königs und Retters in politisch prekären Zeiten.
1 Oswald REDLICH, Rudolf von Habsburg. Das Deutsche Reich nach dem Untergange des alten Kaisertums, Innsbruck 1903; Rudolf von Habsburg 1273–1291. Eine Königsherrschaft zwischen Tradition und Wandel, hg. von Egon BOSHOF/Franz-Rainer Erkens (Passauer historische Forschungen 7), Köln/Weimar/Wien 1993; Karl-Friedrich KRIEGER, Die Habsburger im Mittelalter. Von Rudolf I. bis Friedrich III., Stuttgart 1994; Karl-Friedrich KRIEGER, Rudolf von Habsburg, Darmstadt 2003.
2 Hans-Erich FEINE, Die Territorialbildung der Habsburger im deutschen Südwesten, vornehmlich im späten Mittelalter, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 67, 1950, S. 176–308; Hans-Erich FEINE, Entstehung und Schicksal der vorderösterreichischen Lande, in: Vorderösterreich. Eine geschichtliche Landeskunde, 2 Bde., hg. von Friedrich METZ, Freiburg 1959, S. 47–66; Martina STERCKEN, Shaping a dominion. Habsburg Beginnings, in: The Origins of the German Principalities, 1100–1350: Essays by German Historians, hg. von Graham A. LOUD/Jochen SCHENK, London 2017, S. 329–346; vgl. auch den Beitrag von Christina LUTTER in diesem Band.
3 Dazu Anm. 2; vgl. auch Roger SABLONIER, Adel im Wandel. Untersuchungen zur sozialen Situation des ostschweizerischen Adels um 1300, 2. Aufl. Zürich 2000.
4 Vgl. dazu etwa Die Medien der Geschichte. Historizität und Medialität in interdisziplinärer Perspektive, hg. von Fabio CRIVELLARI/Kay KIRCHMANN/Marcus SANDL/Rudolf SCHLÖGL, Konstanz 2004; Rudolf SCHLÖGL, Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden, in: Geschichte und Gesellschaft 34, 2008, S. 155–224; Bernd SCHNEIDMÜLLER, Vor dem Staat. Neuere Versuche zur mittelalterlichen Herrschaft, in: Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte 13, 2008, S. 178–186; Martina STERCKEN, Medien und Vermittlung gesellschaftlicher Ordnung. Beiträge der schweizerischen Geschichtsforschung zum Spätmittelalter, in: Traverse 1/2012, S. 212–225; Barbara STOLLBERG-RILINGER, Rituale (Campus Historische Einführungen 16), Frankfurt/M. 2013.
5 Vgl. z.B. Thomas ZOTZ, Präsenz und Repräsentation. Beobachtungen zur königlichen Herrschaftspraxis im hohen und späten Mittelalter, in: Herrschaft als soziale Praxis, hg. von Alf LÜDTKE, Göttingen 1991, S. 168–194; Thomas ZOTZ, Fürstliche Präsenz und fürstliche Memoria an der Peripherie der Herrschaft, in: Principes. Dynastien und Höfe im späten Mittelalter, hg. von Claudia NOLTE/Karl-Heinz SPIESS/Ralf-G. WERLICH, Stuttgart 2002, S. 349–370; Alexander SAUTER, Fürstliche Herrschaftsrepräsentation. Die Habsburger im 14. Jahrhundert, Ostfildern 2003; Martina STERCKEN, Herrschaftsinstrument, Statussymbol und Legitimation. Gebrauchsformen habsburgischer Privilegien im 13. und 14. Jahrhundert, in: Stadtgründung und Stadtplanung – Freiburg während des Mittelalters/Fondation et planification urbaine. Fribourg au moyen âge, hg. von Hans-Joachim SCHMIDT (Geschichte: Forschung und Wissenschaft 33), Freiburg/Fribourg 2009, S. 245–268; Martina STERCKEN, Formen herrschaftlicher Präsenz. Die Habsburger in ihren Städten im Gebiet der heutigen Schweiz, in: Habsburger Herrschaft vor Ort – weltweit (1300–1600), hg. von Simon TEUSCHER/Thomas ZOTZ/Jeannette RAUSCHERT, Zürich 2013, S. 149–168; Martina STERCKEN, „saeldenrîche frowen“ und „gschwind listig wib“. Weibliche Präsenz Habsburgs im Südwesten des Reiches, in: Mächtige Frauen? Königinnen und Fürstinnen im europäischen Mittelalter 11.–14. Jahrhundert, hg. von Claudia ZEY (Vorträge und Forschungen 81), Ostfildern 2015, S. 337–364.
6 Vgl. Literatur unter Anm. 1 und 2.
7 Zu überkommenen Deutungsmustern adeligen Handelns vgl. Jürgen DENDORFER, Gescheiterte Memoria? – Anmerkungen zu den „Hausklöstern“ des hochmittelalterlichen Adels, in: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 73, 2014, S. 17–38; Martina STERCKEN, Die Figur des Stadtgründers. Zähringer und Habsburger im Vergleich, in: Die Zähringer. Rang und Herrschaft um 1200, hg. von Jürgen DENDORFER/Heinz KRIEG/R. Johanna REGNATH (Veröffentlichung des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br. 85), Freiburg i. Br. 2018, S. 141–156.
8 Heinrich KOLLER, Die Habsburger Gräber als Kennzeichen politischer Leitmotive in der österreichischen Historiographie, in: Historia mediaevalis. Studien zur Geschichtsschreibung und Quellenkunde des Mittelalters, hg. von Dieter BERG/Hans-Werner GOETZ, Darmstadt 1988, S. 256–269; Johannes GUT, Memorialorte der Habsburger im Südwesten des Alten Reiches. Politische Hintergründe und Aspekte, in: Vorderösterreich nur die Schwanzfelder des Kaiseradlers? Die Habsburger im deutschen Südwesten, hg. vom Württembergischen Landesmuseum Stuttgart, Stuttgart 1999, S. 95–113; Brigitte LAURO, Die Grabstätten der Habsburger. Kunstdenkmäler einer europäischen Dynastie, Wien 2007; Bettina SCHÖLLER, Zeiten der Erinnerung. Muri und die Habsburger im Mittelalter (Murenser Monografien 2), Zürich 2018.
9 Otto Gerhard OEXLE, Memoria als Kultur, in: Memoria als Kultur, hg. von Otto Gerhard OEXLE (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 121), Göttingen 1995, S. 9–78; Christine SAUER, Fundatio et memoria, Stifter und Klostergründer im Bild 1100–1350 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 109), Göttingen 1993; Michael BORGOLTE, Zur Lage der deutschen Memoria-Forschung, in: Memoria. Ricordare e dimenticare nella cultura del medioevo. Erinnerung und Vergessen in der Kultur des Mittelalters, hg. von Michael BORGOLTE/Cosimo Daminano FONSECA/Hubert HOUBEN (Annali dell’ Istituto storico italo-germanico in Trento 15), Bologna/Berlin 2005, S. 21–28; Sépulture, mort et représentation du pouvoir au moyen âge. Tod, Grabmal und Herrschaftsrepräsentation im Mittelalter, hg. von Michel MARGUE, Luxemburg 2006, S. 613–636; Harald WINKEL, Herrschaft und Memoria. Die Wettiner und ihre Hausklöster im Mittelalter (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 32), Leipzig 2010.
10 Jean-Luc EICHENLAUB/René BORNERT, Abbaye Ste. Marie d‘Ottmarsheim, in: Les monastères d‘Alsace, Bd. 3, hg. von René BORNERT, Strassburg 2010, S. 486–524; Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich IV. 1056 (1050)–1106, Lfg. 1: 1056 (1050)–1065, neubearb. von Tilmann STRUVE (J. F. Böhmer, Regesta Imperii III/2), Köln/Weimar/Wien 1984, S. 145, Nr. 329; Helvetia Sacra Abt. III, Die Orden mit Benediktinerregel. Bd. 1: Frühe Klöster, Die Benediktiner und Benediktinerinnen in der Schweiz, red. von Elsanne GILOMEN-SCHENKEL, Basel 1986, S. 896–952; Hans Jakob WÖRNER/Judith Ottilie WÖRNER-HASLER, Abteikirche Ottmarsheim, 8. Aufl. Lindenberg 2012; LAURO, Grabstätten (wie Anm. 8), S. 9–12; Bruno MEIER, Das Kloster Muri, Baden 2011; DENDORFER, Gescheiterte Memoria? (wie Anm. 7), S. 35f.
11 EICHENLAUB/BORNERT, Abbaye (wie Anm. 10), S. 487.
12 Vgl. Hans KÖRNER, Grabmonumente des Mittelalters, Darmstadt 1997, S. 31, S. 106; LAURO, Grabstätten (wie Anm. 8), S. 242–244; SAUTER, Herrschaftsrepräsentation (wie Anm. 5), S. 110.
13 Vgl. den Beitrag von Matthias MÜLLER in diesem Band; s. auch LAURO, Grabstätten (wie Anm. 8), S. 29–38; Rudolf J. MEYER, Königs- und Kaiserbegräbnisse im Spätmittelalter. Von Rudolf von Habsburg bis Friedrich III. (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 19), Köln/Weimar/Wien, 2000, S. 41–52; vgl. auch Barbara SCHEDL, Der König und seine Klosterstiftung in der Stadt Tulln (Beiträge zur Kirchengeschichte Niederösterreichs 14), St. Pölten 2004.
14 Zusammenfassend: STERCKEN, „saeldenrîche frowen“ (wie Anm. 5), S. 347–350.
15 Vgl. Jean-Marie MOEGLIN, Dynastisches Bewusstsein und Geschichtsschreibung. Zum Selbstverständnis der Wittelsbacher, Habsburger und Hohenzollern im Spätmittelalter (Schriften des historischen Kollegs. Vorträge 34), München 1993, S. 40; SAUTER, Herrschaftsrepräsentation (wie Anm. 5), S. 145f.; LAURO, Grabstätten (wie Anm. 8), S. 244.
16 Vgl. dazu Heinz-Dieter HEIMANN, Mord – Memoria – Repräsentation. Dynastische Gedächtniskultur und franziskanische Religiosität am Beispiel der habsburgischen Grablege Königsfelden im späten Mittelalter, in: Imperios sacros, monarquias divinas. Heilige, Herrscher, göttliche Monarchen, hg. von Carles RABASSA/Ruth STEPPER (Humanitats 10), Castello de la Plana 2002, S. 267–290; Brigitte KURMANN-SCHWARZ, Die mittelalterlichen Glasmalereien der ehemaligen Klosterkirche Königsfelden (Corpus Vitrearum Medii Aevi Schweiz 2), Bern 2008; Brigitte KURMANN-SCHWARZ, Zeichen der Frömmigkeit oder Bilder der Herrschaft, in: Habsburger Herrschaft vor Ort (wie Anm. 5), S. 137–148; Claudia MODDELMOG, Stiftung als gute Herrschaft. Die Habsburger in Königsfelden, in: Die Habsburger zwischen Aare und Bodensee, hg. von Peter NIEDERHÄUSER (Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich 77), Zürich 2010, S. 209–222; STERCKEN, „saeldenrîche frowen“ (wie Anm. 5), S. 350–352.
17 Vgl. dazu zusammenfassend: Joachim ZEUNE, Burgen. Symbole der Macht. Ein neues Bild der mittelalterlichen Burg, Regensburg 1996; s. auch Werner MEYER, Die Burg als repräsentatives Statussymbol. Ein Beitrag zum Verständnis des mittelalterlichen Burgenbaues, in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 33, 1976, S. 173–181.
18 Dazu und zum Folgenden vgl. Werner MEYER, Habsburgischer Burgenbau zwischen Alpen und Rhein – ein Überblick, in: Kunst+Architektur in der Schweiz 1996/2, S. 115–124.
19 Vgl. auch Martin BUNDI, Laax (Herrschaft), in: Historisches Lexikon der Schweiz (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13126.php; [Zugriff 12.11.2018]); Werner MEYER, Neu-Habsburg, in: Historisches Lexikon der Schweiz: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D11165.php [Zugriff 12.11.2018]; Gilbert Charles MEYER/Christian WILSDORF, Le château de Hohlandsberg près de Colmar, in: Kunst+Architektur in der Schweiz 1996/2, S. 125–136; Nicolas MENGUS/Jean-Michel RUDRAUF, Châteaux forts et fortifications médiévales d’Alsace. Dictionnaire d’histoire et d’architecture, Strassbourg 2013, S. 139−141. Zur schlecht belegten Limburg (Kaiserstuhl) vgl: Alfons ZETTLER/Thomas ZOTZ, Die Burgen im mittelalterlichen Breisgau. Nördlicher Teil Bd. I, Ostfildern 2006, S. 378–390.
20 Vgl. Bernhard STETTLER, Die sog. Klingenberger Chronik des Eberhard Wüst, Stadtschreiber von Rapperswil (Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte 53), St. Gallen 2007, S. 77f.; vgl. Erich KLEINSCHMIDT, Herrscherdarstellung. Zur Disposition mittelalterlichen Aussageverhaltens, untersucht an Texten über Rudolf I. von Habsburg, Bern/München 1974, hier S. 269–277; Dieter MERTENS, Geschichte und Dynastie. Zu Methode und Ziel der Fürstlichen Chronik Jakob Mennels, in: Historiographie am Oberrhein im späten Mittelalter, hg. von Kurt ANDERMANN (Oberrheinische Studien 7), Sigmaringen 1988, S. 121–153, hier S. 138–141; MEYER, Burg (wie Anm. 17), S. 173.
21 Peter FREY, Die Habsburg im Aargau, in: Burgen der Salierzeit Bd. 2, hg. von Horst Wolfgang BÖHME (Römisch-Germanisches Nationalmuseum. Monographien 26), Sigmaringen 1991, S. 331–350; Peter FREY, Die Habsburg. Berichte über die Ausgrabungen von 1994/95, in: Argovia 109, 1997, S. 123–175.
22 Acta Murensia. Die Akten des Klosters Muri mit der Genealogie der frühen Habsburger. Edition, Übersetzung, Kommentar, Digitalfaksimile nach der Handschrift StAAG AA/4947, bearb. von Charlotte BRETSCHER-GISIGER/Christian SIEBER, Basel 2012, S. CXXV.
23 Dazu und zum Folgenden vgl. Anm. 21.
24 Vgl. dazu und zum Folgenden: Thomas M. MARTIN, Die Städtepolitik Rudolfs von Habsburg (Veröffentlichungen des Max Planck-Instituts für Geschichte 44), Göttingen 1976; Jürgen TREFFEISEN, Die Habsburger und ihre breisgauischen Städte im späten Mittelalter, in: Die Habsburger im deutschen Südwesten, hg. von Franz QUARTHAL/Gerhard FAIX, Stuttgart 2000, S. 115–136; Martina STERCKEN, Städte der Herrschaft. Kleinstadtgenese im habsburgischen Herrschaftsraum des 13. und 14. Jahrhunderts (Städteforschung A 68), Köln/Weimar/Wien 2006.
25 STERCKEN, Städte der Herrschaft (wie Anm. 24), S. 7–9; Martina STERCKEN, Stadtzerstörungen durch die Herrschaft und infolge städtischer Konfliktsituationen im 13. und 14. Jahrhundert. Beispiele aus den habsburgischen Herrschaftsräumen im Gebiet der heutigen Schweiz, in: Zerstörung und Wiederaufbau Bd. 2, hg. von Martin KÖRNER (Veröffentlichungen der Commission Internationale pour l‘Histoire des Villes), Bern 2000, S. 53–76.
26 Dazu und zum Folgenden vgl. STERCKEN, Städte der Herrschaft (wie Anm. 24), S. 6–19.
27 Vgl. STERCKEN, Städte der Herrschaft (wie Anm. 24), S. 96–161; STERCKEN, Herrschaftsinstrument (wie Anm. 5), passim.
28 Vgl. dazu: Hagen KELLER, Schriftgebrauch und Symbolhandeln in der öffentlichen Kommunikation. Aspekte des gesellschaftlich-kulturellen Wandels vom 5. bis zum 13. Jahrhundert, in: Frühmittelalterliche Studien 37, 2003, S. 1–24; Hagen KELLER, Mündlichkeit – Schriftlichkeit – symbolische Interaktion. Mediale Aspekte der Öffentlichkeit im Mittelalter, in: Frühmittelalterliche Studien 38, 2004, S. 277–286; Roger SABLONIER, Schriftlichkeit, Adelsbesitz und adeliges Handeln im 13. Jahrhundert, in: Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa, hg. von Otto Gerhard OEXLE/Werner PARAVICINI, Göttingen 1997, S. 67–100; Thomas HILDBRAND, Der Tanz um die Schrift. Zur Grundlegung einer Typologie des Umgangs mit Schrift, in: Wirtschaft und Herrschaft. Beiträge zur ländlichen Gesellschaft in der östlichen Schweiz (1200–1800), hg. von Roger SABLONIER/Thomas MEIER, Zürich 1999, S. 439–460; Simon TEUSCHER, Erzähltes Recht. Lokale Herrschaft, Verschriftlichung und Traditionsbildung im Spätmittelalter (Campus Historische Studien 44), Frankfurt/Main 2007; Elisabeth GRUBER/Christina LUTTER, Oliver Jens SCHMITT, Kulturgeschichte der Überlieferung im Mittelalter. Quellen und Methoden zur Geschichte Mittel- und Südosteuropas, Köln/Weimar/Wien 2017.
29 Dies wird etwa deutlich in den Regesta Habsburgica. Regesten der Grafen von Habsburg und der Herzoge von Österreich aus dem Hause Habsburg, hg. von Oswald REDLICH, Bd. 1, bearb. von Harold STEINACKER (Publikationen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung), Innsbruck 1905. Hier bauen alle Angaben zur Frühgeschichte habsburgischer Herrschaft auf den Acta auf; vgl. S. 1–10, S. 15, Nr. 48–51, S. 17f., Nr. 64–66.
30 Vgl. Regesta Habsburgica I (wie Anm. 29), S. 13, Nr. 33–36, S. 16, Nr. 54, 55, S. 17, Nr. 57, 61f., S. 19, vgl. auch Nr. 72, S. 25, Nr. 90, S. 29, Nr. 103, Nr. 104, S. 31, Nr. 111, Nr. 112.
31 Regesta Habsburgica I (wie Anm. 29), S. 24, Nr. 84f.
32 Regesta Habsburgica I (wie Anm. 29), S. 29, Nr. 99; S. 54f. Nr. 221f., vgl. auch S. 57, Nr. 238; S. 64, Nr. 267.
33 Regesta Habsburgica I (wie Anm. 29), S. 14f., Nr. 44f.; S. 20f., Nr. 75; S. 21, Nr. 77; S. 21f., Nr. 78; S. 25, Nr. 88.
34 Vgl. z.B. Regesta Habsburgica I (wie Anm. 29), S. 13, Nr. 39; S. 14, Nr. 42, 43; S. 15, Nr. 45; S. 16f., Nr. 56; S. 17, Nr. 58, Nr. 59; S. 20, Nr. 74; S. 21, Nr. 76; S. 22, Nr. 80; S. 23, Nr. 81; S. 24f., Nr. 86; S. 25f., Nr. 93; S. 26f., Nr. 94, 95, 97; S. 30f. Nr. 110.
35 Archives de l‘ancien Evêché de Bâle 1238/1239; Regesta Habsburgica I (wie Anm. 29), S. 42, Nr. 171; Fontes Rerum Bernensium, Bd. 2, Bern 1877, Nr. 172, S. 181–183; REDLICH, Rudolf von Habsburg (wie Anm. 1), S. 78f.; vgl. Bruno MEYER, Studien zum habsburgischen Hausrecht, in: Zeitschrift für Schweizerische Geschichte 27, 1947, S. 38–60, hier S. 45f.; Bruno MEYER, Habsburg und Habsburg-Laufenburg. Zeitschrift für Schweizerische Geschichte 28, 1948, S. 310–343.
36 Vgl. dazu und zum Folgenden: Eduard STUDER, Sprachliche Stationen auf dem Weg zum Deutsch der Schilling Chronik, in: Die Schweizer Bilderchronik des Luzerners Diepold Schilling 1513, Sonderausgabe des Kommentarbandes zum Faksimile der Handschrift S. 23 fol. in der Zentralbibliothek Luzern, Luzern 1981, S. 585–601, hier S. 591f.; Ruth SCHMIDT-WIEGAND, Urkundensprache, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte Bd. 5, Berlin 1998, Sp. 593–602; zuletzt GRUBER/LUTTER/SCHMITT, Kulturgeschichte (wie Anm. 28), S. 166.
37 Regesta Habsburgica I (wie Anm. 29), insbesondere beginnend mit S. 49, Nr. 197; Habsburgerinnen vgl. z.B. S. 62, Nr. 261–263; S. 64, Nr. 266.
38 Vgl. Regesta Habsburgica I (wie Anm. 29), vor allem ab S. 50, Nr. 202.
39 Das Habsburgische Urbar, Bd. 2: Ältere habsburgische Aufzeichnungen, bearb. von Rudolf MAAG (Quellen zur Schweizer Geschichte 15/2), Basel 1899, S. 47–229; Götz LANDWEHR, Mobilisierung und Konsolidierung der Herrschaftsordnung im 14. Jahrhundert, in: Der deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert, Bd. 2, hg. von Hans PATZE (Vorträge und Forschungen 14), Sigmaringen 1971, S. 484–505.
40 Das Habsburgische Urbar, Bd 1: Das eigentliche Urbar über die Einkünfte, bearb. von Rudolf MAAG (Quellen zur Schweizer Geschichte 14/1), Basel 1894; Marianne BÄRTSCHI, Das Habsburger Urbar: Vom Urbarrödel zum Traditionscodex, Phil. Diss. Zürich 2008; STERCKEN, Städte der Herrschaft (wie Anm. 24), insbesondere S. 77–80.
41 Karl SCHMID, Geblüt – Herrschaft – Geschlechterbewusstsein. Grundfragen zum Verständnis des Adels im Mittelalter, hg. von Dieter MERTENS/Thomas ZOTZ (Vorträge und Forschungen 44), Sigmaringen 1998, insbesondere S. 50–158; MERTENS, Geschichte und Dynastie (wie Anm. 20); Steffen KRIEB, Erinnerungskultur und adeliges Selbstverständnis im Spätmittelalter, in: Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 60, 2001, S. 59–75; Klaus GRAF, Ursprung und Herkommen. Funktionen vormoderner Gründungserzählungen, in: Geschichtsbilder und Gründungsmythen, hg. von Hans-Joachim GEHRKE (Identitäten und Alteritäten 7), Würzburg 2001, S. 23–36; Hans VORLÄNDER, Gründung und Geltung. Die Konstitution der Ordnung und die Legitimität der Konstitution, in: Geltungsgeschichten. Über die Stabilisierung und Legitimierung institutioneller Ordnungen, hg. von Gert MELVILLE/Hans VORLÄNDER Köln/Weimar/Wien 2002, S. 243–264; Hans-Werner GOETZ, Geschichtsschreibung und Geschichtsbewusstsein im hohen Mittelalter (Orbis mediaevalis. Vorstellungswelten des Mittelalters 1), 2. Aufl. Berlin 2008; BRETSCHER-GISIGER/SIEBER, Acta Murensia (wie Anm. 22), S. CXXV; Gert MELVILLE, Zur Technik genealogischer Konstruktionen, in: Idoneität – Genealogie – Legitimation. Begründung und Akzeptanz von dynastischer Herrschaft im Mittelalter, hg. von Cristina ANDENNA/Gert MELVILLE, Köln/Weimar/Wien 2015, S. 293–304; SCHÖLLER, Zeiten der Erinnerung (wie Anm. 8), S. 128–131; vgl. auch: Alexander KAGERER, Macht und Medien um 1500. Selbstinszenierungen und Legitimationsstrategien von Habsburgern und Fuggern (Deutsche Literatur. Studien und Quellen 23), Berlin/Boston 2017, S. 215–266.
42 BRETSCHER-GISIGER/SIEBER, Acta Murensia (wie Anm. 22); KRIEGER, Rudolf von Habsburg (wie Anm. 1), S. 32–37.
43 BRETSCHER-GISIGER/SIEBER, Acta Murensia (wie Anm. 22); S. CXXV; SCHMID, Geblüt (wie Anm. 41), S. 117f.; vgl. dazu zuletzt DENDORFER, Gescheiterte Memoria? (wie Anm. 7), S. 24f.
44 Dazu und zum Folgenden vgl.: SCHÖLLER, Zeiten der Erinnerung (wie Anm. 8), S. 70–72; Martina STERCKEN, Herrschaftswechsel und Friedensordnung. Die landsässigen Akteure 1415, in: Eroberung und Inbesitznahme. Die Eroberung des Aargaus 1415 im europäischen Vergleich, hg. von Christian HESSE/Regula SCHMID/Roland GERBER, Ostfildern 2017, S. 127–142, hier S. 137f.
45 Vgl. auch Abb. 2, die im Titel die Gründung durch Radbot und Ita erwähnt. Der abgebildete Posaunenengel verweist offenbar auf die Skulptur, die das Dach des neu gebauten Zentralbaus bekrönt.
46 KLEINSCHMIDT, Herrscherdarstellung (wie Anm. 20), S. 269–277; BRETSCHER-GISIGER/SIEBER, Acta Murensia (wie Anm. 22), S. XLI–XLIX; SCHÖLLER, Zeiten der Erinnerung (wie Anm. 8), S. 37–41; KAGERER, Macht und Medien (wie Anm. 41), S. 215–266.
47 Vgl. dazu: Oswald REDLICH, Rudolf von Habsburg in der volkstümlichen Überlieferung, Sonderdruck aus dem Jahrbuch des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich 17, 1918, S. 1–11; Willi TREICHLER, Mittelalterliche Erzählungen und Anekdoten um Rudolf von Habsburg, Bern 1971; Thomas M. MARTIN, Das Bild Rudolfs von Habsburg als „Bürgerkönig“ in Chronistik, Dichtung und moderner Historiographie, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 112, 1976, S. 203–228; Ulrike KUNZE, Rudolf von Habsburg. Königliche Landfriedenspolitik im Spiegel zeitgenössischer Chronistik, Frankfurt a. M. 2001; KRIEGER, Rudolf (wie Anm. 1), S. 3–5, S. 177/181.
48 Vgl. Literatur in Anm. 47; KLEINSCHMIDT, Herrscherdarstellung (wie Anm. 20), S. 278–288.
49 Charlotte BRETSCHER-GISIGER/Rudolf GAMPER, Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Klöster Muri und Hermetschwil, Dietikon/Zürich 2005, S. 163–166: Sarnen, Benediktinerkollegium, Cod. membr. 10: 9rb–9vb Conradus de Mure: Commendaticia Rudolfi regis; 9vb–9vc Conradus de Mure (?): Carmen coronationis Rudolfi regis; 9vc Versus in laudem Rudolfi regis. Zur zitierten Textstelle vgl. KLEINSCHMIDT, Herrscherdarstellung (wie Anm. 20), S. 291–312, insbes. S. 300, S. 302f.
50 Leta sit et iubilet felix Alemannia tali/Fato tam miro, tam magno, tam speciali./Eximium sidus, radiosa luce subortum/Genti naufragium pacienti vult dare portum. Vgl. die Edition bei KLEINSCHMIDT, Herrscherdarstellung (wie Anm. 20), S. 303.