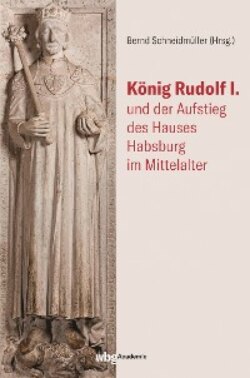Читать книгу König Rudolf I. und der Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter - Группа авторов - Страница 9
BERND SCHNEIDMÜLLER Rudolf von Habsburg
Geschichten vom Regieren im Reich und vom Sterben in Speyer1
Оглавление„Graf Rudolf von Habsburg aus dem Geschlecht des Herzogs von Zähringen war im Jahr 1218 … an den Kalenden des Mai geboren, im selben Jahr also, in dem der Herzog von Zähringen den Weg allen Fleisches ging. Er war ein Mann von großer Gestalt, sieben Fuß lang, schlank, mit kleinem Kopf, bleichem Gesicht und langer Nase; er hatte wenig Haare, lange und schmale Hände und Füße. In Speise und Trank wie in anderen Dingen war er mäßig, ein weiser und umsichtiger Mann, doch selbst bei den reichsten Mitteln stets in größter Geldverlegenheit. Er hatte viele Söhne und Töchter, welche er alle zu großen Reichtümern und Ehren erhob. In Thüringen soll er im Laufe eines Jahres Hundertsechzigtausend ausgegeben haben; zweimal hat er Besançon belagert und das gallische Land schwer verwüstet.“2
Die Chronik von Colmar nennt den 1. Mai 1218 als Geburtsjahr König Rudolfs von Habsburg3, Spross bedeutender gräflicher Vorfahren im Südwesten des deutschen Reichs, und gibt eine knappe Personenbeschreibung. Im gleichen Jahr 1218 starben die Zähringer als die beherrschende Dynastie des deutschen Südwestens mit Herzog Bertold V. im Mannesstamm aus und machten den Weg frei für eine herrschaftliche Neuordnung am Ober- und am Hochrhein. Im Oktober 1273 erhoben die Wahlfürsten des Heiligen Römischen Reichs den Grafen Rudolf zum römisch-deutschen König.4 Am 15. Juli 1291 starb er in Speyer und wurde einen Tag später in der Herrschergrablege des Doms bestattet.5 In der westlichen Gräberreihe nimmt Rudolf den prominenten Mittelplatz ein.6 Heutige Besucher sehen ihn im Zentrum des Gräberfelds, direkt vor Kaiser Konrad II. als dem ersten Stifter des Doms. Für ein Gedenken an Rudolfs 800. Geburtstag ist der Dom zu Speyer der richtige Ort seiner Memoria, nahe den sterblichen Überresten des Königs.
Nach turbulenten Jahrzehnten sorgte Rudolf für eine Reorganisation der Monarchie.7 Seine Nachfahren prägten als Fürsten, Könige und Kaiser die Geschichte Europas und der ganzen Welt mit.8 Hier im Speyerer Dom läutete Rudolf eine zweite Welle königlicher Beisetzungen ein. Nach den salischen und staufischen Vorgängern fanden 1309 noch die beiden Nachfolger Rudolfs ihre letzte Ruhe im Dom, König Adolf von Nassau (1292–1298) und Rudolfs Sohn König Albrecht I. (1298–1308).9 Deshalb steht Speyer am Beginn der Erinnerungsgeschichte habsburgischer Könige und Kaiser.
800 Jahre nach Rudolfs Geburtstag ist das ein guter Grund für eine historische Rückbesinnung, auch wenn die große Kaisergeschichte der Habsburger vor einem Jahrhundert in einer Zeit der abnehmenden Monarchien Europas zu Ende ging. Wie schon in der Speyerer Fachtagung 2018 zielt dieser Band nicht auf Heldenverehrung. Wir sind vielmehr einer besonderen mittelalterlichen Aufsteigergeschichte auf der Spur, mit all ihren Zufällen, Sprüngen, Rückschlägen und Varianten. Große Männer und Frauen werden hier in die Bedingungen ihrer Zeit eingefügt, als Produkt von Geschichte, als Gestalter oder als Opfer von Geschichte.
In diesem Beitrag geht es nicht um eine ganze Dynastie, nicht um ihre Siege und Niederlagen, nicht um Schwerpunktverlagerungen oder um lange Verbindungen zwischen Speyer und den Habsburgern. Hier geht es um einen einzigen Mann, um König Rudolf. Zu seinem 800. Geburtstag loten wir aufs Neue seine historische Bedeutung aus. Dabei lösen wir – wie unsere historischen Quellen – Geschichte in Geschichten auf. Rudolfs Image wird auf zweierlei Weise geformt, von seiner berühmten Speyerer Bildplatte und von einer Fülle von Geschichten. Die einzigartige Skulptur steht heute beim Eingang in die Speyerer Kaisergruft. Sie präsentiert geradezu suggestiv das Bild eines mittelalterlichen Herrschers. Wie frühere Forschergenerationen denken wir immer noch darüber nach, ob die mittlerweile erheblich restaurierte und geschönte Personendarstellung einst als Deckel des königlichen Sargs diente oder als bloßes Erinnerungsbild im Johanniterhof aufgestellt wurde.10
Dieser Aufsatz rückt die mittelalterlichen Geschichten um Rudolf ins Zentrum, die Anekdoten, die Schwänke, die Lobpreisungen, die Scheltworte. Zeitgenossen und Nachgeborene erzählten von manchen alten Herrschern allerlei Einprägsames oder Wunderliches. Doch Rudolfs Image erwuchs in besonderem Maß aus solchen Facetien – ich benutze hier bewusst das altertümliche Wort als Sammelbezeichnung für das, was wir heute eher als ‚stories‘ bezeichnen würden. Die narrative Lust des Spätmittelalters fand in der historischen Forschung große Aufmerksamkeit.11 Willi Treichler trug die ‚Erzählungen und Anekdoten um Rudolf von Habsburg‘ in 53 Nummern zusammen, gegliedert nach dem frommen König, dem kriegerischen König und dem Alltagskönig. Treichlers erster Satz aus dem Jahr 1971 ist jetzt allerdings nicht mehr aktuell: „Die Erzählungen um Rudolf von Habsburg gehören heute noch zum überkommenen Bildungsgut aller Schichten und sind deshalb in den meisten Schulbüchern vertreten.“12
Solches Erinnerungswissen ist bei den Jüngeren längst nicht mehr vorhanden. Deshalb lohnt sich die Neuentdeckung der alten Facetien und ihrer Nachahmer in der deutschen Lyrik der Neuzeit. Annette Kehnel schrieb dazu bereits einen wesentlichen quellenkritischen Aufsatz und arbeitete die Freude dominikanischer und franziskanischer Mönche an Beispielen und Denkwürdigkeiten heraus.13 Vor 100 Jahren hielt Oswald Redlich (1858–1944), der große Biograph Rudolfs von Habsburg, einen Festvortrag zum 700. Geburtstag Rudolfs von Habsburg. Dieser Text hat mich, der ich auf den wissenschaftlichen Leistungen anderer aufbaue, besonders berührt. Am 27. April 1918 handelte Oswald Redlich nämlich über ‚Rudolf von Habsburg in der volkstümlichen Überlieferung‘.14 Im Abstand von 100 Jahren klingen unsere Fragestellungen zwar ähnlich. Aber das historische Interesse hat sich mittlerweile gravierend gewandelt.
Redlich sprach 1918 in der krisenhaften Anfechtung, denen das Kaiserreich Österreich-Ungarn am Ende des Ersten Weltkriegs ausgesetzt war. Ein halbes Jahr vor dem Untergang der habsburgischen Monarchie beschwor Oswald Redlich die Bürgernähe und Leutseligkeit des Dynastiegründers Rudolf von Habsburg. Der König war sich nach Ausweis der mittelalterlichen Quellen in der Tat nicht zu fein, den beißenden Spott einer Mainzer Bäckersfrau auf seine grausame Soldateska zu ertragen,15 nicht zu fein, kaufmännische Ratschläge für profitablen Handel zu erteilen,16 nicht zu fein, Reklame für das gute Bier eines Erfurter Bürgers zu machen.17 So etwas hätte man über Otto den Großen oder Friedrich Barbarossa nicht erzählen können.18
Die Zeit war weitergegangen. Selbst Heldentode kamen damals aus der Mode. Rudolf schonte das Leben seiner Krieger bei aussichtslosen Burgbelagerungen19 und legte bei drei gleichzeitigen Fehden erst einmal zwei bei,20 um nicht im Heldenmut eines Vielfrontenkampfs unterzugehen. Mit Rudolf begann vielmehr die kluge Heiratspolitik der Habsburger, die später zum weisen Satz gerann: „Andere mögen Kriege führen, du, glückliches Österreich, heirate“ (Bella gerant alii, tu felix Austria nube).21 Zuvor hätte ein solches Image nicht zum Ideal des draufgängerischen, strahlenden Ritterkönigs gepasst, so wie wir ihn 2017/18 in der Speyerer Ausstellung über Richard Löwenherz erlebten.22
1918 nannte Redlich die gleichen Facetien, die uns bis heute erfreuen. Doch anders als wir sprach er über „Gedenktage, die eigentlich tiefernst wirken, da wir sie mitten in einem Kampfe begehen, in dem es sich um den Bestand und die Zukunft des von den Habsburgern geschaffenen mächtigen Staatengebildes handelt.“ Redlichs Rudolf diente dem Durchhaltewillen eines untergehenden Imperiums und als Vorbild für Kaiser Karl I. (1916–1918), den letzten Herrscher der kaiserlichköniglichen Doppelmonarchie. Schon vor 100 Jahren jammerte Redlich, dass der Schulunterricht, „bedrängt von der Fülle des Stoffes und von den Anforderungen der Gegenwart […] leider gerade das Mittelalter“ opfere.23 Dabei entdeckte er Rudolfs Aufstieg „als eine wunderbare göttliche Fügung“: „hier setzt nun eine förmliche Sagenbildung ein. Rudolf von Habsburg, den die göttliche Vorsehung als ihr Werkzeug auserkoren, war von der Vorsehung selber schon geheimnisvoll vorbereitet worden auf seine künftige Sendung.“24 Als „deutscher Österreicher“ formulierte Redlich am Ende diese Bilanz von Rudolfs Herrscherleistung: „Was Rudolf von Habsburg mit dem Schwerte und mit meisterhafter Staatskunst geschaffen, das wollen wir auch heute, da außen und innen der Sturm tobt, mit dem Schwerte und in Treue wahren und verteidigen.“25
Die Menschen Mitteleuropas mussten im 20. Jahrhundert noch manche schreckliche Vorsehung über sich ergehen lassen. Das Wissen um frühere historische Instrumentalisierungen des Mittelalters macht uns nicht überheblich gegenüber den Fehlprognosen unserer Vorgänger, eher bescheiden und selbstironisch, aber auch ein wenig glücklich, dass wir Rudolfs 800. Geburtstag in einem Dom bedenken dürfen, in dem heute programmatisch die Idee des Friedens in Europa bewahrt wird.26
Wir lesen die Facetien also anders und wieder neu. Lassen wir uns von der mittelalterlichen Lust am Erzählen übermannen, ohne die wissenschaftliche Strukturierung aus den Augen zu verlieren. Das Changieren zwischen Geschichte und Geschichten will diesen Beitrag prägen.
Auf nach Speyer
Einen Monat nach Rudolfs Tod schrieb der päpstliche Kaplan Theodericus von Orvieto am 15. August 1291 einen Brief an Kardinalbischof Gerardus Blancus. Berichtet wird von der tödlichen Krankheit des Königs und seiner letzten Reise von Germersheim nach Speyer auf dem Rhein. Vergeblich hätte man gehofft, die bessere Luft in Speyer würde dem Herrscher bekommen. Nach seinem Tod seien Unruhen ausgebrochen.27 In seiner Dissertation über die Tode der römisch-deutschen Könige vergleicht Manuel Kamenzin28 diesen nüchternen Bericht mit den bekannteren Notizen deutscher Chronisten. Die zeitnahe Ellenhard-Chronik sah in Rudolfs letztem Reiseziel Speyer keinen Luftkurort, sondern programmatisch diejenige Stätte, an der seit alters die Könige der Römer bestattet wurden. Wegen dieser traditionsreichen Herrschergrablege sei der Habsburger nach Speyer gereist, um an der Seite seiner kaiserlichen und königlichen Vorgänger begraben zu werden.29 Im Rückblick erscheint Rudolfs Herrschaft als beispielhafte Friedenszeit: „In der Lebens- und Herrschaftszeit dieses Herrn Rudolf seligen Angedenkens herrschte ein so großer Frieden in allen Teilen Deutschlands […], dass ein solcher Friede in diesem Land niemals bestand oder gesehen wurde.“ Dagegen folgten dem Sterben des Königs – ganz in mittelalterlicher Zeichenhaftigkeit – Himmelserscheinungen und Erschütterungen menschlicher Ordnung: „Gebrochen und zerstört wurde der allgemeine Friede im ganzen Königreich Deutschland, und in solcher Weise bestand kein Friede mehr in diesem Land.“30
Ottokars Reimchronik spitzte (zwei Jahrzehnte später) Rudolfs letzte Reise zum berühmten Todesritt nach Speyer zu (hinz Spîre). Nachdem ihm beim Schachspiel der nahende Tod eröffnet worden sei, brach er sogleich auf, zu „den Vorfahren, die auch Könige waren“. Seinen Ritt nach Speyer säumten Menschen an den Straßen, damit sie ihn sahen und er sie sah (daz er si sach und si in). Versehen mit den Sterbesakramenten starb Rudolf schließlich einen guten Tod. Der Erzengel Michael, so hoffte der Reimchronist, sollte ihn in die Schar der Engel führen.31
Für das mittelalterliche Bildverständnis bedeutsam sind die Verse über die Kunstfertigkeit jenes klugen Steinmetzen, der Rudolfs Grabbild schuf. Niemals sei ein Bild so lebensnah gewesen wie der Speyerer Stein. Ganz genau und immer wieder hätte der Meister den König betrachtet. Die Runzeln in dessen Antlitz und die Gebrechen des Alters seien im Epitaphium festgehalten. Als der Meister von einer neuen Runzel hörte, sei er zur Prüfung des veränderten königlichen Gesichts sogar bis ins Elsass gelaufen. Nach Speyer zurückgekehrt, „warf er das Bild nieder und machte es Rudolf dem reichen König wieder ähnlich. Der Stein wurde nun sein Dach (der stein wart nû sîn dach).“32
Jahrhunderte später brachte Justinus Kerner „Kaiser Rudolfs Ritt zum Grabe“ in bekannte Verse:
Auf der Burg zu Germersheim,
Stark am Geist, am Leibe schwach,
Sitzt der greise Kaiser Rudolf,
Spielend das gewohnte Schach.
Und er spricht: „Ihr guten Meister!
Ärzte! sagt mir ohne Zagen:
Wann aus dem zerbrochnen Leib
Wird der Geist zu Gott getragen?“
Und die Meister sprechen: „Herr,
Wohl noch heut erscheint die Stunde.“
Freundlich lächelnd spricht der Greis:
„Meister! Dank für diese Kunde!“
„Auf nach Speyer! auf nach Speyer!“
Ruft er, als das Spiel geendet;
„Wo so mancher deutsche Held
Liegt begraben, sei‘s vollendet!
Abb. 1: Epitaph König Rudolfs im Speyerer Dom, Ausschnitt (Kopf und Brust)
Blast die Hörner! bringt das Roß,
Das mich oft zur Schlacht getragen!“
Zaudernd stehn die Diener all,
Doch er ruft: „Folgt ohne Zagen!“
Und das Schlachtroß wird gebracht.
„Nicht zum Kampf, zum ew’gen Frieden“,
Spricht er, „trage, treuer Freund,
jetzt den Herrn, den Lebensmüden!“
Weinend steht der Diener Schar,
Als der Greis auf hohem Rosse,
Rechts und links ein Kapellan,
Zieht, halb Leich’, aus seinem Schlosse.
Trauernd neigt des Schlosses Lind’
Vor ihm ihre Äste nieder,
Vögel, die in ihrer Hut,
Singen wehmutsvolle Lieder.
Mancher eilt des Wegs daher,
Der gehört die bange Sage,
Sieht des Helden sterbend Bild
Und bricht aus in laute Klage.
Aber nur von Himmelslust
Spricht der Greis mit jenen zweien,
Lächelnd blickt sein Angesicht,
Als ritt’ er zur Lust in Maien.
Von dem hohen Dom zu Speyer
Hört man dumpf die Glocken schallen.
Ritter, Bürger, zarte Frau’n
Weinend ihm entgegenwallen.
In den hohen Kaisersaal
Ist er rasch noch eingetreten;
Sitzend dort auf goldnem Stuhl,
Hört man für das Volk ihn beten.
„Reichet mir den heil’gen Leib!“
Spricht er dann mit bleichem Munde,
Drauf verjüngt sich sein Gesicht
Um die mitternächt’ge Stunde.
Da auf einmal wird der Saal
Hell von überird’schem Lichte,
Und entschlummert sitzt der Held,
Himmelsruh’ im Angesichte.
Glocken dürfen’s nicht verkünden,
Boten nicht zur Leiche bieten,
Alle Herzen längs des Rheins
Fühlen, daß der Held verschieden.
Nach dem Dome strömt das Volk
Schwarz unzähligen Gewimmels.
Der empfing des Helden Leib,
Seinen Geist der Dom des Himmels.“33
Der neuzeitliche Dichter fand die Basis seiner Geschichte und den königlichen Ausruf „Auf nach Speyer“ auch in der Chronik des Mathias von Neuenburg († nach 1364): „Als der König altersschwach wurde und die Ärzte ihm sagten, dass er nur noch wenige Tage leben könnte, sprach er: ‚Wohlauf gen Speyer zu den übrigen dort begrabenen Königen!‘ (Eamus ergo Spiram ad alios reges sepultos!). Und während er sich in Germersheim bei Speyer aufhielt, starb er daselbst [nicht korrekt: Rudolf starb in Speyer]. Er wurde zu Speyer mit allen Ehren im königlichen Grab bestattet, im achtzehnten Jahr seiner Regierung, im Jahre des Herrn 1291 am 30. September. Sein Grabstein trägt folgende Inschrift: ‚Im Jahr des Herrn 1291 am 30. September [Datum ist falsch] starb der römische König Rudolf von Habsburg‘.“34
Geschichte aus Geschichten
Der Vergleich des nüchternen Briefs eines italienischen Geistlichen mit der Erinnerungsstiftung in der lateinischen Chronik aus dem Elsass und der volkssprachlichen Reimchronik aus der Steiermark steckt unterschiedliche Erinnerungspotenziale und narrative Entfaltungen ab. Zur Geschichtsschreibung gehörten von Anfang an das Erzählen und das Werten, die Lust am Detail und die Ordnung der großen Dinge. Die modernen Kognitionswissenschaften machen uns Historikerinnen und Historikern heute die unterschiedlichen Fähigkeiten des episodischen und des strukturierenden Gedächtnisses deutlich. Geschichten stabilisieren sich in ihrer Wiederholung, werden im Gehirn wieder neu gespeichert, verändern sich unmerklich mit der Zeit, halten Früheres lebendig und entfalten es weiter.35 Testen Sie es nach der Lektüre dieses Beitrags an sich selbst. Vielleicht werden Sie sich Rudolfs Todesritt nach Speyer besser merken als seine Schiffsreise auf dem Rhein, auch wenn diese quellenkritisch vielleicht höheren Wert besitzen mag. Und Kerners Verse „Alle Herzen längs des Rhein/Fühlen, daß der Held verschieden.“ bleiben in ihrem Rhythmus allemal eingängiger als das Todesdatum 15. Juli 1291.
Die Geschichtswissenschaft nahm die Facetien der Dominikaner oder Franziskaner, der Reimdichter und der Spielleute gerne auf. Manchmal erzählen sogar Historiker gerne, insbesondere dann, wenn sie etwas von ihrer Wissenschaft an die Menschen weitergeben wollen. Doch in den gelehrten Köpfen blieb auch stets eine Sperre gegen die Auflösung von Geschichte in Geschichten. Als ich die vielen klugen Veröffentlichungen über den Wandel der Geschichtsschreibung vom Hoch- zum Spätmittelalter las, über veränderte Erzählstrategien, über die Bewältigung komplexer Wirklichkeiten, da stieß ich auf den Grundton einer Verfallsgeschichte. Die gelehrte Geschichtswissenschaft hat sich von den großen Ordnungsmodellen, den welterfassenden Theorien und den Komplexitätsreduktionen so sehr trainieren lassen, dass ihr die Runzel im Antlitz des Königs wie eine Mücke im Urwald erscheint.
Seit 1100 hatten Chronisten beherzt die ganze Weltgeschichte in Büchern gebändigt.36 Sie orientierten sich an biblischen Entwürfen der ganz großen Menschheitsgeschichte. Nach mittelalterlichen Vorstellungen folgte diese den sechs Schöpfungstagen Gottes oder der Abfolge von vier Weltreichen. Otto von Freising schrieb im 12. Jahrhundert die Weltgeschichte von der Schöpfung bis in die Zukunft der Menschheit in der ewigen Sabbatruhe weiter. Joachim von Fiore ließ um 1200 die drei Zeitalter des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in der Geschichte erstehen.37 Das Geschichtsverständnis der großen Buchreligionen, der Juden, der Christen wie der Muslime, war von linearen Entwicklungen bestimmt.38 Ihnen bleibt Weltgeschichte Heilsgeschehen,39 auf dem Weg in eine erträumte Zukunft mit Gott. Ganze Ateliers von Chronographen sammelten und ordneten im 13. Jahrhundert die Vielfalt der Dinge zu enzyklopädischem Wissen.40 Geschichte wurde ihnen zur Lehrmeisterin des Lebens, zum Schlüssel für das Verständnis vom Handeln Gottes an den Menschen. Vincenz von Beauvais baute ein riesiges Speculum historiale zusammen, in dem er der Geschichte eine Richtung und eine Ordnung gab.41 An solchen Großentwürfen arbeiteten sich moderne Theoretiker der Vergangenheit voller Hochachtung ab.
Und dann kam der angebliche Absturz ins Spätmittelalter! Geschichtsschreiber schienen seit dem 13. Jahrhundert ohne klare Strukturen, ohne Fokussierungen auf die großen Dinge, ohne Richtungen auszukommen.42 Gewiss durchzog religiöse Fundierung auch die Texte des 14. und 15. Jahrhunderts. Und gewiss gab es immer noch die großen, richtungsweisenden Geschichtsentwürfe.43 Aber daneben nisteten sich die Facetien ein, erzählt von einer bunteren Schar von Autorinnen und Autoren, die sich nicht mehr dem Korsett einer geschichtsschreibenden Leitkultur beugten. Jetzt wurde Institutionalität aus Beispielen entworfen.
Überhaupt die Beispiele, die exempla! Dominikaner und Franziskaner nutzten sie in ihren Predigten nicht allein zur Erbauung der Gläubigen. Sie setzten sogar ihre Großmodelle aus Facetien zusammen und sparten dafür an gelehrter Strukturierung.44 Thomas von Cantimpré, das zeigt jetzt Julia Burkhardt, konnte das klösterliche Gefüge von Vorstehern und Untergebenen aus Beispielen entwerfen und es in Vergleichen mit der Bienengemeinschaft aus der Natur begründen.45 Die heute aktuelle Frage, wie eigentlich Kollektive entscheiden, ließ sich im 13. Jahrhundert durch die Rezeption der griechischen Philosophie ebenso beantworten wie durch die Aneinanderreihung pittoresker Geschichten. Nicht nur das Gedächtnis, sondern auch die Phantasie entfaltet sich episodisch oder strukturell.
Diesen mittelalterlichen „stream of consciousness“ will ich mit einem Zitat aus der Geschichtsschreibung der Colmarer Dominikaner zum Jahr 1278 erläutern. Hier ging es auch um den Sieg König Rudolfs über König Ottokar II. von Böhmen, der später den Habsburgern den Besitz Österreichs sicherte. Aber eben nicht nur! Man könnte sich endlos an aneinandergereihten Episoden vermischten Inhalts erfreuen. Sie werden das Miteinander von großer oder kleiner Vielfalt schon aus dieser einen Textpassage entdecken:
„Ein Bauer aus Villingen trug ein glühendes Eisen in der bloßen Hand, ohne sich zu verletzen. Um den 1. Juni ließ der König von Frankreich Petrus, seinen getreuesten und reichsten Rat, aufknüpfen, weil er angeblich die Königin hatte erkennen wollen. Anfang Mai gab es reife Erdbeeren, acht Tage nach St. Johannis des Täufers Fest reife Gerste. In Kolmar fraßen Schweine ihren Hirten. Ebenda warfen zwei Ziegen sieben Junge. Ein Luzerner Schiffer behauptete, in einem Tag von Luzern nach Straßburg fahren zu können: da er es aber nicht auszuführen vermochte, hat er, wie wir glauben, dreißig Pfund verloren. Eine Hexe verhinderte sechs Jahre lang ihre eigene Entbindung; im siebenten Jahr aber gebar sie, wie wir vernommen haben, drei Kinder auf einmal. […]. Der König von Böhmen lieferte dem König Rudolf bei Wien eine Schlacht, in der er selbst blieb, und mit ihm wie insgemein gesagt wurde, vierzehntausend Menschen.“46
Wer weiterblättert, liest auch, dass König Rudolf 1288 nach Colmar kam: „mit sich führte er ein Kamel, ein großes Tier von drei Jahren von ungewöhnlicher Höhe“ (et duxit secum camelum, animal magnum trium annorum, altitudinis inconsuete).47 Ein Jahr später kaufte der König „in Basel für dreißig Pfund Silber einen Käfig für einen Papagei“ (pro triginta libris argenti caveam in Basilea avi psitaco comparavit).48 Die Colmarer Dominikaner notierten auch Prophezeiungen und Traumvisionen, die den Untergang von Rudolfs ärgstem Rivalen Ottokar oder die Königswahl Rudolfs vorhersagten. Nach der Colmarer Chronik hätte der Vagant Setzer angeblich geweissagt: „Sage dem Grafen Rudolf von Habsburg, er werde König der Römer werden: Könige wird er bekämpfen und besiegen, fünfzehn Jahre wird er herrschen, Frieden wird er auf Erden bringen und durch seine Kinder viele Freunde sich verbinden; seit den Zeiten des großen Karl war nicht einer ihm ähnlich an Ruhm, Macht, Ehre und Reichtum: die Kaiserkrone aber wird er nicht erlangen können“ (a tempore Caroli Magni non fuit ei similis gloria, potentia, honore et divitiis; sed imperialem coronam non poterit obtinere).49
War das wirklich ein historiographischer Absturz ins Spätmittelalter? Das kritische Urteil stammt von den Liebhabern der großmaßstäblichen Entwürfe. Leser, die heutzutage ihre Zeitungslektüre in der Rubrik ‚Vermischtes‘ oder ‚Deutschland und die Welt‘ beginnen, werden von der spätmittelalterlichen Geschichtsschreibung besser bedient als von früheren heilsgeschichtlichen Theorieentwürfen. Es ist eben Einstellung, ob man sich die Welt von oben oder von unten, in der Struktur oder in der Varianz zusammensetzt.
Den historiographischen Wechsel betrachte ich freilich nicht als beliebig oder zufällig. Vielmehr deckten die Katastrophen, Spannungen und Widersprüche den Zeitgenossen des 13. Jahrhunderts das Ende ihrer Großmaßstäblichkeit schonungslos auf. Das lateinische Europa ließ sich eben nicht mehr als Abfolge von Weltreichen, als Fortsetzung des römischen Imperiums oder als Konkurrenz zweier universaler Gewalten begreifen. Neben Papst und Kaiser schoben sich kraftvoll die europäischen Monarchien. Und auch im Heiligen Römischen Reich entfalteten sich veränderte politische Willensbildungssysteme. Neben Könige und Fürsten traten neue Mitentscheider, Grafen und Herren, Städte und Bürger.50 Wir entdecken in unserer Gegenwart wieder neu, wie sich Verantwortung aus Breite und Tiefe und nicht aus binären Modellen von Befehl und Gehorsam speist.51 Solche Erfahrungen von Vielfalt weiten die Blicke auf mittelalterliche Pluralisierungen, auf die Lust am Mosaik, auf die Erfassung des Ganzen in Facetien.
Der Chronist Mathias von Neuenburg packte im 14. Jahrhundert das Große und das Kleine in einer Geschichte von Rudolfs Feldzug 1289 nach Burgund zusammen. Mut und Demut, Welteroberung und Mangel lagen hier eng beieinander. „Der König soll auch bei dem Heer gesagt haben, er würde in jedem Teil der Welt (in qualibet mundi parte) mit viertausend auserlesenen Behelmten und vierzigtausend wohlbewaffneten deutschen Fußknechten unbesiegbar sein.“52 Neben dieser deutschen Zuversicht auf Welteroberung standen Beispiele der Bescheidenheit. Rudolf ließ „die zerrissenen Ärmel seines Wamses durch neue Flicken ausbessern und gab so den anderen ein Beispiel, es ebenso zu machen“ (ubi manicas wambasii sui fractas cum novis peciis reparans dedit exemplum aliis similiter faciendi). Dann ging dem Heer auch noch der Proviant aus. „Als nun der König Rüben auf dem Felde stehen sah, schabte er eine derselben und verzehrte sie, und als die Übrigen das gesehen, sättigten auch sie sich einigermaßen mit Feldrüben.“53
Der Grafenkönig
Die Habsburg, eine Höhenburg in der Nähe von Brugg im schweizerischen Aargau, gab Rudolf und seinem Geschlecht den Namen.54 Bei seiner Königswahl durch die Mehrheit der Wahlfürsten im Heiligen Römischen Reich war er nicht der erste Graf des 13. Jahrhunderts, der zum Herrscher erhoben wurde. Er sollte auch nicht der letzte bleiben. Vor und nach ihm stiegen Graf Wilhelm von Holland, Landgraf Heinrich von Thüringen, Graf Adolf von Nassau und Graf Heinrich von Luxemburg zum römischen Königtum auf. Das erscheint deshalb erstaunlich, weil sich die Herzöge und Markgrafen mittlerweile als Reichsfürsten formiert und über die Gruppe der Grafen und Herren geschoben hatten. Das Paradox, dass ranghöhere Wahlfürsten einen Grafen zum König und Lehnsherrn erhoben, wurde durchaus schon von mittelalterlichen Beobachtern reflektiert. Mathias von Neuenburg berichtet von der Wahlentscheidung des Mainzer Erzbischofs 1273 mit folgenden Worten: „Als aber die Wahlfürsten versammelt waren, miteinander über die Gefahren der Thronvakanz und den Verlust aller fürstlichen Rechte klagten und sich über die Person eines zu wählenden Fürsten besprachen, rühmte der Mainzer den Mut und die Klugheit des Grafen Rudolf von Habsburg; und da viele mächtige Fürsten genannt waren, sagte er, Klugheit und Tapferkeit gingen über Macht und Reichtum, und stimmte für Rudolf.“55
Früher diskutierte man öfter, ob Rudolf von Habsburg ein großer oder ein kleiner Graf und später ein großer oder ein kleiner König war.56 Unstrittig besaß er im deutschen Südwesten als Graf hohe Bedeutung, trat als Verbündeter oder Gegner großer Bischöfe oder Städte hervor und bewährte sich in verlässlicher Treue zu den letzten staufischen Herrschern.57 Seine später beschworene Königsnähe im mittleren 13. Jahrhundert täuscht aber nicht darüber hinweg, dass die Wahlfürsten 1273 den mächtigsten Thronanwärter im Reich dezidiert übergingen, nämlich König Ottokar von Böhmen. Wie Rudolf seinen Aufstieg bewältigte und wie das in den Facetien stilisiert wurde, gehört zu den Grundpfeilern der habsburgischen Erfolgsgeschichte.
Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein festigte sich ein klares Geschichtsbild von Untergang, Krise und Neubeginn. Das Ende der Staufer im Reich in der Mitte des 13. Jahrhunderts galt als Katastrophe der deutschen Geschichte. Ihm folgte das sogenannte Interregnum.58 Es ging als kaiserlose, schreckliche Zeit in die Mythenbildung ein. Die Fürsten entschieden sich in strittigen Wahlen für kleine oder gar ‚ausländische‘ Könige. Erst Rudolfs Königswahl habe die Monarchie wieder einigermaßen kraftvoll ins deutsche Reich zurückgeführt. Deshalb reihte Karl Hampe (1869–1936), ein früherer Amtsvorgänger auf meiner Heidelberger Professur, in seinem erfolgreichen Buch „Herrschergestalten des deutschen Mittelalters“ Rudolf von Habsburg in die erlauchte Schar von acht großen Männern ein, die er überhaupt für darstellungswürdig erachtete. Bei Hampe trat der Habsburger in eine Reihe mit Theoderich dem Großen, Karl dem Großen, Otto dem Großen, Heinrich IV., Friedrich Barbarossa, Heinrich dem Löwen und Karl IV. und erhielt folgende Würdigung: „Er war ein echter deutscher Mann, der nach schwerster Verwirrung und Auflösung aller staatlichen Verhältnisse berufen wurde, die darniederliegende Zentralgewalt des Reiches aufs neue zu festigen, der in nüchterner Einsicht und kluger Selbstbescheidung den allein noch gangbaren Weg zu solchem Ziele erkannt hat und mit einer bei seinem Alter erstaunlichen Energie unter Aufbietung aller Kräfte auf diesem Wege unbeirrt so weit vorangeschritten ist, wie es die innere und äußere Lage nur irgend gestatteten, – keine Figur, an der man die glanzvollen Seiten oder die unergründlichen Tiefen deutschen Wesens studieren könnte, wohl aber ein vorbildlicher Vertreter jener wackeren, selbstsicheren, allein auf Tat und Wirklichkeit gerichteten Art, wie sie gerade in Zeiten der Sammlung und des mühseligen Wiederaufbaues unserm Volke stets vonnöten gewesen sind.“59
Abb. 2: König Rudolf von Habsburg thronend, Frontalansicht, Denkmal in der Westvorhalle des Speyerer Doms (19. Jh.)
Die nationale Rückbesinnung verdeckte die Chancen, die sich mit der Europäisierung des römischen Königtums in den ersten beiden Dritteln des 13. Jahrhunderts ergeben hatten. Die beiden königlichen Vorgänger Rudolfs aus England und Kastilien setzten jene imperiale Dehnung über die Enge des nordalpinen Reichs hinaus fort, die Kaiser Heinrich VI. oder Kaiser Friedrich II. begonnen hatten. Aus diesen neuen, mediterranen Perspektiven ergaben sich deutlichere Anknüpfungen an das Imperium Romanum der Antike und ein imperiales Herrschaftsverständnis, welches das römische Königtum ausgreifend mit den Königreichen von Sizilien und Jerusalem verknüpfte.
Als die Wahlfürsten Alfons von Kastilien oder Richard von Cornwall zu römischen Königen erhoben wurden, folgten sie solchen neuen Mustern, die beherzt über das alte regnum Teutonicum hinauswiesen. Erst das faktische monarchische Vakuum der 1260er Jahre im römischdeutschen Reich eröffnete einem südwestdeutschen Grafen den Weg auf den Thron. Das universale römische Herrschaftsmodell dachte noch keineswegs in der Kategorie von Deutschen oder ‚Ausländern‘. Deshalb wurde erst mit dem imperialen Ende von 1272/73 der klar auf das römisch-deutsche Reich des Spätmittelalters reduzierte Verantwortungsverbund von römischem König und deutschen Fürsten hervorgebracht. Ob man das als vergebene Chance einer mittelalterlichen Universalisierung oder als endliche ‚Normalisierung‘ und Einfügung römisch-deutscher Geschichte in die Nationalisierung Europas beurteilen will, hängt heute vom Standpunkt ab.
Dass Rudolfs Erhebung 1273 überraschte, überliefert eine Facetie über die Reaktion des Bischofs von Basel. Folgt man Mathias von Neuenburg, so platzte die Kunde von der Frankfurter Königswahl mitten in eine Fehde zwischen dem Bischof und dem Habsburger: „Der Bischof aber schlug sich, als er vernahm, was geschehen war, vor die Stirn und rief: ‚Herr Gott, sitze fest auf deinem Thron, sonst nimmt Rudolf deinen Platz ein.‘“60 Auch die Colmarer Chronik unterstrich, dass Rudolf inmitten seiner regionalen Fehden zum Königtum aufstieg: „Graf Rudolf von Habsburg hat, wie man weiß, mit verschiedenen Herren Fehden und Kriege (lites et guerrae) gehabt, mit dem Grafen von Savoyen, dem Grafen von Rapperschwyl, dem Grafen von Hohenberg oder Homberg, dem Abt von St. Gallen, dem Bischof Eberhard von Konstanz, mit den Bürgern von Bern, mit seinem Vetter, dem Bischof Heinrich von Basel. Während dieser Fehde wurde er zum römischen König gewählt im Jahre 1273.“61 Im monarchischen Amt entwickelte sich der gewaltbereite Habsburger weiter, baute die königliche Gerichtsgewalt wieder neu auf, forcierte die Bindungen zu den königlichen Städten, organisierte die Herrschaftsrechte des Königtums in den reichsnahen Regionen und betrieb eine ausgleichende Landfriedenspolitik.62
Rudolf und seine Wahlfürsten konstruierten seit 1273 die historischen Voraussetzungen ihres Handelns jedenfalls neu. Auf Hoftagen wurden die gemeinsame Verantwortung von König und Fürsten für das Reich und ihr inneres Verhältnis in neuen Ordnungen verschriftlicht.63 In tagespolitischen Herausforderungen entstanden Normen zur Vergabe von Reichslehen oder zum formalen Streitaustrag zwischen dem König und einem Reichsfürsten. Man muss dieser Formierungsphase systematisierter Ordnung im ersten Jahrzehnt von Rudolfs Herrschaft fundamentale Bedeutung für das politische Gefüge des Heiligen Römischen Reichs zusprechen. Aus bloßen Zufällen oder aktuellen Notwendigkeiten wuchsen dem rheinischen Pfalzgrafen besondere Befugnisse zu, in denen sich das überkommene konsensuale Herrschaftssystem des Reichs deutlicher formalisierte.64
Die Verabredungen des Nürnberger Hoftags vom November 1274 schufen die rechtlichen Grundlagen für Rudolfs Durchsetzung im Reich.65 Um Rudolfs größten Rivalen Ottokar von Böhmen zur Strecke zu bringen, wurde das Jahr 1245 als historischer Markstein für legitimes Regieren im Reich entdeckt. Es war das Jahr, in dem Papst Innocenz IV. Kaiser Friedrich II. auf dem Ersten Konzil von Lyon abgesetzt hatte. Was danach an Großem im Reich verfügt worden war, hatte nur dann rechtmäßigen Bestand, wenn es mit Zustimmung von König und Fürsten ausgehandelt worden war. Damit war die Jagd auf den böhmischen König eröffnet, der sich erst später die Herzogtümer Österreich und Steiermark angeeignet hatte. Zu Rudolfs größten Erfolgen gehörte sein Geschick, mit dem er die Reichsfürsten zur Übertragung der im Krieg gegen Ottokar eroberten Herzogtümer 1282/83 an seinen ältesten Sohn Albrecht bewog.
Herkunft aus ‚alternativen Fakten‘
Rudolf und seine Chronisten hatten den Rangsprung vom Grafen zum König sehr wohl im Blick. Sie bewältigen ihn zweifach, durch die Erfindung von Traditionen und durch die dynastische Aufsaugung der fürstlichen Wähler in Eheverbindungen mit Kindern des neuen Herrschers. Gleich bei seinem Regierungsantritt stellte sich Rudolf in fürstliche Traditionen der 1218 im Mannesstamm ausgestorbenen zähringischen Herzogsfamilie. Rudolfs Gemahlin Gertrud von Hohenberg nahm seit der Aachener Königskrönung den neuen Namen Anna an; ihre Tochter Gertrud hieß seither Agnes. Im römisch-deutschen Königtum war ein solcher Namenwechsel kein üblicher Vorgang. Anna und Agnes hießen die Schwestern und Erbinnen des letzten zähringischen Herzogs Berthold V., und Anna war die Großmutter König Rudolfs.66 Damit griff der Habsburger beherzt zähringische Traditionen auf und zeigte sich fürstengleich.67 Die Colmarer Chronik betonte Rudolfs Abstammung aus dem Geschlecht des Herzogs von Zähringen. Rudolfs Geburtstag am 1. Mai 1218 fiel genau in das Jahr, in dem der letzte Zähringer im Mannesstamm starb.68
Diese Abstammung von den Zähringern lässt sich als einziges sicheres Herkunftswissen an Rudolfs Königshof nachweisen. Zusammen mit der Königswahl bot dies die Basis für ein ausgreifendes Netz dynastischer Hochzeiten, in denen Rudolf seine Kinder mit Wahlfürsten und anderen Dynasten verband. Seine sechs Töchter wurden mit den vier weltlichen Königswählern sowie mit dem Herzog von Bayern und dem Sohn des Königs von Neapel verheiratet.69 Eine Facetie der Colmarer Chronik leitet sogar die fürstliche Wahlentscheidung von 1273 aus der Fülle habsburgischer Königstöchter als ‚Heiratsobjekten‘ ab. Ein Bote sei zu Rudolf gereist und habe berichtet: „‚Die Wähler lassen euch melden, dass, wenn ihr eure Töchter den und den Herren zur Ehe geben wollt, sie euch zum römischen König wählen werden.‘ Rudolf antwortete: ‚Dies und alles andere werde ich erfüllen.‘“70. Auch Mathias von Neuenburg erklärte die fürstliche Bereitschaft zu Rudolfs Königswahl damit, „dass Rudolf sechs Töchter hätte.“71
So kamen der Habsburger und seine Kinder in kürzester Zeit im Reich wie in der fürstlichen Hocharistokratie an. Der neuen Macht genügte das zähringische Herkunftsbewusstsein bald nicht mehr. Es wurde mit ‚alternativen Fakten‘ weiterentwickelt. Um 1306 notierte der Dominikaner Tolomaeus von Lucca im Bericht zur Königswahl 1273: „Dieser Graf soll seinen Ursprung von einem italienischen Geschlecht hergeleitet haben. Er war ein tüchtiger Ritter, wenn auch ein armer Graf (licet pauper comes), dennoch immer bereit zum Kampf mit dem Grafen von Savoyen zur Verteidigung seiner Länder.“72 Im 14. Jahrhundert faltete Mathias von Neuenburg diese Herkunftssage aus und reicherte sie mit einer Ansippung an die Staufer an. Kaiser Friedrich II. sei der Taufpate Rudolfs gewesen. Patenschaft begründete eine compaternitas, eine geistliche Vaterschaft. Ein Astrologe soll dem Kaiser später in Italien geweissagt haben, Rudolf werde einst das Kaisertum und dieselbe Macht wie Friedrich II. besitzen: „Als Rudolf mit Kaiser Friedrich, der ihn aus der Taufe gehoben hatte, in der Lombardei war, erhob sich der Sterndeuter des Kaisers häufig vor demselben Rudolf, obgleich er noch ein junger Mann war, und zeichnete ihn vor allem anderen angesehenen und berühmten Männern aus. Da nun der Kaiser den Sterndeuter fragte, warum er diesem vor Anderen so viel Ehre erweise, antwortete er, demselben würde die Ehre des Kaisertums und dieselbe Macht, wie er sie besäße, zuteil werden. Und als sich der Kaiser darüber beunruhigte und ungehalten wurde, sprach der Sterndeuter: ‚Werdet ihm nicht gram, denn ehe seine Herrschaft beginnen wird, wird von euch, die ihr jetzt zehn Söhne habt, und auch von ihnen keiner mehr sein.‘ Rudolf aber entfernte sich von diesem Zeitpunkt an vom Hof.“73
Diese Staufernähe verband Mathias von Neuenburg mit einer angemessenen Ursprungserzählung, die von Mustern anderer mittelalterlicher Wander- und Herkunftssagen geprägt war: „Rudolf Graf von Habsburg leitet seinen Stamm von alten Vorfahren aus der Stadt Rom ab. Als nämlich einstmals zwei Brüder wegen Ermordung eines römischen Edlen aus der Stadt verbannt wurden, gab ihr Vater, ein Römer von hohem Adel, jedem von ihnen eine unermessliche Summe Geld mit und befahl ihnen, in abgelegene Gegenden zu ziehen. Sie gingen also nach Oberdeutschland. Der ältere war darauf bedacht, Güter und Burgen anzukaufen, der jüngere aber suchte sich recht viele Vasallen zu verschaffen. Als nun der Vater nach einigen Jahren seine Söhne besuchte und sah, was der ältere angekauft hatte, lobte er dessen Klugheit; als er aber den jüngeren fragte, was er getan hätte, antwortete dieser, er hätte Alles in einer einzigen, sehr festen Burg niedergelegt. Und nachdem er alle seine Vasallen und deren Söhne, aufs Beste bewaffnet, auf dem Berg, wo die Burg Habsburg steht, beschieden hatte, führte er seinen Vater dorthin, versicherte ihm, dass diese Menge wehrhafter Männer, welche er mit ihren männlichen Nachkommen dem Vater als seine getreuen Vasallen vorstellte, was diese auch bestätigten, seine Burg sei. Da dies der Vater sah, freute er sich seines hohen und adligen Sinnes und wies ihm einen großen Schatz an. Von diesen Brüdern stammen alle späteren Habsburger ab.“74
Römische Herkunft wurde im späteren Mittelalter auch für andere deutsche Adelsfamilien konstruiert. Die Historia Welforum leitete bereits im 12. Jahrhundert die Welfen (der Name Welf lateinisch als catulus) von einem römischen Senator Catilina ab.75 Levold von Northof begann in der Mitte des 14. Jahrhunderts seine Geschichte der Grafen von der Mark ebenfalls mit zwei Brüdern „aus adligem und vornehmem Geschlecht der Römer, nämlich der Orsini, die bis zum heutigen Tag zu den Vornehmeren und Mächtigeren in Rom zählen“. Diese seien um die Jahrtausendwende als Gefolgsleute Kaiser Ottos III. über die Alpen gekommen.76
Solchen Mustern folgend waren die Habsburger nach drei Generationen Königtum auch in der römischen Welt angekommen. Kreativ schrieb man künftig solche Einpflanzungen in antiken Traditionen und trojanischen Vorfahrenreihen weiter. Bei Rudolfs Aufstieg 1273 war diese vornehme Herleitung noch nicht zu beobachten. Er überzeugte sein Reich mit bloßen zähringischen Traditionen, mit heiratsfähigen Kindern und mit einer persönlichen Mischung aus Mut, Verschlagenheit, Glück, Einfachheit und Menschennähe.
Hochmut und Demut
Wiederholt betonten die Facetien Rudolfs beispielhafte Schlichtheit und Menschennähe. Die Erzählungen vom demütigen König dienten als Muster wahrhaft herrscherlichen Maßhaltens und als Beschämung für Hochmütige. Beispielhaft soll hier die Vorbereitung eines Heereszugs genannt werden, von der Mathias von Neuenburg in seinem Kapitel „Von der Klugheit (astucia) und dem Ansehen (honor) des Grafen Rudolf von Habsburg“ berichtet: „Als er aber einmal in der Absicht, eine Heerfahrt zu unternehmen, seine Leute in Ensisheim versammelt hatte, ließ er ihnen nur spärlich Roggenbrot und schlechten Wein vorsetzen; und da einige der Ritter sich für die gräfliche Tafel selbst weißes Brot und guten Wein kauften, verabschiedete er diese nach aufgehobener Tafel im Geheimen, indem er sagte, er wäre ihrer Dienstleistungen nicht mehr bedürftig. Als sie ihn aber um die Ursache befragten, beschämte er sie durch den Vorwurf, dass sie nicht mit dem zufrieden gewesen wären, womit sich bessere Leute begnügt hätten.“77
Welche Geschicklichkeit man dem Habsburger dann als König in der Nutzung von Ritualen zutraute, bezeugen die Geschichten über die Auseinandersetzungen mit König Ottokar II. von Böhmen. Nach einer ersten verlorenen Schlacht musste sich der Böhme 1276 dem vorher von ihm verspotteten ‚kleinen Grafen‘ unterwerfen, in einer zweiten verlor er 1278 sein Leben. Den Wechsel des Glücks zwischen Hochmut und Demut fing die Colmarer Chronik im Spiel der Worte und der Zeichen ein und notierte zu Ottokars Unterwerfung 1276:
„Der König von Böhmen, mit vielen Rittern und Rossen, mit goldgeschmückten Gewändern und edlen Steinen geziert, bereitete sich, die Regalien sofort von dem römischen König zu empfangen. Als das die Fürsten König Rudolfs vernahmen, berichteten sie es dem König mit Freuden und sprachen: ‚Herr, bereitet euch mit kostbaren Gewändern, wie es einem König ziemt.‘ Da sprach der König: ‚Der König von Böhmen hat mein graues Wams mehr als einmal verlacht; jetzt aber wird mein graues Wams ihn verlachen.‘ Danach sprach er zu seinem Notar: ‚Gib mir deinen Mantel, damit der König von Böhmen meine Armut verspotte.‘ Als nun der König von Böhmen ankam, sprach der römische König zu seinen Rittern: ‚Zieht eure Rüstungen an, wappnet eure Streitrosse, und so zum Krieg bereit, so gut ihr vermögt, stellt euch in Ordnung zu beiden Seiten des Weges auf, auf welchem der König kommen wird, und zeigt den barbarischen Völkern den Glanz der deutschen Waffen.‘ Als dies alles nach dem Willen des Königs bereitet war, erschien der böhmische König mit goldgeschmückten Kleidern und in königlichem Glanze: Er fiel zu den Füßen des römischen Königs nieder und bettelte demütig bei ihm um seine Regalien. Überdies verzichtete er auf hunderttausend Mark Einkünfte sowie auf vierzigtausend Mark, die der Herzog von Österreich gehabt und der König von Böhmen von der Königin Margarete her besessen hatte. Da verlieh der römische König dem König von Böhmen das Königreich und die Regalien, und erklärte ihn vor allen Anwesenden für seinen werten Freund. Während der römische König dies tat, erschien er in seinem grauen Wams niedrig und gewöhnlich und saß auf einem Schemel.“78
Es gibt in der Geschichte manche Szenen, in denen ein überlegener Herr mit demonstrativer Einfachheit einen reich geschmückten Untergebenen beschämte. König Friedrich II. von Preußen (reg. 1740–1786) beherrschte triumphierend dieses Zeichenspiel mit seiner abgewetzten Uniform. Auch die Facetie von Rudolfs Wams und Schemel grub sich als Inversionsritual tief ins Gedächtnis ein.
Sie wurde weitererzählt und dabei verändert. In der Mitte des 15. Jahrhunderts schrieb Aeneas Silvius Piccolomini von einer anderen Öffentlichkeit. Im Ausgang des Mittelalters mochten sich die großen Fürsten beim Lehnsakt nicht mehr einem König öffentlich und vor den Augen ihrer Krieger beugen. Deshalb, so Aeneas Silvius, wollte König Ottokar den Treueid nur im geschlossenen Zelt König Rudolfs leisten: „Eine hohe Tribüne wurde im Zelt aufgebaut und dort an herausragender Stelle ein goldener Thron errichtet. Rudolf, geschmückt mit der Krone und den kaiserlichen Insignien, um ihn herum sitzend die Kurfürsten und stehend die übrigen Großen des Reiches, erwartete, auf seinem Thron sitzend, die Ankunft des Königs. Jener trat in Begleitung weniger Adliger seines Reiches ein, stieg auf die Tribüne und machte zu Füßen des Kaisers [sic!] den Kniefall. Als man dann entsprechend alter Sitte das Buch der Heiligen Schrift herbeigebracht hatte, legte er den Treueid ab. Unterdessen fiel das Zelt, das man kunstvoll aufgebaut hatte, von oben bis unten in vier Teile geteilt herab und bot den König, wie er oben auf der Tribüne die Knie des Kaisers demütig umfasste, den Heeren zum Anblick. Die bewaffneten Schlachtreihen standen um das Zelt herum und warteten auf den Ausgang des Geschehens. Aber wie die Deutschen ihren glorreichen Kaiser fröhlich betrachteten, so nahmen die Böhmer traurig und betrübt die Torheit und Feigheit ihres Königs wahr, der lieber dem Kaiser untertan sein als den Kampf erproben wollte. Ottokar war verblüfft darüber, obwohl er genau wusste, dass das Zelt mehr durch List als durch Zufall heruntergefallen war. Dennoch glaubte er, für den Augenblick schweigen zu sollen. Als er vom Kaiser sich die Erlaubnis erbeten hatte, kehrte er voll Zorn nach Hause zurück.“79
Die großen und die kleinen Männer
Vom Mittelalter bis zur Neuzeit war dieses Ringen zweier Helden der Stoff, aus dem man Dramen schrieb. Unter ihnen ragt Franz Grillparzers ‚König Ottokars Glück und Ende‘ (1825) heraus. Dieses österreichische Schicksalsstück wirkt über das Ende der Habsburgermonarchie bis in unsere Zeit. Es war kein Zufall, dass das Wiener Burgtheater nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg mit ‚König Ottokars Glück und Ende‘ 1955 wiedereröffnet wurde. Neben dem berühmten Monolog Rudolfs an der Leiche des Böhmenkönigs behauptet die Rede Ottokars von Horneck bis heute hohe Berühmtheit. Es war ein bloßer Dienstmann, der den schwäbischen Habsburger mit ergreifenden Worten nach Österreich einlud:
„Es ist ein guter Herr, es ist ein gutes Land,
Wohl wert, daß sich ein Fürst sein unterwinde!
Wo habt Ihr dessengleichen schon gesehn?
Schaut rings umher, wohin der Blick sich wendet,
Lacht’s wie dem Bräutigam die Braut entgegen.
[…]
Drum ist der Österreicher froh und frank,
Trägt seinen Fehl, trägt offen seine Freuden,
Beneidet nicht, läßt lieber sich beneiden!
Und was er tut, ist frohen Muts getan,
’s ist möglich, daß in Sachsen und am Rhein
Es Leute gibt, die mehr in Büchern lasen;
Allein, was not tut und was Gott gefällt,
Der klare Blick, der offne, richt’ge Sinn,
Da tritt der Österreicher hin vor jeden,
Denkt sich sein Teil und läßt die andern reden!
O gutes Land! o Vaterland! Inmitten
Dem Kind Italien und dem Manne Deutschland
Liegst du, der wangenrote Jüngling, da;
Erhalte Gott dir deinen Jugendsinn
Und mache gut, was andere verdarben!“80
Mit der Figur des Ottokar von Horneck fing Grillparzer einen mittelalterlichen Verantwortungsverbund ein, dessen soziale Breite Rudolfs Regieren charakterisierte. An seinem Hof mischten sich die Reichsfürsten mit den Grafen, Herren und bürgerlichen Eliten. Mit persönlicher Tapferkeit und Schlagfertigkeit war der Habsburger Vorbild für Ritter und für Bürger. Wie umsichtige Aushandlungspraktiken und viele Mitspieler Rudolfs Herrschaft prägten, wird in der Vergabe der von Ottokar eroberten Reichslehen Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Windische Mark an Rudolfs Söhne und deren Erhebung zu Reichsfürsten deutlich. Hier wie in zentralen anderen Stationen seines Regierungshandelns holte Rudolf beständig Konsensakte der Königswähler oder Fürsten, der Adligen und Herren ein.81 In seinen Urkunden nannte Rudolf immer wieder die allgemeine Zustimmung der Fürsten oder hob einzelne Herren namentlich heraus.82 Die Zugehörigkeit zur mitentscheidenden Gruppe der Königswähler konkretisierte sich im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts. Bei einer Schenkung für das Bistum Basel verwies der König ausdrücklich auf „die Zustimmung des größeren Teils der Fürsten, deren Konsens in dieser Sache einzuholen ist.“83
Das erste Privileg Rudolfs über die Belehnung seiner Söhne Albrecht und Rudolf mit den Reichsfürstentümern vom Dezember 1282 betonte programmatisch die Bindung des Königs an Gesetze und Rechte. Mit ausdrücklicher Zustimmung der Wahlfürsten (de libero et expresso consensu imperii principum ius in electione regis Romani ex longa consuetudine tenencium) belehnte Rudolf seine beiden Söhne gemeinsam. Die Fürstentümer sollten der Dynastie zu gesamter Hand zufallen.84
Doch schon ein halbes Jahr später beugte sich König Rudolf in seiner ‚Hausordnung von Rheinfelden‘ dem Widerstand der Beherrschten gegen eine doppelte Herzogsherrschaft. Albrecht war fortan der alleinige Herzog, während der Bruder nur als subsidiärer Erbe galt. Dessen fürstliche Ehre sollte anders gewahrt werden. Bemerkenswert ist die Begründung der zweiten Königsurkunde. Rudolf verwies erneut auf den Konsens der Reichsfürsten (in concessione terrarum Austrie, Styrie, Carniole et Marchie de consensu principum imperii), beugte sich aber mit der exklusiven Belehnung seines ältesten Sohns Albrecht dem massiven Widerstand niederer wie kleinerer Adliger und der ‚Gemeinschaft jener Länder‘ (nobiles mediocres et minores ac communitas ipsarum terrarum). Sie hatten die gemeinsame Belehnung zweier Herzöge nicht hingenommen, wollten ihren Nacken nicht unter eine doppelte Herrschaft beugen (duplicis dominii iugo colla submittere) und behaupteten mit einem Bibelzitat: ‚Niemand kann angemessen zwei Herren dienen‘ (Mt 6,24).85 Die Edlen, Mittleren und Kleineren aus der Gemeinschaft der neu beherrschten Länder hatten 1283 ihre Handlungsmacht durchgesetzt!
Angesichts ausgreifender Teilungspraktiken in spätmittelalterlichen Fürstenhäusern86 ist auffällig, dass im 14. Jahrhundert normative Quellen wiederholt das Ideal herrschaftlicher Einheit beschworen. Das galt für die Goldene Bulle Kaiser Karls IV. und der Kurfürsten von 1356 ebenso wie für den Fürstenspiegel Levolds von Northof für den Grafen von der Mark mit der Forderung, „dass die Einheit dieser Grafschaft Mark ungeteilt bewahrt bleibe“ (ut ipsius comitatus de Marka unitas indivisibiliter conservetur).87 Beide Texte zitieren wörtlich die berühmten Jesusworte aus dem Lukasevangelium: „Jedes Reich, das in sich selbst gespalten ist, wird veröden.“ (Omne regnum in seipsum divisum desolabitur, Lk 11,17). Karl IV. lässt die Goldene Bulle nach der Intitulatio sogar mit dieser programmatischen Aussage beginnen.88
Die Rücksicht König Rudolfs auf die Beherrschten in Österreich, die nur einem Herzog und nicht zweien dienen wollten, lässt uns eine besondere Verantwortungsgemeinschaft erkennen. Sie speiste sich aus hierarchischer wie konsensualer Breite und Tiefe und wurde im Spätmittelalter prägend für die Geschichte des Alten Reichs und seiner Stände.89 Die Liebhaber absoluter Macht oder hierarchischer Staatlichkeit wollten den Charme eines solchen Ordnungsgefüges nicht akzeptieren. Tatsächlich bewahrte es dem Heiligen Römischen Reich aber eine lange Stabilität. Die Nachhaltigkeit von Rudolfs Herrscherleistung verharrt also nicht nur in dynastischen Wegweisungen oder im Erwerb Österreichs für seine Nachkommen. Seine Aushandlungspraktiken mit großen und mit kleinen Leuten wirkten ebenso in die Zukunft wie die Idee von der ständischen Gemeinschaft des Landes90 oder wie die Wahrung von Rechtsgewohnheiten.91
Am Schluss dieses Beitrags steht die Begegnung des Königs mit einem alten Zürcher. Die Facetie findet sich bei Mathias von Neuenburg und führt uns zu mittelalterlichen Emotionen, deren öffentliche Inszenierung untrennbar zur politischen Performanzkultur gehörte.92 Angemessener als das Lachen waren dabei die Tränen, das Zähneklappern und die barfüßige Reue. Stefan Weinfurter zeigte in seinem Aufsatz ‚Der Papst weint‘, wie Papst Innocenz IV. 1245 bei der Absetzung Kaiser Friedrichs II. wiederholt laut und öffentlich weinte, um bedauernd die Unausweichlichkeit seines Handelns zu unterstreichen.93 Lautes Lachen war den Theologen dagegen häufig suspekt.94 Den rigorosen monastischen Kampf gegen das Lachen im 14. Jahrhundert machte Umberto Eco zum Thema seines Erfolgswerks ‚Der Name der Rose‘. Diese Geschichte über das diabolische Gelächter spielte in jener Zeit, in der Mathias von Neuenburg mit folgender Facetie – er nennt sie fabula – einen Kontrapunkt setzte:
„Als der König eines Tages über die Brücke von Zürich ging, sah er einen Greis mit roten Wangen und vielen weißen Haaren stehen und sagte zu seinem Begleiter: ‚O wie viele glückliche Tage mag dieser Graukopf erlebt haben.‘ Dies hörend entgegnete jener mit sanfter Stimme: ‚Ihr täuschet euch, denn ich habe nicht einen guten Tag gehabt,‘ und da der König das vernahm, befragte er ihn um die Ursache. Dieser antwortete, er hätte als armer junger Mann des Geldes wegen ein hässliches altes Weib genommen, mit ihr, die sehr zornmütig gewesen und ihn durch Eifersucht viel gequält, hätte er lange gelebt und deshalb ein bedauernswürdiges Leben geführt; nachdem aber diese, als er selbst schon ein alter Mann war, gestorben war, hätte er sofort eine andere, noch junge Frau genommen, hätte sie aber nicht befriedigen können und so wäre sein Leben unter beständigen Händeln noch trauriger geworden. Darüber musste der König lachen (De quo rex in risum est provocatus).“95
Abb. 3: König Rudolf von Habsburg thronend, Seitenansicht, Denkmal in der Westvorhalle des Speyerer Doms (19. Jh.)
800 Jahre nach seinem Geburtstag schallt Rudolfs Lachen zu uns herüber. Wir haben hier auf die Geschichten gehört und dabei die Geschichte keineswegs vernachlässigt. Die Facetien vom Sterben in Speyer, vom Regieren im Reich und vom Lachen in Zürich wollen uns einen König als Menschen präsentieren. Diese Quellen stehen aber auch für einen historiographischen und für einen historischen Wandel im 13. Jahrhundert. Am Scheitelpunkt unserer modernen Großmaßstäblichkeit entdecken wir jene Welt wieder neu und lassen uns von ihr etwas erzählen.
1 Erweiterter Text eines öffentlichen Abendvortrags am 11.04.2018 im Dom zu Speyer.
2 Chronicon Colmariense, in: Annales Colmarienses, Basileenses, Chronicon Colmariense, hg. von Philipp JAFFÉ, in: MGH. Scriptores, Bd. 17, Hannover 1861, S. 240–270, hier S. 240: Comes Rudolfus de Habisburch natus est de progenie ducis Zeringie anno 1218 … Kalendas Maii, eodem scilicet anno, quo dux Zeringie viam carnis ingreditur universe. Erat hic vir longus corpore, habens in longitudine 7 pedes, gracilis, parvum habens caput, pallidam faciem atque longum nasum, paucos habebat crines, extremitates vero habebat parvulas atque longas; vir in cibo et potu et in aliis moderatus, vir sapiens et prudens, et cum maximis divitiis in summa tamen semper extitit paupertate. Multos habuit filios et filias, quos omnes constituit in magnas divitias et honores. Hic existens in Turingia, sexaginta milia et centum milia dicitur expendisse infra unum annum; bis obsedit Bisuntium et Gallicos graviter devastavit. Die (leicht geglättete und modernisierte) deutsche Übersetzung folgt: Annalen und Chronik von Kolmar, übersetzt von H. PABST, 2. Aufl. von Wilhelm WATTENBACH (Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit 75), Leipzig 1897, S. 145f.
3 Zur Biographie Oswald REDLICH, Rudolf von Habsburg. Das deutsche Reich nach dem Untergange des alten Kaisertums, Innsbruck 1903; Karl-Friedrich KRIEGER, Rudolf von Habsburg (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance), Darmstadt 2003; Thomas ZOTZ, Rudolf von Habsburg (1273–1291), in: Die deutschen Herrscher des Mittelalters. Historische Portraits von Heinrich I. bis Maximilian I. (919–1519), hg. von Bernd SCHNEIDMÜLLER/Stefan WEINFURTER, 2. Aufl. München 2018, S. 340–359 und 587f.; Martin KAUFHOLD, Rudolf I., in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 22, Berlin 2005, S. 167–169. Vgl. Rudolf von Habsburg 1273–1291. Eine Königsherrschaft zwischen Tradition und Wandel, hg. von Egon BOSHOF/Franz-Reiner ERKENS (Passauer Historische Forschungen 7), Köln/Weimar/Wien 1993.
4 Andreas BÜTTNER, Der Weg zur Krone. Rituale der Herrschererhebung im spätmittelalterlichen Reich (Mittelalter-Forschungen 35), Ostfildern 2012, TeilBd. 1, S. 203–222. Siehe auch den Beitrag von Andreas BÜTTNER in diesem Band.
5 Johann Friedrich BÖHMER, Regesta Imperii, Bd. VI, 1: Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273–1313, neubearb. von Oswald REDLICH, Innsbruck 1898, Nr. 2518a–b, S. 533f. Zum Domstift Jürgen KEDDIGKEIT/Charlotte LAGEMANN/Matthias UNTERMANN/Martin ARMGART/Ellen SCHUMACHER, Speyer, St. Maria. Domstift, in: Pfälzisches Klosterlexikon. Handbuch der pfälzischen Klöster, Stifte und Kommenden, Bd. 4, hg. von Jürgen KEDDIGKEIT/Matthias UNTERMANN/Charlotte LAGEMANN/Lenelotte MÖLLER, Kaiserslautern 2017, S. 133–238.
6 Rudolf J. MEYER, Königs- und Kaiserbegräbnisse im Spätmittelalter. Von Rudolf von Habsburg bis zu Friedrich III. (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 19), Köln/Weimar/Wien 2000, S. 19–31. Vgl. Thomas MEIER, Die Archäologie des mittelalterlichen Königsgrabes im christlichen Europa (Mittelalter-Forschungen 8), Stuttgart 2002; Caspar EHLERS, Metropolis Germaniae. Studien zur Bedeutung Speyers für das Königtum (751–1250) (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 125), Göttingen 1996. Siehe die Beiträge von Manuel KAMENZIN und Benjamin MÜSEGADES in diesem Band.
7 Franz-Reiner ERKENS, Zwischen staufischer Tradition und dynastischer Orientierung: Das Königtum Rudolfs von Habsburg, in: Rudolf von Habsburg 1273–1291 (wie Anm. 3), S. 33–58. Zur Folgewirkung: Habsburger Herrschaft vor Ort – weltweit (1300–1600), hg. von Jeannette RAUSCHERT/Simon TEUSCHER/Thomas ZOTZ, Ostfildern 2013; Gerald SCHWEDLER, Ausgelöschte Autorität. Vergangenheitsleugnung und Bezugnahme Rudolfs von Habsburg zu Staufern, Gegenkönigen und der salischen Niederlage am Welfesholz, in: Autorität und Akzeptanz. Das Reich im Europa des 13. Jahrhunderts, hg. von Werner BOMM/Hubertus SEIBERT/Verena TÜRCK, Ostfildern 2013, S. 237–252.
8 Karl-Friedrich KRIEGER, Die Habsburger im Mittelalter. Von Rudolf I. bis Friedrich III. (Urban-Taschenbücher 452), Stuttgart/Berlin/Köln 1994; Michael ERBE, Die Habsburger 1493–1918. Eine Dynastie im Reich und in Europa (Urban-Taschenbücher 454), Stuttgart/Berlin/Köln 2000; Heinz-Dieter HEIMANN, Die Habsburger. Dynastie und Kaiserreiche, 5. Aufl. München 2016; Stephan SANDER-FAES, Europas habsburgisches Jahrhundert 1450-1550 (Geschichte kompakt), Darmstadt 2018.
9 Rudolf J. MEYER, Königs- und Kaiserbegräbnisse (wie Anm. 6), S. 32–52; Caspar EHLERS, Ein Erinnerungsort im 12. Jahrhundert. Speyer, in: Deutsche Königspfalzen. Beiträge zu ihrer historischen und archäologischen Erforschung, Bd. 6: Geistliche Zentralorte zwischen Liturgie, Architektur, Gottes- und Herrscherlob: Limburg und Speyer, hg. von Caspar EHLERS/Helmut FLACHENECKER (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 11/6), Göttingen 2005, S. 119–140.
10 Siehe den Beitrag von Matthias MÜLLER in diesem Band.
11 Hans-Henning KORTÜM, Zur Typologie der Herrscheranekdote in der mittelalterlichen Geschichtsschreibung, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 105, 1997, S. 1–29; Claudia BRINKER-VON DER HEYDE, Die literarische Welt des Mittelalters, Darmstadt 2007.
12 Willi TREICHLER, Mittelalterliche Erzählungen und Anekdoten um Rudolf von Habsburg (Geist und Werk der Zeiten 26), Bern/Frankfurt am Main 1971, S. 11. Vgl. auch Erich KLEINSCHMIDT, Herrscherdarstellung. Zur Disposition mittelalterlichen Aussageverhaltens, untersucht an Texten über Rudolf I. von Habsburg (Bibliotheca Germanica 17), Bern/München 1974; Alfred RITSCHER, Literatur und Politik im Umkreis der ersten Habsburger. Dichtung, Historiographie und Briefe am Oberrhein (Freiburger Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte 4), Frankfurt am Main/Bern/New York/Paris 1992; Adolf HOFMEISTER, Anekdoten von Rudolf von Habsburg und Friedrich III. (IV.), in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 125, 1934, S. 12–22.
13 Annette KEHNEL, Rudolf von Habsburg im Geschichtswerk der Colmarer Dominikaner, in: Studia monastica. Beiträge zum klösterlichen Leben im christlichen Abendland während des Mittelalters, hg. von Reinhardt BUTZ/Jörg OBERSTE (Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiösen Lebens im Mittelalter 22), Münster 2004, S. 211–234.
14 Oswald REDLICH, Rudolf von Habsburg in der volkstümlichen Überlieferung, in: Oswald REDLICH, Ausgewählte Schriften, Zürich/Leipzig/Wien 1928, S. 9–21 [Vortrag, gehalten im Verein für Landeskunde am 27. April 1918, anläßlich der 700. Wiederkehr des Geburtstages Rudolfs von Habsburg]. Einen anderen Jubiläumsvortrag hielt Max VANCSA, Rudolf von Habsburg in der Dichtung, in: Österreichische Rundschau 55, 1918, S. 114–120.
15 Willi TREICHLER, Mittelalterliche Erzählungen (wie Anm. 12), Nr. 40, S. 107f.
16 Ebenda, Nr. 47, S. 112f.
17 Ebenda, Nr. 41, S. 108f. Vgl. Thomas MARTIN, Das Bild Rudolfs von Habsburg als „Bürgerkönig“ in Chronistik, Dichtung und moderner Historiographie, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 112, 1976, S. 203–228.
18 Zur anderen Volkstümlichkeit Ottos des Großen Gerd ALTHOFF, Schuhe für den Bischofshut. Anekdoten über die „großen“ Herrscher des Mittelalters. Karl der Große und Otto der Große im Vergleich (Magdeburger Museumshefte 16), Magdeburg 2001. Vgl. Gerd ALTHOFF/Christel MEIER, Ironie im Mittelalter. Hermeneutik – Dichtung – Politik, Darmstadt 2011.
19 Willi TREICHLER, Mittelalterliche Erzählungen (wie Anm. 12), Nr. 28, S. 79.
20 Ebenda, Nr. 29, S. 80.
21 Cyrille DEBRIS, «Tu, felix Austria, nube». La dynastie de Habsbourg et sa politique matrimoniale à la fin du Moyen Âge (XIIIe–XVIe siècles) (Histoire de famille. La parenté au Moyen Âge 2), Turnhout 2005. Vgl. den Beitrag von Julia HÖRMANN-THURN UND TAXIS in diesem Band.
22 Richard Löwenherz. König – Ritter – Gefangener, hg. von Alexander SCHUBERT, Regensburg 2017. Zum Helden-Typus des Mittelalters vgl. die Forschungen des SFB 948 ‚Helden, Heroisierungen, Heroismen‘ der Universität Freiburg im Breisgau: https://www.sfb948.uni-freiburg.de/de (08.08.2018).
23 Oswald REDLICH, Rudolf von Habsburg in der volkstümlichen Überlieferung (wie Anm. 14), S. 9.
24 Ebenda, S. 11.
25 Ebenda, S. 21. Vgl. Thomas WINKELBAUER, Oswald Redlich und die Geschichte der Habsburgermonarchie, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 117, 2009, S. 399–417.
26 Weltbühne Speyer. Die Ära der großen Staatsbesuche, hg. von Alexander SCHUBERT, Heidelberg/Ubstadt-Weiher/Basel 2016.
27 Hans Martin SCHALLER, Ein Brief über den Tod König Rudolfs von Habsburg, in: Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte. Peter Herde zum 65. Geburtstag, hg. von Karl BORCHARDT/Enno BÜNZ, Teil 2, Stuttgart 1998, S. 575–581, hier S. 580: Noscat itaque vestre paternitatis reverentia dominum regem Romanorum XVo die mensis Iulii decessisse, quadam enim per dies plurimos debilitate detentus, ex quadam occulta intrinsecus infirmitate gravatus, ex qua in lecto egritudinis non iacebat, sedendo in suo quietis solio et loquendo astantibus, in confessione devota recepto salutis viatico in civitate Spiren(si), ad quam de Gemersichim per Renum, qui inibi labitur, venerat, credens invenire aerem meliorem, quemadmodum placuit altissimo, exspiravit.
28 Manuel KAMENZIN, Die Tode der römisch-deutschen Könige und Kaiser (1147–1349), Phil. Diss. (masch.) Heidelberg 2017 [in Druckvorbereitung], S. 316–325, Kap. „Der gute Tod im hohen Alter: König Rudolf“.
29 Ellenhard, Chronicon, hg. von Philipp JAFFÉ, in: MGH. Scriptores, Bd. 17, Hannover 1861, S. 118–141, hier S. 134: Dominus enim Ruodolfus rex predictus a castro Germersheim se transtulit Spiram, in qua civitate Spirensi reges Romanorum ab antiquo consueverunt inhumari.
30 Ebenda: Sub cuius domini Ruodolfi felicis memorie vita et regimine tanta fuit pax in omnibus partibus Alemanie, etiam usque quo dominus Rudolfus spiritum contineret vite, quod tanta et talis pax in ipsa terra numquam fuit habita vel visa. Adhuc quievit omnis Alemania in conspectu eius et a facie sua timuit omnis homo; et statim cum ipse dominus Rudolfus diem suum clausisset extremum, rupta et dissoluta fuit pax generalis per totum Alemanie regnum ac si in eadem terra numquam pax exstitisset.
31 Ottokars Österreichische Reimchronik, 2 Teile, hg. von Joseph SEEMÜLLER (MGH. Deutsche Chroniken 5), Berlin 1890–1893, hier Teil 1, Verse 38995–39124, S. 507f.
32 Ottokars Reimchronik (wie Anm. 31), Verse 39125–39172, S. 508f.
33 http://www.justinus-kerner.de/index.php/gedichte/141-kaiser-rudolfs-ritt-zum-grabe (05.08.2018). Weitere Hinweise bei Erwin HEINZEL, Lexikon historischer Ereignisse und Personen in Kunst, Literatur und Musik, Wien 1956, S. 631–633.
34 Die Chronik des Mathias von Neuenburg, hg. von Adolf HOFMEISTER (MGH. Scriptores rerum Germanicarum, Nova Series 4), 2. Aufl. Berlin 1955, cap. 28, Fassung B, S. 45; WAU, S. 331. Die deutsche Übersetzung (geglättet und modernisiert) nach: Die Chronik des Mathias von Neuenburg, hg. von Georg GRANDAUR (Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit 84), 3. Aufl. Leipzig 1892, S. 31f.
35 Wolf SINGER, Wahrnehmen, Erinnern, Vergessen, in: Eine Welt – Eine Geschichte? 43. Deutscher Historikertag in Aachen, 26. bis 29. September 2000. Berichtsband, hg. von Max KERNER, München 2001, S. 18–27; Johannes FRIED, Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik, München 2004.
36 Anna-Dorothee von den BRINCKEN, Studien zur lateinischen Weltchronistik bis in das Zeitalter Ottos von Freising, Düsseldorf 1957; Hans-Werner GOETZ, Das Geschichtsbild Ottos von Freising. Ein Beitrag zur historischen Vorstellungswelt und zur Geschichte des 12. Jahrhunderts (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 19), Köln/Wien 1984; Hans-Werner GOETZ, Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im hohen Mittelalter (Orbis mediaevalis. Vorstellungswelten des Mittelalters 1), Berlin 1999.
37 Grundlegend jetzt Hans-Werner GOETZ, Gott und die Welt. Religiöse Vorstellungen des frühen und hohen Mittelalters, Teil 1, Band 1–3 (Orbis mediaevalis. Vorstellungswelten des Mittelalters 13.1–2, 16), Berlin 2011–2016.
38 Hans-Werner GOETZ, Die Wahrnehmung anderer Religionen und christlich-abendländisches Selbstverständnis im frühen und hohen Mittelalter (5.–12. Jahrhundert), 2 Bde., Berlin 2013. Vgl. Markus VÖLKEL, Geschichtsschreibung. Eine Einführung in globaler Perspektive, Köln/Weimar/Wien 2006; Hans LEHNER, Prophetie zwischen Eschatologie und Politik. Zur Rolle der Vorhersagbarkeit von Zukünftigem in der hochmittelalterlichen Historiografie (Historische Forschungen 29), Stuttgart 2015; Mittelalterliche Zukunftsgestaltung im Angesicht des Weltendes. Forming the Future Facing the End of the World in the Middle Ages, hg. von Felicitas SCHMIEDER (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 77), Köln/Weimar/Wien 2015; künftig: Zukunft im Mittelalter. Zeitkonzepte und Planungsstrategien, hg. von Klaus OSCHEMA/Bernd SCHNEIDMÜLLER [in Druckvorbereitung].
39 Karl LÖWITH, Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie, 6. Aufl. Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1973 [erstmals 1953].
40 Heinz MEYER, Die Enzyklopädie des Bartholomäus Anglicus. Untersuchungen zur Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte von ‚De proprietatibus rerum’ (Münstersche Mittelalter-Schriften 77), München 2000; Die Enzyklopädie im Wandel vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit, hg. von Christel MEIER (Münstersche Mittelalter-Schriften 78), München 2002; Joachim EHLERS, Die Ordnung der Geschichte, in: Ordnungskonfigurationen im hohen Mittelalter, hg. von Bernd SCHNEIDMÜLLER/Stefan WEINFURTER (Vorträge und Forschungen 64), Ostfildern 2006, S. 37–57; Bernd SCHNEIDMÜLLER, Die Ordnung von Welt und Geschichte, in: Aufbruch in die Gotik. Der Magdeburger Dom und die späte Stauferzeit, Bd. 1: Essays, hg. von Matthias PUHLE, Mainz 2009, S. 446–457.
41 Vincenz von Beauvais: Speculum quadruplex sive speculum maius. Naturale, doctrinale, morale, historiale, 4 Bde., Douai 1624, Neudruck Graz 1964–1965. Vgl. Monique PAULMIER-FOUCART/Marie-Christine DUCHESNE, Vincent de Beauvais et le Grand miroir du monde (Témoins de notre histoire), Turnhout 2004.
42 Zum Narrativ Bernd SCHNEIDMÜLLER, Konsens – Territorialisierung – Eigennutz. Vom Umgang mit spätmittelalterlicher Geschichte, in: Frühmittelalterliche Studien 39, 2005, S. 225–246. Die traditionelle Denkrichtung markierte Johannes HALLER, Die Epochen der deutschen Geschichte, 9. Aufl. Stuttgart/Urach 1950, S. 95: „Die Zeit, von der wir reden, erfreut sich bei den Gebildeten keiner hohen Wertschätzung. Man kann das niemand verargen. Der Mensch sucht auch in der Vergangenheit nach Erscheinungen – Personen und Vorgängen – die seine Aufmerksamkeit fesseln, sei es durch menschliche Züge oder durch die Größe und Folgenschwere des Geschehens. Das Kleine und Kleinliche stößt ab, es ermüdet und langweilt. Der deutschen Geschichte nach 1250 fehlt jeder große Zug. Wo er einmal sichtbar wird, wie etwa bei Albrecht I., da bleibt es bei einem Aufleuchten, hinter dem die Nacht nur um so dunkler erscheint. ‚Es kommt nichts dabei heraus‘ – das ist der Eindruck, den man bei all diesen fortwährenden Kämpfen und Streitigkeiten gewinnt.“ Vgl. Erich MEUTHEN, Gab es ein spätes Mittelalter?, in: Spätzeit. Studien zu den Problemen eines historischen Epochenbegriffs, hg. von Johannes KUNISCH (Historische Forschungen 42), Berlin 1990, S. 91–135.
43 Im Überblick Willi ERZGRÄBER, Europäisches Spätmittelalter (Neues Handbuch der Literaturwissenschaften 8), Wiesbaden 1978; Henning OTTMANN, Geschichte des politischen Denkens, Bd. 2/2: Das Mittelalter, Stuttgart/Weimar 2005; Jürgen MIETHKE, Politiktheorie im Mittelalter. Von Thomas von Aquin bis Wilhelm von Ockham, Tübingen 2008; Handbuch Chroniken des Mittelalters, hg. von Gerhard WOLF/Norbert H. OTT, Berlin/Boston 2016.
44 Markus SCHÜRER, Das Exemplum oder die erzählte Institution. Studien zum Beispielgebrauch bei den Dominikanern und Franziskanern des 13. Jahrhunderts (Vita regularis. Abhandlungen 23), Berlin 2005.
45 Julia BURKHARDT, Von Bienen lernen. Das Bonum universale de apibus des Thomas von Cantimpré als Gemeinschaftsentwurf (Analyse, Edition, Übersetzung, Kommentar), Habilitationsschrift (masch.) Heidelberg 2018 [in Druckvorbereitung].
46 Annales Colmarienses maiores, in: Annales Colmarienses (wie Anm. 2), S. 202–232, hier S. 208; deutsche Übersetzung (wie Anm. 2), S. 42f.
47 Ebenda, a. 1289, S. 216; Übersetzung S. 76.
48 Ebenda, a. 1289, S. 216; Übersetzung S. 78.
49 Chronicon Colmariense (wie Anm. 2), S. 253; Übersetzung S. 180f. Eine andere Traumvision des Herrn von Klingen S. 243; Übersetzung S. 154.
50 Weiterführende Hinweise bei Bernd SCHNEIDMÜLLER, Grenzerfahrung und monarchische Ordnung. Europa 1200–1500 (C.H.Beck Geschichte Europas), München 2011, S. 80–125. Vgl. Autorität und Akzeptanz. Das Reich im Europa des 13. Jahrhunderts, hg. von Werner BOMM/Hubertus SEIBERT/Verena TÜRCK, Ostfildern 2013.
51 Bernd SCHNEIDMÜLLER, Verantwortung aus Breite und Tiefe. Verschränkte Herrschaft im 13. Jahrhundert, in: König, Reich und Fürsten im Mittelalter. Abschlusstagung des Greifswalder „Principes-Projekts“. Festschrift für Karl-Heinz Spieß, hg. von Oliver AUGE (Beiträge zur Geschichte der Universität Greifswald 12), Stuttgart 2017, S. 115–148; Bernd SCHNEIDMÜLLER, Verklärte Macht und verschränkte Herrschaft. Vom Charme vormoderner Andersartigkeit, in: Macht und Herrschaft transkulturell. Vormoderne Konfigurationen und Perspektiven der Forschung, hg. von Matthias BECHER/Stephan CONERMANN/Linda DOHMEN (Macht und Herrschaft 1), Bonn 2018, S. 91–121.
52 Die Chronik des Mathias von Neuenburg (wie Anm. 34), cap. 24, Fassung B, S. 42; WAU, S. 329; deutsche Übersetzung, S. 28. Zur Geschichtsschreibung des 14. Jahrhunderts über Rudolf vgl. jetzt Katharina LICHTENBERGER, Mathias von Neuenburg und die Gegenwartschronistik des 14. Jahrhunderts im deutschen Südwesten, Phil. Diss. (masch.) Heidelberg 2017 [in Druckvorbereitung].
53 Die Chronik des Mathias von Neuenburg (wie Anm. 34), cap. 24, Fassung B, S. 40f.; WAU, S. 329; deutsche Übersetzung (wie Anm. 34), S. 27.
54 Bruno MEIER, Ein Königshaus aus der Schweiz. Die Habsburger, der Aargau und die Eidgenossenschaft im Mittelalter, Baden 2008; Peter FREY/Martin HARTMANN/Emil MAURER, Die Habsburg (Schweizerische Kunstführer, Serie 43, Nr. 425), 6. Aufl. Bern 1999.
55 Die Chronik des Mathias von Neuenburg (wie Anm. 34), cap. 13, Fassung B, S. 21f.; WAU, S. 320; deutsche Übersetzung (wie Anm. 34), S. 13.
56 Peter MORAW, Rudolf von Habsburg: Der ‚kleine‘ König im europäischen Vergleich, in: Rudolf von Habsburg 1273–1291 (wie Anm. 3), S. 185–208. Zum verfassungsgeschichtlichen Wandel des Spätmittelalters Peter MORAW, Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter 1250–1490, Frankfurt am Main/Berlin 1989; Peter MORAW, Über König und Reich. Aufsätze zur deutschen Verfassungsgeschichte des späten Mittelalters, hg. von Rainer Christoph SCHWINGES aus Anlaß des 60. Geburtstages von Peter Moraw am 31. August 1995, Sigmaringen 1995; Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im späteren Mittelalter, hg. von Peter MORAW (Vorträge und Forschungen 48), Stuttgart 2002. Zu Moraws Entwürfen: Stand und Perspektiven der Sozial- und Verfassungsgeschichte zum römisch-deutschen Reich. Der Forschungseinfluss Peter Moraws auf die deutsche Mediävistik, hg. von Christine REINLE (Studien und Texte zur Geistes- und Sozialgeschichte des Mittelalters 10), Affalterbach 2016. Vgl. auch Ernst SCHUBERT, König und Reich. Studien zur spätmittelalterlichen deutschen Verfassungsgeschichte (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 63), Göttingen 1979.
57 Vgl. den Beitrag von Martina STERCKEN in diesem Band.
58 Martin KAUFHOLD, Interregnum (Geschichte kompakt), Darmstadt 2002; Martin KAUFHOLD, Deutsches Interregnum und europäische Politik. Konfliktlösungen und Entscheidungsstrukturen 1230–1280 (MGH. Schriften 49), Hannover 2000.
59 Karl HAMPE, Herrschergestalten des deutschen Mittelalters, 6. Aufl. Heidelberg 1955 [1. Aufl. Leipzig 1927; 1955 erschien eine 7. Aufl. unverändert zur 6., 1979 ein Nachdruck bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft], S. 216–247, Zitat S. 247. Vgl. Folker REICHERT, Gelehrtes Leben. Karl Hampe, das Mittelalter und die Geschichte der Deutschen (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 79), Göttingen 2009.
60 Die Chronik des Mathias von Neuenburg (wie Anm. 34), cap. 14, Fassung B, S. 23; WAU, S. 321; deutsche Übersetzung (wie Anm. 34), S. 15.
61 Chronicon Colmariense (wie Anm. 2), S. 241. Deutsche Übersetzung: Annalen und Chronik von Kolmar (wie Anm. 2), S. 147.
62 Michael MENZEL, Die Zeit der Entwürfe 1273–1347 (Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, Zehnte, völlig neu bearbeitete Auflage 7a), Stuttgart 2012; Ute RÖDEL, Königliche Gerichtsbarkeit und Streitfälle der Fürsten und Grafen im Südwesten des Reiches 1250–1313 (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 5), Köln/Wien 1979; Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451, Band 3: Die Zeit Rudolfs von Habsburg 1273–1291, bearbeitet von Bernhard DIESTELKAMP/Ute RÖDEL (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich. Sonderreihe), Köln/Wien 1986; Alois GERLICH, Studien zur Landfriedenspolitik König Rudolfs von Habsburg, Mainz 1963; Ulrike KUNZE, Rudolf von Habsburg. Königliche Landfriedenspolitik im Spiegel zeitgenössischer Chronistik (Europäische Hochschulschriften III 895), Frankfurt am Main 2001; Christel Maria von GRAEVENITZ, Die Landfriedenspolitik Rudolfs von Habsburg (1273–1291) am Niederrhein und in Westfalen (Rheinisches Archiv 146), Köln/Weimar/Wien 2003; Fred SCHWIND, Die Landvogtei in der Wetterau. Studien zu Herrschaft und Politik der staufischen und spätmittelalterlichen Könige (Schriften des Hessischen Landesamtes für geschichtliche Landeskunde 35), Marburg 1972; Thomas Michael MARTIN, Die Städtepolitik Rudolfs von Habsburg (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 42), Göttingen 1976.
63 Bernd SCHNEIDMÜLLER, Konsensuale Herrschaft. Ein Essay über Formen und Konzepte politischer Ordnung im Mittelalter, in: Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw, hg. von Paul-Joachim HEINIG/Sigrid JAHNS/Hans-Joachim SCHMIDT/Rainer Christoph SCHWINGES/Sabine WEFERS (Historische Forschungen 67), Berlin 2000, S. 53–87; Egon BOSHOF, Hof und Hoftag König Rudolfs von Habsburg, in: Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag (wie Anm. 56), S. 387–415. Vgl. Gerhard DILCHER, Konsens, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 3, 2. Aufl. Berlin 2016, Sp. 109–117.
64 Jörg PELTZER, Der Rang der Pfalzgrafen bei Rhein. Die Gestaltung der politisch-sozialen Ordnung des Reichs im 13. und 14. Jahrhundert (RANK. Politisch-soziale Ordnungen im mittelalterlichen Europa 2), Ostfildern 2013.
65 MGH. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, Bd. 3: 1273–1298, hg. von Jakob SCHWALM, Hannover 1904–1906, Nr. 72, S. 59–61. Deutsche Übersetzung: Quellen zur Verfassungsgeschichte des römisch-deutschen Reiches im Spätmittelalter (1250–1500), hg. von Lorenz WEINRICH (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 33), Darmstadt 1983, Nr. 26, S. 108–115. Vgl. den Beitrag von Martin KAUFHOLD in diesem Band.
66 Dieter MERTENS, Die Habsburger als Nachfahren und als Vorfahren der Zähringer, in: Die Zähringer. Eine Tradition und ihre Erforschung, hg. von Karl SCHMID (Veröffentlichungen zur Zähringer-Ausstellung 1), Sigmaringen 1986, S. 151–174, hier S. 156f.
67 Thomas ZOTZ, Die Zähringer. Dynastie und Herrschaft (Urban Taschenbücher 776), Stuttgart 2018; Die Zähringer. Rang und Herrschaft um 1200, hg. von Jürgen DENDORFER/Heinz KRIEG/R. Johanna REGNATH (Veröffentlichungen des Alemannischen Instituts Freiburg i. Br. 85), Ostfildern 2018.
68 Siehe Anm. 2.
69 Zur Bedeutung der habsburgischen Tochterstämme für die spätmittelalterliche Dynastiegeschichte Armin WOLF, Verwandtschaft – Erbrecht – Königswahlen. Sieben neue und 26 aktualisierte Beiträge. Mit einem Geleitwort von Eckart HENNING, 2 Halbbände (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 283.1–2), Frankfurt am Main 2013.
70 Chronicon Colmariense (wie Anm. 2), S. 243; Übersetzung: Annalen und Chronik von Kolmar (wie Anm. 2), S. 153.
71 Die Chronik des Mathias von Neuenburg (wie Anm. 34), cap. 13, Fassung B, S. 22, WAU, S. 320; deutsche Übersetzung (wie Anm. 34), S. 14.
72 Die Annalen des Tholomeus von Lucca in doppelter Fassung nebst Teilen der Gesta Florentinorum und Gesta Lucanorum, hg. von Bernhard SCHMEIDLER (MGH. Scriptores rerum Germanicarum, Nova Series 8), Berlin 1930, S. 173f. Dazu Dieter MERTENS, Die Habsburger (wie Anm. 66), S. 154f.
73 Die Chronik des Mathias von Neuenburg (wie Anm. 34), cap. 2, Fassung B, S. 9f.; WAU, S. 314; deutsche Übersetzung (wie Anm. 34), S. 4.
74 Die Chronik des Mathias von Neuenburg (wie Anm. 34), cap. 1, Fassung B, S. 8f.; WAU, S. 313f.; deutsche Übersetzung (wie Anm. 34), S. 3f.
75 Quellen zur Geschichte der Welfen und die Chronik Burchards von Ursberg, hg. von Matthias BECHER (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters 18b), Darmstadt 2007, cap. 2, S. 36/37; vgl. Bernd SCHNEIDMÜLLER, Die Welfen. Herrschaft und Erinnerung (819–1252) (Urban-Taschenbücher 465), 2. Aufl. Stuttgart 2014, S. 23–28.
76 Duo igitur erant fratres Ottoni imperatori tercio specialiter cari ex nobili et illustri Romanorum prosapia et progenie procreati, videlicet Ursinorum, qui usque in hodiernum diem inter nobiliores et potenciores in urbe Romana reputantur. Hii duo fratres cum predicto imperatore ad partes citramontanas venerunt. Die Chronik der Grafen von der Mark von Levold von Northof, hg. von Fritz ZSCHAECK (MGH. Scriptores rerum Germanicarum, Nova Series 6), Berlin 1929, S. 13; wiederholt von Levold von Northof, Genealogia comitum de Marka, ebenda, S. 100; vgl. Stefan PÄTZOLD, Levold konstruiert ein Adelshaus. Die Grafen von der Mark in der Chronik des Levold von Northof, in: Westfälische Zeitschrift 166, 2016, S. 27–41.
77 Die Chronik des Mathias von Neuenburg (wie Anm. 34), cap. 8, Fassung B, S. 14f.; WAU, S. 316f.; deutsche Übersetzung (wie Anm. 34), S. 8.
78 Chronicon Colmariense (wie Anm. 2), S. 248f.; deutsche Übersetzung in Annalen und Chronik von Kolmar (wie Anm. 2), S. 169f.
79 Aeneas Silvius Piccolomini, Historia Bohemica. hg. von Joseph HEJNIC/Hans ROTHE. Bd. 1: Historisch-kritische Ausgabe des lateinischen Textes, besorgt von Joseph HEJNIC, mit einer deutschen Übersetzung von Eugen UDOLPH (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte NF B 20, 1), Köln/Weimar/Wien 2005, S. 171–175. Dort noch der Spott der Ehefrau, die den König schalt, er habe Böhmen zur Sklavin gemacht.
80 Franz GRILLPARZER, König Ottokars Glück und Ende. Trauerspiel in fünf Aufzügen, benutzte Ausgabe: Universal-Bibliothek 4382, Stuttgart 1966, Dritter Aufzug, S. 67.
81 MGH. Constitutiones, Bd. 3 (wie Anm. 65), Nr. 164, 225–227, 229, 340–342, 356, 357, 374, 393, 657–663.
82 Ebenda, Nr. 44, 114, 144, 165, 223, 282, 286, 355, 422, 424, 438, 444.
83 Ebenda, Nr. 656.
84 Ebenda, Nr. 339. Die Willebriefe und Konsensakte der sechs Königswähler dort Nr. 340–342.
85 Ebenda, Nr. 344. Vgl. Max WELTIN, König Rudolf und die österreichischen Landherren, in: Rudolf von Habsburg 1273–1291 (wie Anm. 3), S. 103–123. Vgl. den Beitrag von Christina LUTTER in diesem Band.
86 Dietmar WILLOWEIT, Landesteilungen, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 3, 2. Aufl. Berlin 2016, Sp. 463–468; Gudrun PISCHKE, Die Landesteilungen der Welfen im Mittelalter (Veröffentlichungen des Instituts für Historische Landesforschung der Universität Göttingen 24), Hildesheim 1987; Heinz-Dieter HEIMANN, Hausordnung und Staatsbildung. Innerdynastische Konflikte als Wirkungsfaktoren der Herrschaftsverfestigung bei den wittelsbachischen Rheinpfalzgrafen und den Herzögen von Bayern. Ein Beitrag zum Normenwandel in der Krise des Spätmittelalters (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte NF 16), Paderborn/München/Wien/Zürich 1993; Jörg ROGGE, Herrschaftsweitergabe, Konfliktregelung und Familienorganisation im fürstlichen Hochadel. Das Beispiel der Wettiner von der Mitte des 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 49), Stuttgart 2002.
87 Die Chronik der Grafen von der Mark von Levold von Northof (wie Anm. 76), S. 10.
88 MGH. Constitutiones, Bd. 11: Dokumente zur Geschichte des deutschen Reiches und seiner Verfassung 1354–1356, bearb. v. Wolfgang D. FRITZ, Weimar 1978–1992, S. 535–633, hier S. 562.
89 Bernd SCHNEIDMÜLLER, Verantwortung (wie Anm. 51); Bernd SCHNEIDMÜLLER, Verklärte Macht (wie Anm. 51). Zu fürstlichen Handlungsspielräumen Oliver AUGE, Handlungsspielräume fürstlicher Politik im Mittelalter. Der südliche Ostseeraum von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis in die frühe Reformationszeit (Mittelalter-Forschungen 28), Ostfildern 2009. Vgl. auch Christian VOGEL, Zur Rolle der Beherrschten in der mittelalterlichen Herrschaftslegitimation (Studia humaniora 45), Düsseldorf 2011.
90 Folker REICHERT, Landesherrschaft, Adel und Vogtei. Zur Vorgeschichte des spätmittelalterlichen Ständestaates im Herzogtum Österreich (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 23), Köln/Wien 1985; Maximilian WELTIN, Das Land und sein Recht. Ausgewählte Beiträge zur Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter, hg. von Folker REICHERT/Winfried STELZER (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband 49), Wien/München 2006. Vgl. auch Herrschaft und Stand. Untersuchungen zur Sozialgeschichte im 13. Jahrhundert, hg. von Josef FLECKENSTEIN (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 51), Göttingen 1977.
91 Martin PILCH, Der Rahmen der Rechtsgewohnheiten. Kritik des Normensystemdenkens entwickelt am Rechtsbegriff der mittelalterlichen Rechtsgeschichte, Wien/Köln/Weimar 2009.
92 Die Performanz der Mächtigen. Rangordnung und Idoneität in höfischen Gesellschaften des späten Mittelalters, hg. von Klaus OSCHEMA/Cristina ANDENNA/Gert MELVILLE/Jörg PELTZER (RANK. Politisch-soziale Ordnungen im mittelalterlichen Europa 5), Ostfildern 2015; Gerd ALTHOFF, Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt 2003.
93 Stefan WEINFURTER, Der Papst weint. Argument und rituelle Emotion von Innocenz III. bis Innocenz IV., in: Die Spielregeln der Mächtigen. Mittelalterliche Politik zwischen Gewohnheit und Konvention, hg. von Claudia GARNIER/Hermann KAMP, Darmstadt 2010, S. 121–132.
94 Jacques LE GOFF, Das Lachen im Mittelalter. Aus dem Französischen von Jochen GRUBE, Stuttgart 2004; Stefan BIESSENECKER, Das Lachen im Mittelalter. Soziokulturelle Bedingungen und sozial-kommunikative Funktionen einer Expression in den „finsteren Jahrhunderten“, Bamberg 2012; Seliges Lächeln und höllisches Gelächter. Das Lachen in Kunst und Kultur des Mittelalters, hg. von Winfried WILHELMY (Publikationen des Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseums Mainz 1), Regensburg 2012.
95 Die Chronik des Mathias von Neuenburg (wie Anm. 34), cap. 25, Fassung B, S. 42f.; WAU, S. 330; deutsche Übersetzung (wie Anm. 34), S. 29.