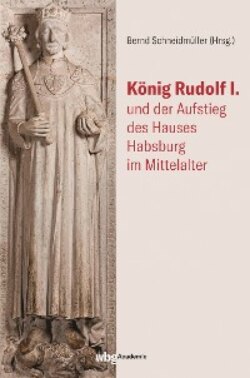Читать книгу König Rudolf I. und der Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter - Группа авторов - Страница 7
ОглавлениеDom zu Speyer
Zum Geleit: Das Haus Habsburg und der Kaiserdom zu Speyer
König Rudolf I. von Habsburg wurde nach seinem Tod am 15. Juli 1291 in der Herrschergrablege des Kaiserdomes zu Speyer bestattet. Es war sein ausdrücklicher Wunsch, dort seine letzte Ruhe zu finden. Als Grabstätte der salischen und der nachfolgenden staufischen und habsburgischen Herrscher gilt dieser Ort als Wahrzeichen des mittelalterlichen Kaiser- und Königtums.
In der Vorkrypta des Domes, vertikal an der Wand, befindet sich eine vermeintliche Grabplatte, die den Habsburger Herrscher darstellt. Bis zur Aufhängung im Zuge des Umbaus der Vorkrypta befand sie sich liegend auf einem Sockel in der Vierungskrypta. Die Tradition sagt, dass das Epitaph noch zu Lebzeiten des Herrschers gefertigt worden sei und daher dessen getreues Antlitz abbilde.
Im 19. Jahrhundert galt Rudolf von Habsburg geradezu „als das Urbild des frommen Königs, an dem sich das ideale Verhältnis zwischen weltlicher und kirchlicher Macht beispielhaft demonstrieren ließ“ (Zink). Dem trägt die Vorhalle des Domes Rechnung. Die Ausgestaltung des Raum-Inneren mit Skulpturenschmuck, den das österreichische Kaiserhaus einst finanzierte, würdigt mehrfach den Habsburger Herrscher. Alle Bildwerke entstanden im Jahr der Fertigstellung des Westbaues 1858.
In den Wandnischen stehen die Statuen der acht im Dom bestatteten Kaiser und Könige. Die Nischenfigur rechts vom Stufenportal stellt Rudolf I. in königlichem Ornat dar, in Stein gemeißelt von dem Schwanthaler-Schüler Anton Fernkorn (1813–1878). Geschichten aus dem Leben des Habsburgers erzählen drei der vier darüber angeordneten Lünetten-Reliefs. Nach der Darstellung der Grundsteinlegung des Domes durch Konrad II. beginnt die Rudolph-Vita. Der König überlässt sein Pferd einem Geistlichen, der die Monstranz mit dem Allerheiligsten trägt (Nordseite, östliches Bogenfeld). Auf der gegenüberliegenden Seite folgt eine Szene, welche die deutschen Fürsten darstellt, die vor Rudolf den Lehenseid schwören. Da ihm dafür das Zepter Karls des Großen fehlt, greift er zum Altar und erhebt das Kreuz. Der Zyklus endet mit der Übertragung der Königswürde auf Rudolf (Südseite, westliches Bogenfeld). Die vier Lünetten-Reliefs schuf der österreichische Bildhauer Vincenz Pilz (1816–1896).
Den Blickfang der Vorhalle bildet heute das mächtige Kenotaph Rudolfs I. von Habsburg im Südflügel. Das Standbild, Ausdruck für die enge Beziehung des Hauses Habsburg zum Dom, stand ursprünglich im Innern des Domes auf der Südseite des sogenannten Königschores, mit Blickrichtung zum Hochaltar. Es wurde im Auftrag König Ludwigs I. von Bayern im Jahr 1843 von dem Münchner Bildhauer Ludwig Schwanthaler (1802–1848) geschaffen.
Am 1. Mai 1218 wurde Rudolf von Habsburg geboren. Die 800. Wiederkehr des Geburtstags nahm die »Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer« zum Anlass für ihr viertes internationales Wissenschaftliches Symposium vom 11. bis 13. April 2018 im Sitzungssaal des Stadtrates der Stadt Speyer. Titel und Thema waren: „König Rudolf I. und der Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter“. Mehr als zwanzig Referentinnen und Referenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beleuchteten und diskutierten die verschiedensten Aspekte der Herrschaft des ersten Habsburgers im römisch-deutschen Reich, unter anderem die Beziehung Rudolfs zu Speyer und den Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter bis hin zu Weltgeltung.
Öffentliche Aufmerksamkeit erregte die Debatte über die mittelalterliche Grabplatte Rudolfs von Habsburg. Die bisherige Annahme, bei dem europaweit geschätzten Denkmal handele es sich um die wirklichkeitsgetreue Darstellung Rudolfs geriet ins Wanken. Nach dem Auffinden der Platte 1811 wurde sie aufgrund ihrer starken Beschädigung mehrfach ausgebessert. An welchen Stellen genau sie ergänzt wurde und wieviel noch original erhalten ist, das wissen wir nicht. Auch ihre Funktion ist unklar. Um weiterführende Erkenntnisse über das Denkmal zu erhalten, wurde bei der Tagung angeregt, die Platte zu röntgen und die Binnenstruktur und insbesondere das Gesicht intensiv zu untersuchen. Die Grabplattenfrage ist eines von vielen Ergebnissen der Tagung der »Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer«, die uns weiter beschäftigen wird.
Die »Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer« hat die wissenschaftliche Erforschung des Domes zu Speyer als Aufgabe in ihrer Satzung verankert. Daher war es eine Selbstverständlichkeit, sich diesem wichtigen Thema zu widmen und die Tagung mit besonderem Engagement zu organisieren und auszurichten. Bewusst veranstaltet die Stiftung in der Regel ihre Wissenschaftlichen Symposien öffentlich, um möglichst vielen interessierten Menschen eine Partizipation zu ermöglichen.
Die Ergebnisse aller vier Wissenschaftlichen Symposien, die die »Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer« realisierte, liegen nun als Tagungsbände bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt (WBG) vor: „Salisches Kaisertum und neues Europa in der Zeit Heinrichs IV. und Heinrichs V.“ (2007), „Der Dom zu Speyer. Konstruktion, Funktion und Rezeption zwischen Salierzeit und Historismus“ (2013) und „Johann Baptist Schraudolph, die Nazarener und die Speyerer Domfresken“ (2014).
Unser Dank gilt den Referentinnen und Referenten dafür, dass sie ihre Vorträge schriftlich gefasst haben und die Aufsätze nun in dieser Publikation vorliegen. Wir sind sehr dankbar, dass Prof. Dr. Bernd Schneidmüller, Heidelberg, die Aufgabe übernahm, die Ergebnisse des Symposiums zusammenzutragen und in einem Tagungsband vorzulegen. Dank gilt der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt, mit der wir seit Jahren partnerschaftlich verbunden sind, für die erneute verlegerische Initiative.
Wir wünschen dem Band eine weite Verbreitung und eine lebhafte Diskussion über die wissenschaftlichen Aufsätze.
Für die
»Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer«
| Prof. Dr. Peter FrankenbergVorsitzender des Vorstands | Karl-Markus RitterGeschäftsf. Vorstandsmitglied |
Muttergottes, Jesuskind, Doppeladler, Dom zu Speyer, Westportal, 19. Jahrhundert