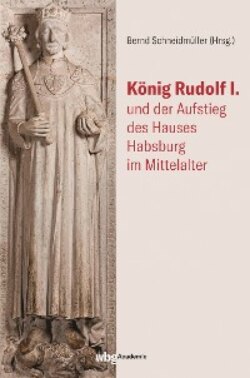Читать книгу König Rudolf I. und der Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter - Группа авторов - Страница 8
BERND SCHNEIDMÜLLER König Rudolf I. und der Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter
Zur Einführung
ОглавлениеAm 1. Mai 1218 wurde Rudolf von Habsburg als Grafensohn geboren. Im Juli 1291 fand er als römischer König seine letzte Ruhestätte in der Herrschergrablege der Kathedrale zu Speyer. Diese Beisetzung unterstrich programmatisch die monarchische Verbundenheit mit früheren salischen und staufischen Königen und Kaisern, die im Speyerer Mariendom bestattet waren. Rudolfs Entscheidung eröffnete dort eine letzte Phase herrscherlicher Bestattungen an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert.
Als gräflicher Aufsteiger setzte König Rudolf nach seiner Königswahl 1273 alles daran, seine Familie in der Gruppe der Reichsfürsten zu etablieren. Für seine Söhne und Töchter knüpfte er erfolgreich Eheverbindungen mit den führenden Fürstenfamilien des Reichs. Viele Dynastien Europas sollten sich später auf Rudolf von Habsburg als Vorfahren zurückführen. Zudem gab die Lehnsordnung des Reichs ihm als König im Bund mit den Fürsten die Möglichkeit, seine Söhne mit herzoglichen Würden auszustatten. Trotz aller gezielten Förderung lag die Regelung der Thronfolge aber nicht in der Handlungsmacht des Königs. Seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts hatten die Fürsten ihr Recht auf die Königswahl so erfolgreich etabliert, dass es zwischen 1254 und 1500 überhaupt nur zu zwei direkten Sohnesfolgen kam. Deshalb konnte Rudolf von Habsburg weder planen noch ahnen, zum ‚Stammvater‘ einer der berühmtesten europäischen Herrscherdynastien zu werden. Trotzdem erlangten bereits sein Sohn Albrecht I. (1298–1308)1 und sein Enkel Friedrich (‚der Schöne‘, 1314–1330) – wenn auch nach zeitlichen Zäsuren oder in politischen Anfechtungen – das römischdeutsche Königtum.
Danach sollte es mehr als ein Jahrhundert dauern, bis die Habsburger – nach der Königsherrschaft von Wittelsbachern und Luxemburgern – seit 1438 endgültig und nachhaltig die Königs- oder Kaiserwürde behaupteten. Ihre Kontinuität wurde bis zum Ende des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation 1806 nur kurz durch ein wittelsbachisches Intermezzo unter Kaiser Karl VII. (1742–1745) unterbrochen. Von 1804 bis 1918 regierten die Habsburger dann als Herrscher über das österreichische Kaiserreich wie über ein Konglomerat von Reichen und Würden in Mittel-, Ostmittel- und Südosteuropa.
Dieses Buch verfolgt drei Ziele. Es will die Persönlichkeit Rudolfs von Habsburg würdigen und seinen Aufstieg zum Königtum in die Geschichte des 13. Jahrhunderts einbetten. Das besondere Verhältnis von Domkirche, Bistum und Stadt Speyer zu den habsburgischen Königen bildet den zweiten Schwerpunkt. Und schließlich wird der Aufstieg des Hauses Habsburg vom 13. Jahrhundert bis zur weltumspannenden Herrschaft Kaiser Maximilians I. (1486–1519) und Kaiser Karls V. (1519–1556/58, † 1558) im 16. Jahrhundert in den wichtigen Etappen präsentiert.
Im Bund mit den Reichsfürsten propagierte Rudolf nach seiner Königswahl ganz programmatisch die Ehre und Wiederherstellung des Reichs (dazu Martin Kaufhold in diesem Band). Doch diese Kontinuitätsbehauptung verdeckte viele Sprünge und Andersartigkeiten. Tatsächlich wollte die Orientierung an den mittlerweile glorifizierten Staufern der Legitimation eines eher ungewöhnlichen Königtums dienen, das sich zudem im Kampf gegen den mächtigsten Rivalen bei der Königswahl, König Ottokar II. von Böhmen (1253–1278), erst behaupten musste. Dass Rudolf und die Fürsten beschlossen, das Jahr 1245 als Orientierungsmarke von Rechtmäßigkeit im Reich herauszustreichen, wollte alle späteren Vergaben von Reichsgut ohne Zustimmung der Fürsten brandmarken. Im Jahr 1245 hatte das Erste Konzil von Lyon auf Betreiben Papst Innocenz’ IV. (1243–1254) den staufischen Kaiser Friedrich II. (1212–1250) offiziell abgesetzt, mitten im Kampf zwischen Kaiser und Papst um Vorrang in der lateinischen Christenheit. Der Epochenkonflikt spaltete die Papstkirche und die Adelsgesellschaft im römischdeutschen Reich wie im süditalienischen Königreich Sizilien. Man bezeichnete diesen Zwist, der Familien zerriss und mit blutiger Schärfe ausgetragen wurde, etwas hochtrabend als ‚Endkampf der Staufer‘. Nach dem Tod Kaiser Friedrichs II. konnte sein Sohn Konrad IV. (1237/50–1254) tatsächlich nur kurzzeitig als römisch-deutscher König herrschen. Auch die anderen Behauptungsversuche der staufischen Familie scheiterten, zuletzt der Italienzug von Friedrichs Enkel Konradin, der 1268 in Neapel hingerichtet wurde.
In den Auseinandersetzungen der 1240er Jahre hatten papsttreue Staufergegner Landgraf Heinrich Raspe von Thüringen (König 1246–1247) und dann Graf Wilhelm von Holland (König 1248–1256) zu römischen Königen oder – je nach politischem Standpunkt – ‚Gegenkönigen‘ gewählt. Ihrer Opposition gegen die Staufer war keine dynastische Nachhaltigkeit beschert. Auch die strittige Königswahl von 1257, in der König Alfons X. von Kastilien und León († 1284) und der englische Königssohn Richard (von Cornwall, † 1272) zu Königen des römisch-deutschen Reichs erhoben wurden, löste die Frage einer rechtmäßigen Monarchie nicht. Früher wurden diese Jahre als ‚Interregnum‘ oder gar als die „kaiserlose, die schreckliche Zeit“ angesprochen. Einen Kaiser gab es tatsächlich seit 1245 (Absetzung Friedrichs II.) oder 1250 (Tod Friedrichs II.) nicht mehr. Doch die Bezeichnung als herrscherlose Zeit oder als Zwischenzeit ist falsch: Es gab eher zu viele als zu wenige Könige. Gleichwohl gelang ihnen die effektive Machtausübung im römischdeutschen Reich nicht.
Wechselt man die Betrachtungsperspektiven von einer kraftvollen nationalen Monarchie zum Reiz offener imperialer Experimente oder zur Bedeutungssteigerung, welche die Glieder des Reichs damals erfuhren, so verschieben sich die historischen Urteile. In der Mitte des 13. Jahrhunderts lernten die Fürsten, Verantwortung für das Reich zu übernehmen und diese mit adligen Herren, Ministerialen oder mit städtischen Eliten zu teilen. Die königlichen Städte erlangten mit dem Untergang der Staufer endlich jene Autonomie, die sich Bischofsstädte schon Generationen zuvor erkämpft hatten. Die Spitzengruppe der Reichsministerialität, bisher in Abhängigkeit von ihren königlichen Herren gehalten, nahm nun selbstbewusst ihre Zukunft in die Hand und stieg in den niederen Adel auf. Unter solchen Vorzeichen darf man die Jahre zwischen 1245 und 1273 als innovationsfreudige Epoche in der Sozialgeschichte des Mittelalters ansprechen. Nur die Liebhaber der Zentralgewalt oder des Durchregierens vermochten in dieser Zeit keine Lichtblicke zu erkennen.
Die ältere nationale Geschichtsschreibung verkannte zudem die interessante Neuausrichtung imperialer Ideen und Praktiken im 13. Jahrhundert. Kaiser Heinrich VI. (1190–1197), der Sohn Friedrich Barbarossas (1152–1190), hatte im ausgehenden 12. Jahrhundert das unteritalienische Königreich Sizilien als Erbe seiner Gemahlin Konstanze († 1198) erobert. Hier erschloss sich den letzten Herrschern aus staufischem Haus eine ganz neue Erfahrungs- und Lebenswelt. Das Mittelmeerkaisertum Friedrichs II. unterschied sich beträchtlich von der Imperialität römisch-deutscher Könige des 11. und 12. Jahrhunderts. Programmatisch fügte Friedrich II. dem Titel eines Kaisers der Römer in seinen urkundlichen Selbstaussagen den Königstitel von Sizilien und Jerusalem hinzu. Auch wenn sich seine Herrschaft weiterhin im Land nördlich der Alpen entfaltete, können die neue mediterrane Schwerpunktsetzung und die Universalisierung von Kaisertum und Reich kaum unterschätzt werden. Vor solchem Hintergrund standen die – durchaus auch verwandtschaftlich-dynastisch begründeten – Wahlentscheidungen von 1257 für Alfons (von Kastilien) oder für Richard (von Cornwall) in Traditionslinien staufischer Imperialität. Wer diese Herrscher als ‚Ausländer‘ ansprach, der verkannte die Denkwelten des 13. Jahrhunderts.
Die Zäsur erfolgte tatsächlich erst mit den Königswahlen seit 1273. Jetzt erwuchs das römische Königtum endgültig zum Handlungsfeld des deutschen Adels. Deshalb war das Reich, das Rudolf und die Fürsten wiederherstellen wollten, kaum das Mittelmeerimperium Friedrichs II. Es handelte sich eher um eine vergangenheitsgestützte Neukonstruktion, die sich aus vagen Erinnerungen an das 10. bis 12. Jahrhundert speiste. Die Schaffung einer neuen, wenngleich traditionsgestützten oligarchischen Ordnung von König und Fürsten diente dann faktisch der habsburgischen Durchsetzung im Reich. Die neue Systematisierung von Rechtssprüchen über das Verhältnis von König und Reich oder die Fixierung einer Konsensherrschaft von König und Wahlfürsten stellten die Weichen für eine spätmittelalterliche Zukunft der Monarchie.
Rudolf von Habsburg war wahrlich nicht der ‚kleine Graf‘, als den ihn sein königlicher Rivale Ottokar von Böhmen verspottete. Vielmehr gehörte er zu den gräflichen Eliten des Südwestens und durfte auf erhebliche Macht und beträchtlichen Besitz in der heutigen Nordschweiz und im Land beiderseits des südlichen Oberrheins bauen (dazu der Beitrag von Martina Stercken). Seine politische Prägung hatte der heranwachsende Rudolf noch im Umfeld der Staufer erhalten. Ob die spätere Erinnerung des 14. Jahrhunderts, dass Friedrich II. 1218 als Rudolfs Taufpate fungierte, stimmt oder nur als nachträgliche Traditionskonstruktion angesprochen werden muss, lässt sich auf Grund der vereinzelten Quellennennung nicht sicher klären.
Die Geschichtsschreibung des 13. und des 14. Jahrhunderts ließ den neuen König Rudolf in ungewöhnlich zahlreichen Anekdoten als ganz besondere Persönlichkeit hervortreten (dazu der Beitrag von Bernd Schneidmüller). Ob diese Erzählstrategien Wirklichkeit einfingen oder der Propagierung endlich erreichter politischer Sicherheit dienten, kann nicht wirklich entschieden werden. Unstrittig bleibt, dass Rudolf beständig als ein König ‚zum Anfassen‘ begegnet. Damit entstand das Bild eines geradlinigen, gleichsam folgerichtigen Aufstiegs vom Grafen zum König. Diese Vernachlässigung von Kontingenz greift allerdings zu kurz. Rudolf war nach Landgraf Heinrich Raspe und Wilhelm von Holland zwar nicht der erste Graf, der zum Königtum aufstieg, und er sollte auch nicht der letzte bleiben. Noch seine Nachfolger Adolf (von Nassau, König 1292–1298) und Heinrich (von Luxemburg, König 1308–1313) wurden als Grafen zu römisch-deutschen Königen gewählt. Der letzte Versuch einer Grafenwahl (Günther von Schwarzburg) scheiterte 1349. Und doch bleibt die erfolgreiche Durchsetzung eines Grafen aus dem Südwesten des Reichs im Jahr 1273 in einem von Fürsten dominierten Reich erstaunlich. Vielleicht war sie nur das Ergebnis einer sehr zufälligen Patt-Situation unter den Eliten des Reichs?
Wie immer man den Zufall der Königswahl beurteilt – Rudolf nutzte beherzt die Spielräume der Monarchie zur Herstellung von Kontinuität und zeichenhafter Rechtmäßigkeit (dazu der Beitrag von Andreas Büttner) sowie zur Beförderung seiner Nachkommen zu herzoglichen Würden in Österreich (dazu der Beitrag von Christina Lutter). Speyer war und blieb in besonderer Weise mit Rudolfs Königtum verbunden, sowohl das Bistum und das Domkapitel (dazu der Beitrag von Gerhard Fouquet) als auch die Stadtgemeinde (dazu der Beitrag von Kurt Andermann). Deshalb ist das Historische Museum Speyer gut beraten, das historische Gedächtnis an Rudolf und an die Habsburger neu zu präsentieren (dazu der Beitrag von Alexander Schubert).
1291 wurde die Speyerer Königsgrablege als der angemessene Bestattungsort eines Königs angesprochen (dazu der Beitrag von Manuel Kamenzin). Die Patrone dieses Doms dienten den Herrschern seit Generationen als Fürsprecher vor Gott (dazu der Beitrag von Benjamin Müsegades). Mit dem Dom verbanden sich auch später besondere habsburgische Erinnerungsbilder. Ein einzigartiges Gedächtnismal der Kaiser gelangte unter Kaiser Maximilian I. nicht zur Vollendung, offenbart aber selbst in den erhaltenen Fragmenten noch die Kraft der Memoria (dazu der Beitrag von Gabriele Köster). Rudolfs (vermeintliche) Grabplatte, wie sie heute in der Krypta des Speyerer Doms steht, prägte seit langem das neuzeitliche Bild des Königs. Durch unzählige Abbildungen verbreitet und auch auf dem Umschlag dieses Buchs erneut abgedruckt, entstand das Image eines idealen habsburgischen Herrschers aus dem 13. Jahrhundert. Neuerdings steht aber fast alles wieder in Frage: der ursprüngliche Zweck der Bildnisplatte, ihre Geschichte und ihre ‚Echtheit‘ im Detail. Vielleicht modellierten erst neuzeitliche Restauratoren Rudolfs Bildnis aus späteren Versatzstücken seiner Nachkommen zusammen? Vielleicht erstand der ‚Rudolf im Dom‘ nur als Bild-Kollage? Vielleicht sehen wir das Herrschergesicht wie den Herrscherkörper nur als beständige Verformungen eines Originals, dessen mittelalterliche Wirklichkeit verloren ist (dazu der Beitrag von Matthias Müller)? Die neuesten Debatten verlangen geradezu nach exakten Materialuntersuchungen, die uns die imaginative Wucht neuzeitlicher ‚Zutaten‘ deutlich machen könnten.
Rudolfs Königtum verwandelte seine Familie, machte sie langfristig königsfähig, ließ sie in die fürstlichen Eliten des Reichs aufsteigen, gab ihr neue Entfaltungsräume im Südosten wie im Südwesten des Reichs (dazu die Beiträge von Christina Lutter und Dieter Speck). Hier wie dort traten die Habsburger im 14. und im 15. Jahrhundert als Universitätsgründer hervor (dazu der Beitrag von Christian Lackner). Wie deutlich die Habsburger ganz oben angekommen waren, zeigen ihre Eheschließungen, deren bündnisstiftender Charakter immer wieder als glückliche Friedenspolitik angesprochen wurde (dazu der Beitrag von Julia Hörmann-Thurn und Taxis).
Im 15. Jahrhundert gelang den Habsburgern seit Albrecht II. (1438–1439) und Friedrich III. (1440–1493) dann die langfristige Sicherung des Throns (dazu der Beitrag von Martin Kintzinger). Dynastische Zufälle und Verwandtschaftsnetze ermöglichten den kühnen Ausgriff über etablierte Handlungsfelder hinaus. So gerieten die burgundischen Niederlande (dazu der Beitrag von Klaus Oschema) ebenso in den Sog habsburgischer Expansion wie die ostmitteleuropäischen Königreiche (dazu der Beitrag von Julia Burkhardt). Dort wuchs den Habsburgern in Auseinandersetzungen mit der osmanischen Expansion eine generationenlange Zukunftsaufgabe zu (dazu der Beitrag von Claudia Märtl).
Wie nicht viele andere Herrschergeschlechter nutzten die Habsburger an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit die Kraft des dynastischen Prinzips. So stiegen sie zu einer ‚Weltmonarchie‘ auf, in der „die Sonne nicht unterging“ (dazu der Beitrag von Heinz-Dieter Heimann). Damals wurden sie erfolgreich, modern, scheinbar weit schauend. Jahrhunderte später sollte sich das dynastische Prinzip indes als Bürde der Monarchie erweisen, als Völker und Nationen ein bloßes herrscherliches Eigentumsrecht zurückwiesen und ihre eigene historische Gestaltungskraft einforderten. Bis dahin funktionierten die traditionellen Muster, die bereits Rudolf von Habsburg genutzt hatte, ziemlich gut. Man wird die Geschichte der Habsburger seit 1273 freilich niemals als lineare Erfolgsgeschichte schreiben. Zu viele Sprünge, zu viele Zufälle, zu viele Abwege blieben dann ausgeblendet. Immerhin stifteten die Prinzipien von Dynastie und Monarchie – über alle Kontingenz hinweg – für einige Jahrhunderte Dauerhaftigkeit. Das macht die Geschichte König Rudolfs I. und den Aufstieg seines Hauses Habsburg im Mittelalter historisch so interessant. Es war keine Heldengeschichte, keine Geschichte nur der großen Männer und Frauen, auch wenn historische Größe bisweilen aufscheinen mag. Der Reiz entsteht für uns heute eher aus der Andersartigkeit von Handlungsmustern und Denkkategorien. Wir müssen sie uns – ein Jahrhundert nach dem Ende der mitteleuropäischen Monarchien – erst wieder neu erschließen, weil uns diese Vergangenheit fremd wurde. Die Erinnerungsmale der toten Könige und Kaiser umgeben heute dagegen die Wissenden wie die Unwissenden gleichermaßen.
Die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer nahm die 800. Wiederkehr von Rudolfs Geburtstag zum Anlass für eine Tagung, die vom 11. bis 13. April 2018 unter Leitung von Stefan Weinfurter und mir im historischen Ratssaal der Stadt Speyer stattfand. Der öffentliche Abendvortrag durfte im Kaiser- und Mariendom zu Speyer gehalten werden. Dankbar denken die Referentinnen und Referenten sowie die sehr zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung an die umsichtigen Planungen der Stiftung unter Leitung des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds Karl-Markus Ritter und an die Speyerer Gastfreundschaft zurück. Die Europäische Stiftung ermöglichte auch die Drucklegung dieses Bands durch einen namhaften Druckkostenzuschuss.
Meinem Freund und Kollegen Stefan Weinfurter war es nicht mehr vergönnt, die Realisierung dieses Buchs zu begleiten. Er starb wenige Monate nach der gemeinsamen Tagung am 27. August 2018. Voller Dankbarkeit für seine Impulse wird ihm dieser Band als Andenken gewidmet.
Ich bin allen Autorinnen und Autoren des Buchs sehr verbunden, dass sie ihre wichtigen Beiträge zur Verfügung stellten. Große Verdienste bei der Textredaktion erwarben sich meine Heidelberger Mitarbeiterinnen Barbara Frenk und Isabel Kimpel. Die Sammlung der Abbildungen koordinierte Sabine Elsässer.
Bei der Drucklegung bewährte sich erneut die gewohnt gute Zusammenarbeit mit der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, wobei das Lektorat von Daniel Zimmermann eigens herausgehoben sei.
1 Diese Zahlen in Klammern nennen, wenn nicht anders angegeben, die Regierungsjahre. Auf Abkürzungen in den Quellen- und Literaturnachweisen wird verzichtet; einzige Ausnahme ist MGH = Monumenta Germaniae Historica.