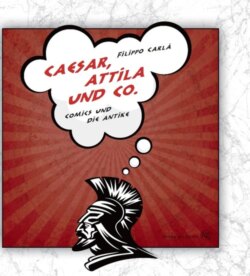Читать книгу Caesar, Attila und Co. - Группа авторов - Страница 13
Ein Streifzug durch einen historischen Comic: die Abenteuer von Ducarius dem Gallier
ОглавлениеGiovanni Brizzi, Sergio Tisselli
Eine Vorbemerkung muss bezüglich dieses Textes gemacht werden. Der Schreiber – Giovanni Brizzi – verfasst ihn zwar aufgrund seiner größeren Erfahrung im Schreiben von Texten, doch das in zwei Ducarius dem Gallier gewidmeten Alben bisher Verwirklichte ist ein gemeinsames Produkt von Sergio Tisselli und mir (und, im zweiten Album, von Giovanni Marchi). Somit ruft der vorliegende Aufsatz Erinnerungen an eine synergetische Zusammenarbeit hervor, verschmolzen in unum, und erzählt von einer Erfahrung, die gänzlich von den Autoren geteilt wurde – wie auch immer deren Ergebnisse sich bewerten lassen. Tisselli und Brizzi werden also zusammen durch Worte und Bilder sprechen. Ebenso wird der vorliegende Text selbstverständlich unter beiden Namen veröffentlicht.
Jenseits einer persönlichen Freundschaft – die, wie in unserem Fall, sicherlich helfen kann – wird die Zusammenarbeit zwischen einem talentierten Zeichner, wie es eben Sergio Tisselli ist, Schüler des großen Comiczeichners Roberto Raviola (auch bekannt als Magnus), und einem sozusagen „offiziellen“ Wissenschaftler und renommierten Althistoriker wie Giovanni Brizzi, nur möglich, sofern Letzterer von vornherein versucht, einen großen Makel der Wissenschaftlerzunft auszumerzen: jenen akademischen Dünkel, der bei vielen Hochschullehrern bezüglich des Comicgenres aufzutauchen pflegt. Der Comic, der zu Recht auch als „letteratura disegnata“ (gezeichnete Literatur) definiert worden ist, stellt in der Tat – und dies muss jedem klar sein – eine zusammengesetzte Ausdrucksform dar, folglich eine Sprache. Daher bemisst sich der Wert eines jeden Werkes am Niveau der Formen und der Inhalte, an der Handlung, an der Inszenierung und, vielleicht hauptsächlich, an dem, was es am meisten kennzeichnet: der Zeichnung.
Im Fall des „Experiments Tisselli – Brizzi“ kam die Zusammenarbeit primär durch persönliche Freundschaft zustande. Kontaktiert von der Società di Studi Appenninici Savena, Setta, Sambra, die bei ihm schon ein vorangegangenes Album in Auftrag gegeben hatte, das auf dem Apennin spielt und in jenem Fall aus dem Tagebuch des Mr. Dodsworth, eines Reisenden, der den Gebirgszug im Laufe des 18. Jahrhunderts auf abenteuerliche Weise überschritten hatte, erarbeitet wurde, wendete sich Sergio Tisselli nun an den Schreibenden, um seinen Ratschlag einzuholen. Und ich, der ich Comics seit jeher liebe, schlug ihm vor, unsere Geschichte in der Zeit einer anderen und um einiges bekannteren Überquerung der Gebirgskette spielen zu lassen, die im späten Frühling des Jahres 217 v. Chr. durch den Karthager Hannibal erfolgte.
Abb. 6 | Giovanni Brizzi, Sergio Tisselli, Occhi di lupo, S. 47.
An diesem Punkt war es nötig, eine fantastische Handlung zu ersinnen, ein Gerüst, das stützen und der Arbeit Anmut verleihen sollte; eine Handlung, in der ich mir jedoch, als sozusagen offizieller Wissenschaftler der Genauigkeit verpflichtet, keinesfalls übermäßige historische Freiheiten erlauben konnte. Kein Problem. Wittgenstein umkehrend sagte Umberto Eco einmal, dass „man über das, wovon man nicht schreiben kann, erzählen muss“. Uns auf diese Aussage berufend waren Tisselli und ich uns sogleich darüber einig, dass in den Lücken der sozusagen offiziellen Geschichte authentische Erzählwelten ohne substantielle Veränderungen Raum finden und dort die eindrucksvollsten fantastischen Handlungen spielen könnten. Dies ist ein Punkt, auf den wir zurückkommen werden.
Tisselli und ich entschieden uns daher dafür, die Geschichte um eine reale Person zu erweitern, um den eques Ducarius (einen wahrscheinlich bedeutenden „Ritter“), der dem gallischen Stamm der Insubrer angehörte und der während der Schlacht am Trasimenischen See [Abb. 6] den Konsul Gaius Flaminius Nepos tötete. Man weiß wenig von ihm; und dieses Wenige ist komplett dem Werk des Titus Livius (Römische Geschichte 22.6) zu entnehmen. Wie unser Akteur berichtet, war er einige Jahre vor der Schlacht am Trasimenischen See Zeuge der römischen Invasion der Poebene und des damit verbundenen Schicksals seiner Blutsverwandten, die eben von jenem Flaminius, seines Zeichens Wortführer der Angesehensten des Senats und Befürworter der Eroberungspolitik gegenüber Gallien, besiegt und niedergemetzelt worden waren. Diesen erkannte der gallische Krieger Ducarius nun als Führer der Legionen wieder und stürzte sich inmitten des Schlachtfelds auf den verhassten Feind. Nachdem er ihn getötet hatte (wie Livius berichtet), beraubte er ihn seiner Kleidung und Waffen und entfernte nach keltischem Brauch den Kopf als die wertvollste der Trophäen [Abb. 7]. Hannibal, der ihm ein feierliches Begräbnisfest bereiten wollte, suchte den Leichnam des Flaminius, doch konnte er ihn, nunmehr nur noch ein verstümmelter, nackter Rumpf unter Hunderten, vielleicht Tausenden von Leichen, nicht mehr identifizieren.
So weit die wahre Geschichte. Um den Zeitraum zwischen diesen beiden Fixpunkten zu füllen – dem römischen Sieg über die Insubrer und der Rache des Ducarius in der Schlacht am Trasimenischen See –, haben wir eine Verbindung aus Fantasie und historisch plausiblen Motiven konstruiert, die die Handlung des ersten der zwei Comics, Occhi di lupo, bildet: Ducarius, dem Heer des Hannibal folgend, ist während des Winters zusammen mit einer punischen Abteilung ausgeschickt worden, um zu erkunden, ob es möglich wäre, den Apennin zu überqueren. Dieser Erkundungstrupp gerät in einen Hinterhalt der in den Bergen wohnenden Ligurer, den Ducarius als Einziger überlebt. Während der Gefangenschaft tritt Ducarius in regen Kontakt mit dem heiligen Mann des Stammes, einer Art Schamane. Dieser befiehlt nicht nur den Seinen, das Leben des Ducarius zu schonen, sondern offenbart dem Gefangenen, dass dieser gleichsam hellseherische Fähigkeiten besitze, was Ducarius nicht bewusst gewesen ist. Dazu erklärt er ihm die Bedeutung eines immer wiederkehrenden furchterregenden Zeichens. Alle Komponenten dieser Vision sind keltisch. Inhalt dieser Vision ist ein Zweikampf zwischen einem ungeheuerlichen drohenden Wolf – zweifelsfrei symbolisch für die Stadt Rom stehend, die ja durch die Wölfin personifiziert wird, deren weiße Strähne auf unheimliche Weise als Haar des Gaius Flaminius wiederkehrt – und einem majestätischen Hirsch, der unter Einsatz seines Lebens den jugendlichen Ducarius rettet – ein Symbol jenes Gottes Cernunnos, der das keltische Volk personifiziert. Die Vision orientiert sich am bekannten livischen Omen, das der Schlacht von Sentino voranging (295 v. Chr.), und wirft einen dunklen, dramatischen Schatten auf die Beziehung zwischen diesen beiden Völkern. Von den Ligurern auf Geheiß seines Beschützers, der ihm sein Schicksal eröffnet hatte, freigelassen, eilt Ducarius im Frühling des Jahres 217 v. Chr. zu Hannibal, angetrieben von dem Wunsch, an Flaminius Rache zu nehmen, die sich dann auf dem Schlachtfeld am Trasimenischen See vollzieht.
Abb. 7 | Giovanni Brizzi, Sergio Tisselli, Occhi di lupo, S. 52.
Obgleich nur in einer geringen Auflage erschienen (es wurde dank eines Zuschusses zweier Bankstiftungen veröffentlicht), erhielt das Album ziemlich wohlwollende Kritiken. Derart ermutigt, beschlossen wir, unseren Freund Giovanni Marchi darum zu bitten, sich uns anzuschließen und gemeinsam mit der Ausarbeitung eines zweiten Teiles fortzufahren, der wiederum Ducarius zum Protagonisten haben sollte. Wiederum gänzlich fantastisch handelt die Geschichte erneut von einem bekannten historischen Vorfall, einem noch tragischeren als dem vorangegangenen: dem römischen Desaster im Silva Litana (Livius, Römische Geschichte 23.24). Diese weitere Niederlage, die sich im Frühling des Jahres 215 oder, so auch die Datierung, die wir auswählten, gegen Ende des Jahres 216 ereignete, folgte wenige Monate auf das berühmte Massaker von Cannae: Der Suffekt-Konsul Lucius Postumius Albinus, ernannt für Aemilius Paullus, der bei Cannae sein Leben verloren hatte, durchzog an der Spitze seines Heeres das Gebiet der Boier und drang in einen sehr weitläufigen Wald, eben Silva Litana genannt (eine Art symbolisches Totenreich), ein. In einen Hinterhalt geratend wurden die Legionen vollständig vernichtet. Der Schädel des Konsuls, enthäutet und als Kelch in Gold eingefasst, fungierte in der Folge als rituelles poculum (Trinkgefäß) im bedeutendsten gallischen Heiligtum dieses Gebiets. Die diesem Hinterhalt zugewiesene außergewöhnliche (und unwahrscheinliche) Form – eine lange, gleichmäßig abgehauene und gepflegte Reihe an Bäumen soll sich auf die durchmarschierenden römischen Truppen gestürzt und sie überwältigt haben – bewegte einige Wissenschaftler dazu, sich um Aufklärung dieser Episode zu bemühen. Der Rückgriff auf den Mythos der kämpfenden Bäume, der vor allem in späterer Zeit in einem Kurzepos, das dem legendären walisischen Barden Talisien (6. Jahrhundert n. Chr.) zugeschrieben wird, bezeugt ist, ist aber sicher keltischen Ursprungs.
Von diesen Voraussetzungen ausgehend, skizzierten wir eine Geschichte von unzweifelhaft gotischer Farbgebung; basierend auf der Stilebene der doppelten Wahrheit, der Interpretation, um sich einer an sich fantastischen Erzählung hinzugeben: Als Ducarius nach dem Sieg von Cannae in den Norden zu Hannibal zurückkehrt, erreicht er, mit der Aufgabe, eine größere kriegerische Anstrengung seitens seiner Blutsverwandten anzuregen, das Gebiet der Boier, und zwar genau zum Zeitpunkt des Angriffs des Albinus. Von ihnen aufgenommen wie ein Held, nimmt er am Gefecht teil, schont aber zu guter Letzt im Namen der Vision, die er gehabt hat, das Leben eines blutjungen Römers. Nach diesem Sieg wird Ducarius sehr populär unter seinen Volksgenossen und zum Hauptvertreter der druidischen Magie, die angeblich den unbesiegbaren, die Legionen zu vernichten fähigen Kriegerbäumen Leben gegeben hat, aufgebaut. Jedoch erklärt er den Seinen, dass es nicht wie in der übertriebenen, fast schon zum Traum gewordenen Erzählung der Fantasie gewesen sei. In Wahrheit hätten Albinus und seine Truppen die Niederlage ihrer eigenen Überheblichkeit zu verdanken, ihrem frevelhaften Willen, das herauszufordern, was sie selbst als genius loci des Silva Litana definieren würden: Entmutigt und blind, verloren in einer Art Labyrinth außerhalb der Zeit, seien die Entweiher, vorbestimmten Opfern gleich, ihrem Gegner beim größten aller gallischen Siege seit der Schlacht an der Allia (390 oder 387 v. Chr.) ausgeliefert gewesen [Abb. 8].
Aber kehren wir zum Comic generell zurück. Seinem Wesen nach ziemlich frei, sprich fähig, eine Reihe enorm unterschiedlicher Produkte und Vorstellungen sowohl unter ästhetischen als auch inhaltlichen Gesichtspunkten zu kreieren, erlegt das Genre dennoch einem jeden, der sich ihm annähert, eine im Grunde immer gleiche Mechanik auf. Ob es sich nun um ein Manga oder amerikanische Superheldengeschichten, um Graphic Novels oder historische Comics handelt, die jeweiligen Entwicklungsstufen des konstruktiven Prozesses sind identisch: Um die Bildabfolge zu festigen, ist ein Stoff, eine Inszenierung, ein story board nötig. Fernerhin ist es notwendig, die Art des Bildausschnittes zu definieren, das Ambiente und Kostüme festzulegen sowie die Figuren zu charakterisieren.
Sind diese Aspekte festgelegt, verbleiben dem Autor der Dialog und – besonders in einem Comic wie dem unserem – die Pflege der historischen Einzelheiten; aber es ist der Zeichner, dem in der Teamarbeit die wichtigste Aufgabe obliegt. Von den unbestreitbaren künstlerischen Fähigkeiten (vor allem herausragend in der Aquarelltechnik) abgesehen, hatte ich in Sergio einen Ausführenden gefunden, der jede Anleitung, die ich ihm gab – von der Kapitulation der Heere und Reiter über die Darstellung verschiedener ins Bild genommener Ethnien im Heer von Hannibal bis hin zu den Heeresbewegungen, welche die dem Gelände angepassten Taktiken unterstreichen –, auf aufmerksame und respektvolle Weise umsetzte. Allerdings tauchen auch viele Alltäglichkeiten in der Geschichte auf. Bisweilen ist die Geschichte liebevoll anekdotisch. Tisselli zitiert häufig eine Äußerung von Magnus bezüglich einer Geschichte, die im 18. Jahrhundert spielt: „Ja, ich bin einverstanden mit seinem fesselnden Charakter: Flucht, Schlacht, Gefangennahme … Aber ich hätte auch jenen Edelmann [den Protagonisten] vor dem Spiegel sehen wollen, mit dem gepuderten Gesicht, während er einen künstlichen Schönheitsfleck anbringt.“ Das Ambiente ist also immer präsent; und ihm hat Sergio zumindest einige, wenn auch verkürzte wertvolle Sequenzen gewidmet, etwa dem ligurischen Dorf, der Halle des Senats in Rom oder im zweiten Band der großen Versammlung der Insubrer im Zentrum eines rein fantastischen Mediolanum (Mailand).
Abb. 8: Sergio Tisselli, Giovanni Brizzi, Giovanni Marchi, Foreste di morte, S. 43.
Tisselli bemerkte sofort das bestehende Risiko, im Falle einer historischen Erzählung in zwei gefährliche Fallen zu tappen. Zuallererst muss man auf didaktische Bildunterschriften zurückgreifen. An dieser Ansicht mögen sich die Geister scheiden, aber in Italien hat sie unzweifelhaft schöne und wichtige Ergebnisse hervorgebracht (man denke an die goldene Epoche des Corriere dei Piccoli und an einige seiner großen Autoren: Pratt, Battaglia, Toppi, Micheluzzi etc.). Das Problem ist jedoch, dass ein derartiger Ansatz oftmals in unergiebigen und langweiligen Erzählungen münden kann, und die Comic-Handlung wird letztendlich, genauso wie die Geschichte, zur bloßen Bildbeschriftung. Hier kann man an einen Ansatz erinnern, der bis heute als sehr großer verlegerischer Erfolg angesehen werden kann: die Storia d’Italia a fumetti [Geschichte Italiens als Comic] von Enzo Biagi. Die Arbeit, wenn auch unter graphischen Gesichtspunkten sehr schön, schafft es fast nie zu begeistern, schafft es nicht, die Erzählung zum Leben zu erwecken, wenn sie sich, wie in diesem Fall, auf die Bildunterschrift – auf Schrift also, die die Bilder anschließend glossiert – konzentriert. Damit wird sie laut Tisselli und dem hier Schreibenden der grundsätzlichen Basis und selbst der Bedeutung der gewählten Sprache, die Durchdringung von Schrift und Bildern ist, nicht gerecht. Bild und Sprache haben im Comic eigene und gut definierte Funktionen; der Text muss (und darf) nicht ständig die Zeichnungen erklären, diese müssen vielmehr aus sich selbst sprechen. Vor allem in einem historischen Comic ist es jedoch häufig notwendig, dass sich die Beschriftungen unpassendem Missbrauch oder Gebrauch entziehen. Einige große Autoren (man denke im Besonderen an Giancarlo Berardi) haben sich ihrer vollends entledigt, mit brillanten Ergebnissen in einer beinahe kinematographischen Form.
Der gewissermaßen entgegengesetzte Fehler entsteht durch die Versuchung, sich gleichsam überzogene, ja überwältigende Freiheiten zu gönnen, mit dem häufigen Resultat, die Geschichte zu verfälschen, indem sie völlig fremden Anforderungen untergeordnet wird. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn der gewählte erzählerische Ton jenem der Fantasy entspricht (ein Gebiet, in dem wahrscheinlich die französische Schule führend ist): dann nämlich, wenn der Hintergrund erklärtermaßen fictio ist, ein Zwischenspiel, um den Leser in eine andere, fantastisch ausgeprägte Dimension einzuführen, die jedoch von historischen Charakteristika nur oberflächlich gekennzeichnet ist (man denke zum Beispiel an einen gewissen mediävalen barbarischen Charakter wie Conan der Barbar).
Ganz anders gelagert hingegen ist der Diskurs in Bezug auf jene Werke, die anstreben, gerade durch einen historisch-authentischen Hintergrund gekennzeichnet zu sein. Auch hier geschieht es häufig, dass sich die Autoren beliebige Kompetenzen herausnehmen, über die sie jedoch nicht verfügen, und literarischen Bestimmungen mehr Aufmerksamkeit schenken als der Geschichte. Dies ist offensichtlich (wenn auch häufig missverstanden) den Bedürfnissen des Marktes geschuldet. Eine derartige Haltung hat sowohl den Comic miteinbezogen, der schon immer als exzellentes Ausbruchsmittel geschätzt wurde, als auch das Kino und das Fernsehen. Man denke an viele Filme sowie (häufig auch sehr kostspielige) europäische und amerikanische Serien, in denen sich die als realistisch anzunehmende Rekonstruktion in eine bloße, oberflächliche, wenn nicht sogar ignorante und verwirrende Ausrede wandelt. Oftmals passiert es, dass „ganze Legionen“ selbsternannter Historiker dem Publikum eine hintergründige Lesart darzubringen versuchen, die aus wissenschaftlicher Sicht jedoch zumindest fragwürdig ist.
„Das ist Schauspiel, Baby“: So, Bogart umschreibend, begegnen oft zahlreiche Kritiker diesem Phänomen.
Und dennoch gibt es einen in diesem Bereich bedeutenden Unterschied zwischen Kino und Comic. Und darin sind Tisselli und ich uns auch vollkommen einig. Der Comic hat bezüglich der Ausstattung einen ganz anderen Ansatz als das Kino – und insbesondere als die Kinoproduktionen, die die Franzosen péplum nennen. Der blasierten Ungenauigkeit vieler Produktionen des Kinos und Fernsehens, dazu bereit, die historische Rekonstruktion im Namen des „Spektakels“ preiszugeben – denen zumindest die Einhaltung einiger historischer Realitäten als Basis, als Fixpunkte nicht schaden würde (es wurde ja schon von den grenzenlosen Möglichkeiten, die der Fantasie eines Autors im großen, zu füllenden Raum zwischen historischen Fakten offenstehen, gesprochen) –, entspricht nämlich eine grundlegende Bescheidenheit des Comics, der in vielen Fällen dazu imstande ist, deutlich mehr aufeinanderfolgende Alben mit authentischen Erzählpassagen auszuarbeiten, die im ausgewählten chronologischen Kontext hervorragend Verwendung finden können (als Gelehrter der römischen Geschichte denke ich zum Beispiel an die exzellenten Serien Murena oder La dernière prophétie, die bei Dargaud bzw. Glénat herausgegeben wurden).
Die Rechtfertigung, es sei ein „Spektakel“, steht als solche nicht allein. Nicht weniger als Vorwand für diese Praxis dienend, zielt die zweite Rechtfertigung auf die stets vorherrschenden Ansprüche des Marktes ab. Obgleich nicht vollends unbegründet, man betrachte dazu nur den Erfolg einiger dieser Produktionen, unterschätzt dieses Argument unserer Meinung nach gründlich die Intelligenz und den Geschmack des Publikums.
Dem Erfolg liegt in der Tat nicht die Verzerrung der Geschichte zugrunde, sondern allein das Niveau von Formen und Inhalten, die diesbezüglich auch äußerst respektvoll mit der wirklichen Geschichte umgehen können. Zumindest was den Comic angeht, kann man einen emblematischen Fall vorweisen: jenen des Dago. Bereits vor Jahrzehnten mit großem Erfolg veröffentlicht, der bis heute unvermindert scheint, widmet sich die Serie dieser Figur, die die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts durchläuft. Historisch reich und sehr komplex, ist ihr Erfolg der großen erzählerischen Sorgfalt und dem immer fesselnden Charakters des von Autor Robin Wood dargebotenen Abenteuers geschuldet. Aber diese Geschichte ist ebenfalls durch eine im Wesentlichen getreue historische Rekonstruktion gekennzeichnet, die von der hervorragenden Zeichnung von Carlos Gomez außerordentlich gestützt wird.
Wir haben versucht, diesen Zielen mit unseren beiden Alben nahezukommen. Auch wenn es uns nicht gelungen sein mag, unserer Serie wirkliches Leben einzuhauchen, so hoffen wir doch auf die Möglichkeit – dies bleibt wirklich zu wünschen –, ein letztes Kapitel zu realisieren, um sie somit zu einer Art Trilogie vervollständigen zu können.
(Aus dem Italienischen übersetzt von Claudine Walther)