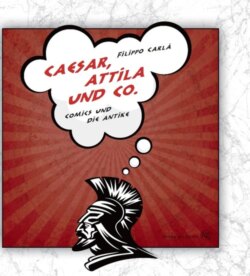Читать книгу Caesar, Attila und Co. - Группа авторов - Страница 7
Vorwort
ОглавлениеFilippo Carlà
Die Rezeption der Antike hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten und dynamischsten Bereiche der Altertumswissenschaften entwickelt – die Zahl der Monographien, Sammelbände, Aufsätze, Fachzeitschriften und Tagungen, die diesem Thema in den letzten fünfzehn Jahren gewidmet wurden, spricht für sich. Wenn aber die Rolle der Antike in politischen Diskursen sowie in der Konstruktion von Bildern der Vergangenheit (in den neuesten Studien mit dem vom Archäologen Cornelius Holtorf entwickelten Begriff „Pastness“ definiert) jetzt weitestgehend anerkannt ist, so bleiben dennoch große Lücken in der Forschung zu diesem Thema bestehen: Die größte Aufmerksamkeit wurde bisher hauptsächlich der Rezeption im Film und in der Belletristik sowie der Benutzung antiker Themen, Ereignisse und Denkmäler in der Stiftung nationaler Identitäten geschenkt – in deutlich geringerem Umfang wurden andere Medien und Formen analysiert, die in der Regel als „populär“ bezeichnet werden. Oftmals wurde hierbei jedoch nicht beachtet, dass die postmoderne Ästhetik die Trennung zwischen populärer Kultur und Hochkultur eigentlich ablehnt.
Der Comic gehört zu dieser Kategorie „vernachlässigter“ Medien. Das Buch A Companion to Classical Receptions (Hg. L. Hardwick und C. Stray, London 2011) beinhaltet zum Beispiel keinen einzigen Beitrag über Comics, wohingegen den performativen Künsten, dem Film und der „Kulturpolitik“ jeweils ganze Sektionen gewidmet wurden. Zwar ist die Anzahl an Studien, die Antike und Comic fokussierten, in den letzten Jahren gestiegen, doch im Vergleich zu den anderen genannten Themen eher gering geblieben: Beispiele hierfür sind ein im Jahr 2011 von George Kovacs und C. W. Marshall herausgegebener Sammelband oder, im deutschsprachigen Raum, der Katalog der Basler Ausstellung „Antico-mix“ (Skulpturhalle Basel, 31. März bis 26. September 1999). Auch haben die Publikationen der Imagines-Gruppe, die sich seit einigen Jahren mit der Antikenrezeption in visuellen und performativen Künsten auseinandersetzt (www.imagines-project.org), diesem Medium eine gewisse Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen (man siehe die Akten der Tagungen, die 2008 in Logroño und 2010 in Bristol veranstaltet wurden).
Daher bleibt gerade in diesem Bereich trotz der erfreulichen jüngsten Entwicklung vieles zu tun – und einiges auch anders, als es bisher getan wurde. Um zwei Mängel zu nennen: Erstens wurden bisher prinzipiell Comics untersucht, die sich nur mit der Antike beschäftigen (über allen steht natürlich der populärste Comic, Astérix, über den Kai Brodersen einen erfolgreichen Sammelband herausgegeben hat), während andere, nicht primär die Antike ins Auge fassende Reihen, die sich jedoch in zumindest einem oder gar in mehreren Heften mit dem Altertum auseinandersetzten, kaum Aufmerksamkeit erweckt haben (man denke nur an die Zeitreisen Mickys und Goofys – in diesem Band exemplarisch untersucht von Patrick Schollmeyer und Andreas Goltz; oder an die Abenteuer Donalds und Dagoberts auf der Suche nach verborgenen Schätzen der Antike). Weniger bekannte Comics oder einzelne Graphic Novels wurden dementsprechend noch seltener betrachtet, gänzlich unbefriedigend schließlich ist die Situation bezüglich anderer Epochen (wie dem Mittelalter), die im Comic ebenfalls oft dargestellt werden (wie Alex Service bezüglich der Wikinger gezeigt hat).
Ein zweiter Mangel ist in der Methodik der Studien zur Antikenrezeption selbst zu bemerken: Wenn diese sich schon außerhalb der traditionellen Altertumswissenschaften (Alte Geschichte, Klassische Philologie, Klassische Archäologie, Ägyptologie usw.) ausgebreitet haben und inzwischen auch von Literatur- und Kulturwissenschaftlern, Kunsthistorikern und anderen vertreten werden, so wurden die Schöpfer der Comics selbst (Zeichner und Autoren der Texte) zu ihren Kreationen kaum befragt. Positive Ausnahmen stellen das Treffen „Comic Books and History“, dessen Ergebnisse 1984 publiziert wurden (in Radical History Review 28–30: 229–252), und in den letzten Jahren die Tätigkeit Eric Shanowers, Autor des erfolgreichen Comics Age of Bronze (eine Remediatisierung der Ilias), dar. Dieser kooperiert seit einigen Jahren mit Altertumswissenschaftlern und berichtet über seine Inspirations- und Informationsquellen sowie über seine Gründe, sich mit antiken Themen zu beschäftigen (nachzulesen im oben genannten Band von Kovacs und Marshall wie auch in den Akten der Imagines-Tagung in Bristol, die von Marta García Morcillo und Silke Knippschild herausgegeben worden sind).
Der nun vorliegende Band hat sich zum Ziel gesetzt, einige dieser Lücken zu schließen und eine neue Perspektive im Bereich der Antikenrezeption zu eröffnen. Zuerst durch eine konsequente und exklusive Aufmerksamkeit für das Medium Comic in all seinen verschiedenen Thematiken und Formen: von den Graphic Novels (die in den meisten Aufsätzen thematisiert werden) über die didaktischen Comics (Hellmich, Lindner), die längeren, die Antike thematisierenden Serien und das sporadische Erscheinen des Altertums in ansonsten etablierten Reihen (z.B. die Antikeepisoden im DDR-Comic Mosaik, hier untersucht von Thomas Kramer) bis hin zu kleineren satirischen Produktionen (z.B. im Beitrag Maria Castellos) und den erotischen „schwarzen“ Comics der 1970er Jahre (in meinem eigenen Aufsatz). Dazu kommt eine intensive Einbeziehung der Zeichner und der Autoren, die gebeten wurden, über ihre Arbeit zu schreiben: Wieso haben sie die Entscheidung getroffen, sich mit antiken Themen und Mustern zu befassen? Woher beziehen sie ihre Informationen – in erster Linie zur antiken Geschichte und Literatur, aber auch zum Alltagsleben und zu den Ikonographien, ihres Zeichens unabdingbare Elemente, um die Antike visuell repräsentieren zu können? Welche Bedeutung (oder welchen, auch nur ästhetischen, Wert) hat ihres Erachtens die Antike für die heutige Welt?
Die Heterogenität der ausgewählten Comic-Autoren, die hier als Verfasser einiger Beiträge auftreten, erlaubt besonders interessante Überlegungen und Einblicke: So stammen einige Arbeiten von Altertumswissenschaftlern (oder Personen, die ein Studium der Alten Geschichte absolviert haben, wie Michaela Hellmich oder Dorothée Šimko) oder sind das Produkt einer Kooperation eines Altertumswissenschaftlers mit einem erfolgreichen Zeichner (wie im Fall von Giovanni Brizzi, Professor für Alte Geschichte an der Universität Bologna, und dem Zeichner Sergio Tisselli, Autoren der zwei Alben, die sich mit der Geschichte des Galliers Ducarius befassen, Occhi di lupo [Die Augen des Wolfs], 2004, und Foreste di morte [Die Wälder des Todes], mit Giovanni Marchi, 2006). Andere Comics hingegen sind dem reinen Interesse einiger Autoren an der Antike geschuldet, die sich zuvor nicht professionell mit dieser Epoche beschäftigt hatten, sie aber als bedeutsames Reservoir an Geschichten, Persönlichkeiten, Themen und Motiven erkannt haben. Dies ist der Fall bei Michele Petrucci, Autor der Graphic Novel Metauro [Metaurus] (2008), die den Zweiten Punischen Krieg thematisiert, der hier verdeutlicht, welche Rolle die Orte seiner Kindheit und seiner weiteren Lebensstationen für sein Interesse an der römischen Antike gespielt haben (und wie schwierig es ist, die richtigen Quellen für historische Informationen und für geeignete Ikonographien aufzuspüren). Ebenso verhält es sich bei Valérie Mangin, die schon immer großes Interesse für die antiken Kulturen besaß, sich nach einem erfolgreichen Studium der frühneuzeitlichen Geschichte und einem Abschluss in Paläographie der Kunst des Comics widmete und deren Chroniques de l’Antiquité galactique [Chroniken der galaktischen Antike] (2000ff.) uns im Science-Fiction-Gewand ein Römisches Reich im Krieg gegen die Hunnen vorstellen.
Ein besonderes Verdienst des Buches ist zudem die Tatsache, dass einige Comics eine doppelte Betrachtung erfahren, die ihres Autors und die eines Wissenschaftlers, der sie analysiert: eine doppelte Perspektive, die bisher kaum zu finden war. So beleuchtet in diesem Band Valérie Mangin ihre Arbeit an und mit Attila, die dazu von dem Althistoriker Andreas Goltz im Rahmen einer generelleren Betrachtung der Figur Attilas im Comic analysiert wird. Michaela Hellmich, die einen didaktischen Comic zu Julius Cäsar und seinem Gallischen Krieg verfasst hat, präsentiert ihre Ideen und ihre Ziele neben Martin Lindner, der über die Eigenschaften und die Funktionen des Lehrcomics insbesondere am Beispiel Rubricastellanus’ schreibt, jedoch auch Hellmichs Arbeit thematisiert. Dadurch werden zwei sehr verschiedene Ansätze – und Ansprüche – gezeigt.
Die Auswahl der Comics und ihrer Zeichner, die hier auftreten oder untersucht werden, folgt zudem dem dringenden Anliegen, die Aufmerksamkeit für die europäische Comic-Produktion zu steigern, die besonders in Ländern wie Frankreich/Belgien und Italien eine jahrzehntelange Tradition im Bereich der „Antikencomics“ vorweisen kann. US-Produktionen werden nur kurz in den Beiträgen von Maria G. Castello in ihrem systematischen Überblick über die Rezeption Kaiser Julians – neben italienischen und holländischen Comics wird auch eine amerikanische Serie behandelt – und von Andreas Goltz in seiner Darstellung der Rezeption des Hunnenkönigs Attila berücksichtigt. Zweck dieses Bandes ist es somit auch, dem Publikum eine Reihe von europäischen Publikationen näherzubringen, die in Deutschland kaum bekannt sind, um die Vielfalt und die Breite der europäischen Kreationen aufzuzeigen und so hoffentlich ein größeres Interesse für diese Veröffentlichungen zu wecken. Es geht dabei nicht nur um die Comics, die hier einzeln vorgestellt und analysiert werden, sondern um ganze Traditionen, die es zu verstehen gilt: Der französischsprachige Antikencomic (viele der Zeichner stammen in der Tat aus Belgien) ist in diesem Sinne ein gutes Beispiel. Kennen zwar alle (oder fast alle) Astérix, so ist die Serie Alix – deren Titelheld der Adoptivsohn eines römischen Senators ist, der im Auftrag Cäsars um die Welt reist – trotz der Existenz deutscher Übersetzungen von 25 Alben hierzulande kaum bekannt. Diese Serie ist aber von zentraler Bedeutung besonders für die Arbeiten Valérie Mangins, die in Alix einerseits eine wichtige Inspiration ihrer Arbeit gefunden hat, andererseits seit 2010 selbst die Autorin einer Fortsetzungsserie des Alix ist (40 Jahre später ist Alix selbst Senator), die im vorliegenden Band dem deutschen Publikum vorgestellt werden soll (das erste Heft in deutscher Übersetzung ist im Juli 2013 erschienen, als sich der vorliegende Band in der letzten Phase seiner Abfassung befand). Diese neuere französischsprachige Produktion, die nicht nur in einer Wiederbelebung der Serie Alix besteht, ist im deutschsprachigen Raum ebenso wenig bekannt wie eine andere, äußerst erfolgreiche französische Serie namens Murena. Wir hoffen, dass dieser Band einen konkreten Beitrag dazu leisten wird, diesen Werken zu größerer Bekanntheit zu verhelfen und den Leser zu ihrer Lektüre zu motivieren.
Unser Buch soll keine Publikation „von Spezialisten für Spezialisten“ sein, vielmehr richtet es sich an ein breiteres Publikum, an Menschen, die sich entweder für die Geschichte (insbesondere für die Alte Geschichte) oder für Comics interessieren; oder aber – und dies dürfte nicht selten der Fall sein – für beide. Es wurde schon von mehreren Seiten betont, welch einen großen Zuwachs das Interesse an der Vergangenheit in den letzten Jahren (insbesondere seit der Jahrtausendwende) in der westlichen Welt erlebt hat. Gerade deshalb erscheint es wichtig, ein Buch, das sich mit der heutigen Relevanz, dem Unterhaltungswert und der „Aktualität“ der Antike beschäftigt, einer breiteren Leserschaft als den „üblichen Verdächtigen“ zugänglich zu machen.
Um den thematischen Zusammenhang des Bandes zu steigern und dem Leser eine strukturierte Auswahl an Beiträgen anzubieten, wurde entschieden, darin nur Comics über die Geschichte des antiken Rom zu behandeln. Somit bleiben hier nicht nur andere antike Kulturen unberücksichtigt (etwa Griechenland und Ägypten), sondern auch die reine Mythologie und die immer wiederkehrende Neubelebung antiker göttlicher Figuren. Die Reihenfolge der Aufsätze wurde zudem durch den Aspekt der thematischen Nähe bestimmt: Es findet bewusst keine Trennung zwischen den Beiträgen der „Wissenschaftler“ und denen der „Comic-Autoren“ statt, sondern sie sind chronologisch angeordnet, um die Lektüre interessanter und auch lesefreundlicher zu gestalten.
Unsere Hoffnung ist nicht nur, durch diesen Band neue Wege und Horizonte der Forschung im Bereich der Antikenrezeption aufzuzeigen. Ebenso bedeutsam ist es, beim Leser ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Welt der Altertumswissenschaften und die Welt der Comics doch nicht so weit voneinander entfernt sind, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag, und dass, man muss es klar benennen, eine eher künstliche Trennung von „hoher“ und „populärer“ Kultur häufig nicht nur nicht nützlich ist, sondern vielmehr unser Verständnis der heutigen Welt und der kulturellen Umstände, die wir in der westlichen Welt vorfinden, unnötig erschwert.