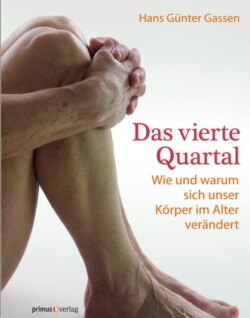Читать книгу Das Vierte Quartal - Hans Günter Gassen - Страница 9
Оглавление|15| 2 Evolutionäres und individuelles Alter des Menschen
Die Entstehung des Planeten Erde
Die Erde ist ungefähr 4,6 Milliarden Jahre alt. Schon in den ersten 500 Millionen Jahren entstanden die feste äußere Schale, die Lithosphäre, und die sie umgebende Gasschicht, die Atmosphäre. Mit der Abkühlung der zunächst heißen Erde bildeten sich große Mengen Wasserdampf, der dann zu den Urmeeren kondensierte.
|16|In den Meeren entstanden vor ca. 4 Milliarden Jahren Strukturen mit der Fähigkeit sich identisch zu vermehren: Lebendige Strukturen. Zu den ältesten Lebensspuren auf der Erde gehören die Stromatolithen oder Teppichsteine. Diese Lebensgemeinschaften von Einzellern – blaugrüne Algen und Cyanobakterien – wurden in 3,5 Milliarden Jahren alten Gesteinen des Präkambriums konserviert und deshalb findet man sie heute noch in den westaustralischen Küstengebieten. In den ersten 2 Milliarden Jahren der biologischen Erdgeschichte konnten Lebewesen nur im Wasser existieren, da an Land die energiereiche Strahlung aus dem Weltraum ihr Erbgut zerstört hätte.
Im Meer lebende Archae- und Eubakterien begannen vor ca. 3 Milliarden Jahren mittels der Photosynthese, d. h. unter Nutzung der Sonnenenergie, Sauerstoff zu produzieren. Das Gas reicherte sich in der Atmosphäre an und erreichte vor 350 Millionen Jahren den noch heute gültigen Wert von 21 % aller Luftbestandteile.
Sauerstoff und sein naher Verwandter, das Ozon, bildeten in der Atmosphäre einen wirksamen Filter gegen kurzwellige und damit energiereiche Strahlung. Aufgrund dieser Schutzschicht konnten Lebewesen, beginnend mit dem Kambrium, ihr Habitat Wasser verlassen und fortan auch auf dem Land leben. Der Luftsauerstoff eröffnete auch neue Möglichkeiten für die Verwertung von Nahrung. Die bisher ausschließlich genutzte Gärung (anaerober Stoffwechsel) wurde durch die Verbrennung (aerober Stoffwechsel) unter Nutzung des Atemgases Sauerstoff erweitert. Nur durch die 18-fach höhere Energieausbeute mittels der aeroben Verwertung der Nahrung wurde das Entstehen großer vielzelliger Organismen im Pflanzen- und Tierreich möglich. Im Laufe der Evolution kam es dann zu einer Arbeitsteilung zwischen Pflanzen und Tieren. Pflanzen nutzen das Sonnenlicht und Kohlendioxid, um Kohlenhydrate und Sauerstoff zu produzieren. Tiere verbrennen die Kohlenhydrate mit Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser und produzieren so die für sie lebenserhaltende Energie.
2.1 Ausbreitung des modernen Homo sapiens. Vermutlich entstand der moderne Mensch im südlichen Teil von Afrika und verbreitete sich von dort über alle Kontinente (modifiziert nach Storch/Welk/Wink 2007).
Die Herkunft des Menschen
Die Frage nach ihrer Herkunft beschäftigt Menschen seit Tausenden von Jahren, wie Mythen, Sagen und die anthropologische Forschung bezeugen. Zwei Auffassungen zur Entstehungsgeschichte des Menschen stehen sich fast diametral gegenüber. Für die einen ist der Mensch ein Geschöpf Gottes. Für die anderen ist er das Zufallsprodukt einer Millionen von Jahren andauernden Evolution. Der erste wissenschaftliche Beweis für die evolutionäre Entwicklung des Menschen kam 1856, als man im Neandertal bei Düsseldorf Skelettreste eines fossilen Menschen fand. Danach folgten 1891 Funde auf Java, wo der Militärarzt |17|Eugène Dubois auf Fossilien einer menschenähnlichen Gestalt stieß. Er glaubte, den gemeinsamen Vorfahren zwischen Affe und Mensch gefunden zu haben, und nannte ihn Pithecanthropus erectus, der aufrecht gehende Affenmensch.
Der Name „Affenmensch“ (Pithecanthropus) geht auf den Biologen Ernst Haeckel zurück, der lebenslang nach dem Bindeglied zwischen Affe und Mensch suchte.
Die australopithecinen Arten lebten vor ca. 4 Millionen Jahren. Sie gingen aufrecht, hatten große Backenzähne und ein Gehirnvolumen von bis zu 500 – 600 cm3. Die Gattung Homo entstand vermutlich vor ca. 2,5 Millionen Jahren in Ostafrika. Paläoanthropologen vermuten, dass die frühen Homo-Formen aus den grazilen Australopithecinen hervorgingen.
Der Menschentyp Homo war hinsichtlich seines Körperbaus stattlicher als der Australopithecus, sein Gehirn war größer, Kiefer und Zähne kleiner, und Extremitäten und Wirbelsäule ähnelten denen des modernen Menschen. Die Nutzung des Feuers war der größte Fortschritt in der Entstehung des modernen Menschen. Kein anderes Lebewesen auf der Erde versteht es das Feuer zu nutzen. Über die Stufe des Homo heidelbergensis entwickelten sich der Homo neandertalensis und der Homo sapiens. Die Neandertaler hatten ein Gehirnvolumen, das mit bis zu 1800 cm3 größer war als das des Homo sapiens und des Jetztmenschen.
Die Neandertaler besaßen eine hohe Werkzeugkultur (Mousterien), eine komplexe Sozialstruktur und betrieben die Großwildjagd. Sie überlebten auch unter kalten, unwirtlichen Bedingungen, z. B. im Hochgebirge sowie in Gletschernähe und wurden 30 – 40 Jahre alt. Sie bestatteten ihre Toten und sollen die Gräber mit Blumen bestreut haben.
Der Vorfahre des modernen Menschen, der Homo sapiens, tauchte vor ca. 200 000 Jahren in Afrika auf. Dieser Menschentyp glich bezüglich seiner Anatomie und einem Gehirnvolumen von 1400 cm3 weitgehend dem Jetztzeitmenschen. Seit ca. 100 000 Jahren dürfte er in der Lage gewesen sein, sich mittels einer komplexen Sprache zu verständigen. In dieser Zeit wurde das Gehirn geprägt: Die damaligen Erfahrungen beeinflussen noch heute unser Verhalten.
Erst vor 40 000 Jahren besiedelte der Homo sapiens Europa. Ab diesem Zeitpunkt setzte bei ihm ein gewaltiger kultureller Entwicklungssprung ein, der bis heute nicht erklärt werden kann. Vielleicht entstand in dieser Zeit das Arbeitsgedächtnis, so dass der Mensch Fakten aus seiner Vergangenheit behielt sowie seine Gegenwart und Zukunft planen konnte. Die Sprachfähigkeit war zumindest rudimentär ausgebildet und die nun mögliche Kommunikation führte zur Ausbildung von Hör- und vor allem auch Sprachvermögen. Die Lage des Sprachvermögens in der dominanten linken Hemisphäre des Gehirns könnte darauf hinweisen, dass die Sprachentwicklung die geistigen Fähigkeiten des Menschen entscheidend stimuliert hat. Mit der Sprachfähigkeit begann die Dominanz der Kultur über die biologische Evolution.
Tab. 2.1 Menschheitsentwicklung und Volumen des Gehirns. Das Gehirngewicht wird indirekt aus dem Volumen gefundener Schädel oder Schädelreste bestimmt.
Muße, d. h. die Zeit für eine Beschäftigung mit nicht zweckgebundenen Tätigkeiten, also weder Nahrungsbeschaffung, Versorgung mit Werkzeugen und Kleidern oder schlicht dem Schlaf, dürften unsere Ahnen zuerst vor etwa 100 000 Jahren erfahren haben. Zuvor waren die Tage mit dem Kampf ums Überleben ausgefüllt. Voraussetzungen für die Entstehung von „Freizeit“ waren ohne Zweifel die Beherrschung des Feuers, die Existenz einer schützenden Höhle, das Anlegen von Vorräten für unwirtliche Jahreszeiten und ein erhöhtes Lebensalter. Wenn man abends um das wärmende und Licht spendende Feuer saß, sind wohl die Tagesereignisse in Form |18|von Gesprächen verarbeitet worden und in dunklen Winternächten wurden dann auch Geschichten von der Jagd, von Abenteuern in der feindlichen Umwelt und von Liebe und Tod erzählt. So dürfte sich die Sprache perfektioniert haben, weil komplexe ideelle Sachverhalte kommuniziert wurden. Mit dem Sprachvermögen wurden auch das Gedächtnis und die Bewertung vergangener Ereignisse geschärft. Vielleicht gaben in diesen Nächten auch die Alten schon den Jüngeren ihre handwerklichen Kenntnisse weiter, z. B. wie man aus Flintstein Speerspitzen herstellt oder aus Fellen Bekleidung macht. Muße ist sicher eine der Grundvoraussetzungen zur Entwicklung eines sowohl technisch begabten wie kulturellen Menschen. Voraussetzung für eine derartige kulturelle Entwicklung war auch der kontinuierliche Anstieg des Lebensalters. Der Australopithecus wurde 15 Jahre alt, der Neandertaler schaffte es auf 40 Jahre, der moderne Mensch dagegen erreicht ca. 80 Jahre.
Unser prähistorisches Erbe
Es ist uns bewusst, dass unser Verhalten und Befinden, von der Geburt bis ins hohe Alter, vom genetischen Erbe, der Erziehung und von Umwelteinflüssen bestimmt wird. Aber warum reden wir von dem alten Europa und dem jungen Australien? Diese Redensart bezieht sich auch auf das Verhalten der Bewohner dieser Länder. Australier leben unkonventioneller als Europäer, sie leiden weniger unter der Last ihrer stammesgeschichtlichen Historie. Ob dies an ihren Genen oder dem Leben in einer weitgehend ursprünglichen Natur liegt, wissen wir nicht. Folgt man dieser These, so gibt es neben dem individuellen Alter auch noch ein evolutionäres Alter. Wir sind eben als Senior nicht nur 75 Jahre alt, sondern auch, zeitlich gesehen, nur ca. 3000 Generationen von den Höhlenbewohnern, seien es Homo-sapiens- oder Neandertaler-Sippen, entfernt. Für die Evolution der Arten ist dieser Abstand ein Nichts. Warum sitzen wir so gerne in einer Gruppe um ein Lagerfeuer, obwohl es uns vorne zu heiß und hinten zu kalt ist? Auch der Kamin im Wohnzimmer, denkt man nur an das Holzschleppen und das morgendliche Entfernen der Asche, ist in der Zeit von Fußboden-Heizungen ein Anachronismus. Was gibt es Schöneres, als an einem kalten Winterabend in dem zur Höhle umfunktionierten Wohnzimmer zu sitzen und gedankenverloren in die zügelnden Flammen zu schauen. Wir grillen Fleisch auf einem Holzkohlegrill, obwohl wir Gas- oder Elektroherde besitzen, die ein schonendes Garen ermöglichen. Wir verschlingen das außen verbrannte und innen noch halbrohe Fleisch in Mengen, die unserem Wohlbefinden abträglich sind. Fragt man, warum wir so seltsam handeln, so scheint die Antwort einfach zu sein: Weil es eben Spaß macht. Die Ursachen für unser scheinbar eigenverantwortliches Handeln könnten auch Gründe haben, die in unserer prähistorischen Vergangenheit liegen. Legen wir also in unserer hoch technisierten Welt Verhaltensweisen an den Tag, die auf Lebenserfahrungen oder Instinkte von Generationen zurückgehen, die 100 000 Jahre vor uns lebten? In dieser Periode konnte man noch keine Nahrungsmittel konservieren, Getreidesamen als Brot, Milch als Käse oder Fleisch als Geräuchertes oder Gepökeltes waren noch unbekannt. Der Organismus diente sowohl als Verdauungsapparat wie als Vorratskammer. Wenn man einen Wisent erlegt hatte, wurde das über dem offenen Feuer gebratene Fleisch im halbgaren Zustand in riesigen Mengen verschlungen. Aus Erfahrung wusste man, dass es Wochen dauern konnte, bis man wieder hinreichend Nahrung fand. So musste der Organismus herhalten und den Nahrungsüberschuss in Fett verwandeln und als Bauch- und Hüftspeck speichern. Auch heute noch ändern lange Hungerperioden das spätere Verhalten der Betroffenen. Soldaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Gefangenschaft immer unter Hunger litten, trieb, wieder in Freiheit, die Angst um, im Alter in materielle Not zu geraten und deshalb hungern zu müssen. Natürlich kann das heute in den Industriestaaten verbreitete Übergewicht bei vielen Menschen nicht unmittelbar auf die Essgewohnheiten der Neandertaler zurückgeführt werden, aber in unserem Bewusstsein sind evolutionäre Erfahrungen abgespeichert, die, für uns unbewusst, das Verhalten in der Gegenwart beeinflussen.
Solche Verhaltensweisen, seien sie von den Eltern übernommen oder in den Genen niedergelegt, sind im Zusammenhang mit dem Grillen von Fleisch oder der Zuneigung zu Höhlen eher amüsant. Wenn es um das Verhalten des Menschen seinen Mitmenschen gegenüber geht, dann wird die Frage nach einer Erblast, der wir nicht entkommen können, schon bedrückender.
|19|In prähistorischen Zeiten konnten Menschen in Sippen von vielleicht 50 Mitgliedern nur überleben, wenn sie sich untereinander Freund, aber allen anderen Sippen gegenüber Feind waren. Mit dem Gesicht und der Körperhaltung als Erkennungsmerkmale wusste man bei den kleinen Gruppen, wer beschützt und wer bekämpft werden musste. Die männlichen Mitglieder konkurrierender Sippen wurden erschlagen und die Frauen in die eigene Gemeinschaft eingegliedert oder auch „nur“ vergewaltigt. Damals muss sich, um das eigene Überleben und die weitere Existenz der Sippe zu sichern, das Freund-Feind-Denken herausgebildet und im Erbgut verankert haben, Es scheint heute noch weitgehend das Zusammenleben der Rassen, Völker und Glaubensgemeinschaften zu bestimmen. Den Freund und den Glaubensbruder gilt es zu schützen und zu achten, während es ehrenhaft zu sein scheint, möglichst viele Feinde zu erschlagen. Wer von staatlichen Autoritäten zum Feind erklärt wird, darf getötet werden, ohne dass der Täter eine Strafe fürchten muss. Trotz des christlichen Gebotes der Nächstenliebe, trotz Aufklärung und Humanismus hat sich das Verhalten der Menschen bis heute nicht geändert; noch immer gilt die Devise „Homo homini lupus“, der Mensch dem Menschen ein Wolf. Dieses Freund-Feind-Denken scheint sich in unsere Gene und Gehirne eingegraben zu haben, wie die Rampe von Auschwitz, der Völkermord in Ruanda oder die Erschießung bosnischer Männer auf erschreckende Weise dokumentieren.
Lange war unklar, wie Erlebnisse zurückliegender Generationen unsere Erbanlagen und damit unser Verhalten so verändern, dass wir Verhaltensweisen pflegen, die für das Leben in der heutigen Zivilisation anachronistisch anmuten. Die sog. Epigenetik (→ Kap. 5) liefert Erklärungen zur strukturellen Basis für dieses zumeist nicht erklärbare Verhalten.
Das individuelle Alter
Wenn man das Vierte Quartal als den letzten Lebensabschnitt eines Menschen bezeichnet, so gehen ihm zuerst die Periode der Kindheit und anschließend die der Jugend sowie des Erwachsenen voraus. Unter der Bezeichnung „das 4. Quartal“, im Amerikanischen oft als „Q4“ abgekürzt, versteht man im Alltag allerdings zumeist den letzten Abschnitt eines Geschäftsjahres.
Man darf zwar über das Alter sprechen, aber man sollte mit dem Begriff „die Alten“ vorsichtig umgehen. Zwar spricht die Gesellschaft über die Alten, die Betroffenen allerdings meiden diese Bezeichnung und empfinden sie als abwertend. So werden Zeitgenossen, die das 60. Lebensjahr überschritten haben, in unserer konsum- und freizeitorientierten Gesellschaft neuerdings als Senioren bezeichnet. Marketingstrategen haben uns beigebracht, dass wir den Begriff Altenheim durch Seniorenresidenz ersetzen sollen und ein Restaurant einen Seniorenteller anbietet, aber bitte kein Altengericht. Das Wort „senior“ kommt aus dem Lateinischen und steht für älter. Bevor man die Alten als Konsumentengruppe entdeckte, wurde es nur in einem engen Kontext benutzt, z. B. für einen älteren Herren in einer studentischen Verbindung. So hat der Begriff Senior oder Senioren nach 1970 eine semantische Verschiebung im Sinne einer Begriffserweiterung erfahren und steht für alle Alten, die am gesellschaftlichen Leben aktiv teilnehmen. Während man früher nur die Altersgruppe der etwa 14- bis 49-Jährigen als werberelevante Jahrgänge betrachtete, wurden in den Jahren wachsenden Wohlstands die Rentner, da sie ihr Einkommen nicht mehr mit den Kindern teilen müssen, als ausgabenfreudige Klientel von der Konsumgüterindustrie entdeckt. Die „woofs“ (well off older folk) geben ihre Rente wie ihr Erspartes nach dem Motto „ mitnehmen kannst du es nicht“ großzügig für Reisen und Konsumgüter aus. Daraus resultieren für die Gruppe der Senioren vielfältige Angebote, wie z. B. Seniorenreisen, Seniorenfahrkarten oder Seniorennachmittage. Leider gibt es noch keine Seniorencomputer, obwohl 15 % aller über 65-Jährigen täglich das Internet benutzen.
Für die Alten zwischen 90 und 110 Jahren, die man landläufig immer noch gern Greise nennt, gibt es noch keine angenehmer klingende Bezeichnung. Da sich ihre Gruppe ständig vergrößert und sie damit marktrelevant wird, dürfte über kurz oder lang den Werbestrategen ein Begriff einfallen, der möglicherweise auf das griechische Wort „Geron“ für Greis zurückgreift.
Glaubt man den Berichten im Alten Testament, so wurde Methusalem, selbst heute noch ein Synonym für hohes Alter, 969 Jahre alt und zeugte noch im Alter von 187 Jahren seinen Sohn Lamech. Der chinesische Botaniker Professor Li Ching Yuen soll je nach verschiedenen Quellen zwischen 197 und 256 Jahre |20|alt geworden sein und 23 Ehefrauen überlebt haben. Es gibt zahllose Berichte über Männer und Frauen aus vielen Ländern, die ein Alter zwischen 150 und 200 Jahren erreicht haben sollen. Leider sind diese Angaben nicht durch Geburtsurkunden oder andere Dokumente belegt. Die Japaner haben offiziell die längste Lebenserwartung weltweit. 230 000 Einwohner Japans, die laut Melderegister über 100 Jahre sein sollen, sind unauffindbar. Die Angehörigen melden den Tod des Verwandten nicht, weil sie weiter die Rente kassieren wollen. So fand die Polizei in Tokio 2010 heraus, dass Sogen Kato, der mit 111 Jahren älteste Einwohner Tokios, schon seit 32 Jahren tot war. Als derzeitig ältester Mensch gilt die im August 1997 verstorbene Französin Jeanne Calment.
Ihre 122 Jahre und 164 Tage stellen die längste bisher zweifelsfrei dokumentierte Lebensdauer dar. Der von Wissenschaftlern akzeptierte Altersrekord bei Männern gebührt Christian Mortensen, der im Alter von 115 Jahren verstarb. Maria Laqua weist mit 112 Jahren das höchste in Deutschland erreichte Lebensalter bei den Frauen, Hermann Dörnemann mit 111 Jahren das bei den Männern auf.
2.2 Mme. Jeanne Calment, die älteste Frau Europas. Sie starb in Frankreich im Alter von 122 Jahren.
Schaut man sich die Liste der hundert ältesten Menschen an, so ist zum einen auffällig, dass es keine geographischen Inseln für Langlebigkeit gibt, und weiterhin, dass die „Supercentenarians“ alle zwischen dem 110. und 120. Lebensjahr versterben. Zu berücksichtigen ist auch, dass es in vielen Entwicklungsländern selbst heute noch kaum exakte Geburts- und Sterberegister gibt.
Überlässt man den Naturwissenschaftlern das Thema Altern, so gehen sie von einer Begriffsdefinition aus, die besagt: „Altern ist ein degenerativer biologischer Prozess, der mit zunehmendem Lebensalter zu psychischen und physischen Abnutzungserscheinungen führt und zumeist zwischen dem 50. und 65. Lebensjahr beginnt.“ Man unterscheidet zwischen dem chronologischen und dem biologischen Alter, eine Differenzierung, die der Volksmund zu dem Sprichwort „Man ist so alt, wie man sich fühlt“ vereinfacht. Altern bezeichnet einen Prozess und Seneszenz einen Zustand. Die Überlebensrate nimmt im Alter exponentiell ab, die Mortalitätsrate dagegen exponentiell zu. Das Altern wird mit der „Mortality Rate Doubling Time“ (MRDT) von acht Jahren charakterisiert, d. h., alle acht Jahre verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit zu sterben. Die individuelle biologische Alterung hängt von den sozioökomischen Bedingungen, der genetischen Konstitution, dem emotionalen Umgang mit Problemen („Coping“) und der Häufigkeit von chronischen Erkrankungen ab. Das Phänomen Altern einfach als Verschleißerscheinungen („wear and tear“) an der Hochleistungsmaschine Mensch zu kategorisieren, greift zu kurz. Nerven- und Muskelzellen müssen von der Geburt bis zum Tod durchhalten, während Darm- und Blutzellen innerhalb von Tagen oder Wochen erneuert werden. Somit ist ein 50-Jähriger mit Bezug auf seine Nervenzellen alt, aber ein 80-Jähriger im Hinblick auf seine Darmzellen noch jung.
Fragt man 60-Jährige, so steht der Wunsch nach Lebensqualität, vor allem nach Gesundheit und finanzieller Sicherheit, im Vordergrund. Healthy Active Life Expectancy (HALE) lautet die Kurzformel für den Wunsch der Senioren nach einem möglichst langen, beschwerdefreien und vielleicht sogar glücklichen Alter. Je mehr man sich dem Hohen Alter nähert, umso größer wird der Wunsch nach ein paar zusätzlichen Jahren oder, falls nicht erfüllbar, nach einem würdevollen Tod ohne Leiden (→Tab. 1).
|21|
Tab.2.2 Sterbetafel (2008); herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden.
Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug um 1900 in den Industriestaaten Europas nur 45 Jahre, während ein im Jahr 2010 geborener Junge mit 76, ein neugeborenes Mädchen mit 82 Lebensjahren rechnen kann.
Vor 100 Jahren waren 5 % der Bevölkerung 60 Jahre oder älter. Heute sind es 25 % und in etwa 25 Jahren werden 28 % der Bevölkerung über 60 und nur etwa 17 % unter 20 Jahre alt sein. Nicht nur die zu vielen Alten stellen ein künftiges Problem dar, sondern auch die zu wenigen Jungen – d. h. die geringe Geburtenrate. Dieser schnelle, sog. demographische Wandel, stellt nicht nur die Rentensysteme vor neue Herausforderungen, sondern betrifft fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens, wie z. B. die Bildung, die Dauer des Berufslebens oder die medizinische Versorgung. Nicht nur die Zahl der 60- bis 90-Jährigen nimmt rapide zu, sondern auch die der über 100-Jährigen, der sog. Supercentenarians. 1965 lebten in Deutschland 265 Hundertjährige, für 2050 rechnet man mit über 117 000 Menschen mit einem dreistelligen Geburtstag. Ein Drittel der Bürger im hohen Alter kann noch alleine den Alltag meistern, ein Drittel ist pflegebedürftig, kann aber noch außer Haus gehen und das letzte Drittel ist schwer pflegebedürftig und sehnt oft den Tod herbei. Der schnelle Wandel zu einer „Gesellschaft der Grauhaarigen“ ist durch die verbesserte Lebensqualität bedingt, die politischen Reaktionen auf den alle Gesellschaftsschichten umfassenden Prozess verzetteln sich in Diskussionsforen.
Je älter wir werden, umso weniger sagt das Lebensalter etwas über Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen, Verhalten und Erlebnisweisen aus. Gleichaltrige zeigen oft größere Unterschiede in ihrem Verhalten als Menschen, deren Altersunterschiede 20 oder 30 Jahre betragen.
Altern ist stets das Ergebnis eines lebenslangen Prozesses mit ureigenen Erfahrungen sowie mit ganz individuellen Formen im Umgang mit Problem- und Belastungssituationen. Unsere Ausbildung, unser Interesse an Neuem sowie unsere körperlichen Aktivitäten in jüngeren Jahren beeinflussen entscheidend Alterszustand und Altersprozess.
Chronologisch alte Menschen, d. h. die älter als 60-Jährigen, fühlen sich selbst, solange sie gesund sind, nicht als alt im Sinne von nutzlos. Befreit von den Fesseln des Berufs, reisen sie bis in die entlegenen Gebiete der Welt, belegen Kurse an der Volkshochschule, werkeln an Haus und Wohnung, kümmern sich um die Enkel oder schreiben auf dem neuen Laptop Eingaben an die Behörden. Erst im hohen Alter häufen sich Bewegungsunfähigkeit und schwindende mentale Fähigkeiten, die zur Bettlägerigkeit und dem Verlust der personalen Existenz führen. Ab dann ist man auf die Hilfe von Verwandten oder von Organisationen, ob staatlich, karitativ oder kommerziell, angewiesen.
|22|Allerdings wird das Ausmaß an Pflegebedürftigkeit alter Menschen zumeist überschätzt. Pflegebedürftigkeit fällt oft erst in der Gruppe der über 85-Jährigen ins Gewicht und betrifft dort auch nur 30 % der Hochbetagten. So sind noch 70 % dieser Gruppe in der Lage allein und kompetent ihren Alltag zu meistern. Bei Schätzungen im Hinblick auf den Anteil der Pflegebedürftigen von morgen, da voraussichtlich weit mehr über 90-Jährige in unserer Gesellschaft leben werden, sollte man vorsichtig sein. Die Hochaltrigen von heute sind viel gesünder, als es ihre über 60-jährigen Eltern und Großeltern waren. Werden heute noch 70 % der Pflegebedürftigen in der Familie versorgt, so wird in Zukunft die Pflege in der Familie die Ausnahme sein. Die Pflegebedürftigen werden immer älter und damit auch die Pflegenden. Wegen der abnehmenden Kinderzahlen kann die Versorgung ihrer Eltern nicht mehr unter den Geschwistern aufgeteilt werden und aufgrund der für den Berufserfolg erforderlichen Mobilität liegen die Wohnorte von Eltern und Kindern oft weit auseinander.
Fragt man, was die Lebenssituation der Senioren nach 1970 in den Industriestaaten so entscheidend verbessert hat, so ist es vor allem das bis zum Tod gesicherte Einkommen. Es ist der Finanzstatus, der eine gute Krankenversorgung, eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und eine Verwirklichung jener Träume, die man als Jugendlicher aus Geldmangel nicht realisieren konnte, ermöglicht. Ein Blick zurück in die Historie zeigt, dass es für Senioren, mit Ausnahme der armen Alten, in Deutschland nie einen Zeitraum gegeben hat, in dem sie eine solche Lebensqualität genießen durften, wie heute.
Literaturangaben
5. Altersbericht des Deutschen Bundestages 2007: Potentiale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft.
Conard, N., Kölbl, S. Schürle, W. (2005): Vom Neandertaler zum modernen Menschen. Thorbeke, Ostfildern
Henke, W., Rothe, H. (1998): Stammesgeschichte des Menschen. Springer, Heidelberg
Hufeland, C. W. (1804): Makrobiotik oder die Kunst das menschliche Leben zu verlängern. Berlin
Lehr, U. (2006): Psychologie des Alterns. Quelle & Meyer, Heidelberg
Paul, A. (1998): Von Affen und Menschen. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
Schrenk, F. (2005): Die Frühzeit des Menschen. Becksche Reihe, C. H. Beck, München
Statistisches Bundesamt Deutschland (2008): Sterbetafeln, Wiesbaden