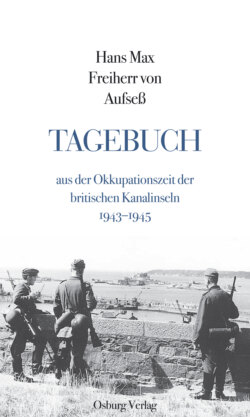Читать книгу Tagebuch aus der Okkupationszeit der britischen Kanalinseln - Hans Max Freiherr von Aufseß - Страница 6
Der gute Deutsche von Jersey? Hans Max Freiherr von Aufseß und seine Tagebücher von den Kanalinseln
ОглавлениеIn der 2004 vom britischen Sender ITV produzierten Fernsehserie ›Island at War‹ spielt ein fiktiver ›Heinrich Baron von Rheingarten‹ als deutscher Besatzungskommandeur der ebenfalls erfundenen Kanalinsel St. Gregory eine wichtige Rolle. Nach der Eroberung der Kanalinseln errichten die deutschen Okkupanten rasch ein rigides Unterdrückungsregime. Der Baron wird dabei allerdings als ein gefühlvoller, verheirateter Mann gezeichnet, der die deutsche Heimat und seine Frau vermisst. Er tritt zwar als energischer Offizier auf, nimmt aber dennoch humanitäre Rücksichten auf einen Teil der Einwohner. Dabei distanziert er sich mit überheblicher Attitüde und aus Perspektive eines Adeligen und Militärs ›alter Schule‹ vom fanatisierten Nationalsozialismus. Sein eigenes Tun als feindlicher Besatzer und seine Rolle im großen Eroberungs- und Vernichtungskrieg stellt er jedoch nicht in Frage. In die Figur des ›Heinrich von Rheingarten‹ sind unverkennbar einige Charakterzüge eines realen Barons bzw. ›Freiherrn‹ und Vertreters des deutschen Repressionsapparats eingeflossen: Hans Max Freiherr von und zu Aufseß. Von Aufseß leitete von 1942 bis 1945 die Zivilverwaltung während der deutschen Besatzung auf den britischen Kanalinseln. Der Unterschied zwischen beiden Baronen liegt allerdings im Ausmaß der Kompetenzen. Während der fiktive Baron der TV-Serie die Inseln beherrscht, ist der reale Baron letztlich eine Randfigur, die nur über ihre zum ersten Mal nun auf Deutsch veröffentlichten Tagebücher in der Geschichte der Kanalinseln eine gewisse Bekanntheit erlangen konnte.
Die immerhin fünf Jahre lang währende Okkupation eines direkt der Krone unterstellten Teils Großbritanniens ist ein in Deutschland noch immer wenig bekanntes historisches Ereignis. Ganz anders ist dies auf den britischen Inseln. Der gewonnene Zweite Weltkrieg, der siegreiche Kampf gegen das häufig verkürzt sogenannte ›Hitler-Deutschland‹ ist noch immer für die britische Identität von größter Bedeutung. Die Erinnerung an beide Weltkriege hat in Großbritannien und den Ländern des Commonwealth bis heute die Funktion, eine ruhm- wie verlustreiche Geschichte des Sieges von Recht, Freiheit und Zivilisation gegen die vermeintlichen deutschen ›Hunnen‹ zu tradieren. Man kann die Wirksamkeit dieses Narrativs für Briten aller Altersstufen nicht hoch genug einschätzen. In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, dass die insgesamt für beide Seiten wenig heroische Geschichte der deutschen Besatzung eines kleinen Teils Britanniens dort noch immer überaus präsent ist. In Deutschland hingegen ist dieser Teil der Kriegsgeschichte als kleine Episode vor dem Hintergrund des großen Dramas aus Bombenkrieg, Vertreibung und Menschheitsverbrechen lange Zeit weitgehend vergessen worden.
Dieses Ungleichgewicht in der Wahrnehmung lässt sich auch in der nach 1945 veröffentlichten Literatur zu den Ereignissen auf Jersey, Guernsey, Sark und Alderney erkennen. Bereits 1945 publizierten erste britische Zeitzeugen ihre Erinnerungen1, wobei diese Berichte von unmittelbar Handelnden im Hinblick auf die eigene Rolle und das Verhalten der Deutschen apologetische Züge tragen. Unmittelbar nach den Ereignissen scheint auch die englische Seite kein Interesse an Kritik oder gar Selbstkritik gehabt zu haben. Auch später noch veröffentlichen Zeitzeugen ihre Erinnerungen, so wie beispielsweise der aus Guernsey stammende und 1944 deportierte Journalist Frank Falla, der seine Erinnerungen 1967 unter dem Titel ›The Silent War‹ herausbringt.2 Auch in der schon 1961 erschienenen Autobiographie Sibyl Hathaways, als ›Dame of Sark‹ Feudalherrin des gleichnamigen Kanalinselchens, spielt die Okkupationszeit eine große Rolle.3 Die Erinnerungen des ›Bailiff‹, des britischen Verwaltungschefs auf Jersey, Lord Coutanche, werden 1975 publiziert.4
Auf deutscher Seite erscheint 1963 lediglich eine grob verharmlosende Schrift von der Hand Dr. Wilhelm Caspers, eines ehemaligen Gestapo-Beamten5 und von 1940 bis 1942 Vorgänger des Freiherrn von Aufseß als Leiter der zivilen Besatzungsverwaltung.6 Casper versucht in seinem Buch, das vorgeblich tadellose Verhalten der deutschen Besatzer mit englischen Zeugenaussagen zu belegen. Er bezieht sich dabei vor allem auf die direkt 1945 veröffentlichten Schriften britischer Zeitzeugen. Über das »Insel-KZ Alderney«7, Tausende Zwangsarbeiter und deportierte Juden verliert Casper dabei aber kein Wort. Sein Buch ist, trotz aller Einwände gegen ein typisches Produkt deutscher Verdrängungs- und Verleugnungskultur der ersten Jahrzehnte nach dem Krieg, eine gute Quelle für das Verständnis der deutschen Verwaltungszusammenhänge während der Besatzung.
Schon in den 50er-Jahren setzt in Großbritannien eine Welle mehr oder weniger sachlicher Sekundärliteratur zum Thema ein. Den Anfang machen zehn Jahre nach Kriegsende Alan und Mary Wood, die 1955 ihre Studie ›Islands in Danger‹ veröffentlichen.8 Es folgen seit den 70er-Jahren weitere Überblicksdarstellungen9, aber auch Spezialabhandlungen zu den Zwangsarbeitern, zu Deportationen von Inselbewohnern10 und zu den deutschen Befestigungsanlagen11. Mit Roy McLoughlins Buch ›Living with the Enemy‹12 aus dem Jahr 1995 und Madeleine Buntings im selben Jahr erschienener Studie ›The Model Occupation‹13 setzt eine zunehmend kritischere Sicht auch auf die Rolle der Kanalinselbewohner zur Zeit der Besatzung ein. Bunting betont 1995 in der englischen Wahrnehmung der Kanalbesetzung bis dahin verdrängte Schattenseiten, insbesondere das Desinteresse der Insulaner am Schicksal jüdischer Mitbürger. Diese Kritik Buntings veranlasste im Folgenden weitere Untersuchungen zur Zusammenarbeit der englischen Behörden bei der Verfolgung der kleinen jüdischen Inselgemeinde.14 Wegen der starken, in Großbritannien durchaus umstrittenen Wirkung, die das nicht immer exakt recherchierte Buch von Bunting entfaltete, wird es 2004 ein zweites Mal aufgelegt. Im Jahr 2004 wird mit Joe Mières Buch ›Never to be forgotten‹ ein zwar anekdotenhaftes, dabei zum Teil mit präzisen Angaben überzeugendes Erinnerungsbuch eines Zeitzeugen vorgelegt.15 Ebenfalls von Bedeutung sind die neueren Darstellungen von Barry Turner, ›Outpost of Occupation‹16 aus dem Jahr 2010, Michael Ginns ›Jersey Occupied‹17, eine 2009 erschienene Gesamtdarstellung, und von Paul Sanders, der 2005 ›The British Channel Islands Under German Occupation‹18 veröffentlicht. Sanders’ akribisch auf Grundlage der umfangreichen Akten erarbeitete Studie stellt wohl die bis heute gründlichste Darstellung der Besatzungszeit dar. Mit Bunting, der er bescheinigt, für »a lot of bad blood«19 gesorgt zu haben, geht Sanders stellenweise hart ins Gericht. Mit den unterschiedlichen Formen des Widerstands einiger Inselbewohner beschäftigt sich zuletzt 2014 der umfangreiche und detaillierte Sammelband ›Protest, Defiance and Resistance in the Channel Islands‹ von Gilly Carr, Paul Sanders und Louise Willmot.20 Simon Hamon legt 2015 einen Band mit Zeitzeugenberichten zur Invasion der Insel vor.21 Die neueste Veröffentlichung zum Thema stammt von Duncan Barrett, der 2018 ein Buch mit dem Titel ›Hitler’s British Isles‹ auf den Markt bringt.22
Dem deutschen Publikum allerdings bleiben die Ereignisse auf den Kanalinseln und damit auch die Rolle des Freiherrn Hans Max von Aufseß nach dem schmalen Büchlein von Casper lange unbekannt. Erst die reich bebilderte deutsche Ausgabe des Buches von McLoughlin, die 2003 unter dem schon häufig ähnlich variierten Titel ›Britische Inseln unterm Hakenkreuz‹23 erscheint, ändert dies. Im Jahr 2012 veröffentlicht der weltweit als ›Inspector Barnaby‹ bekannte und mit Jersey eng verbundene Schauspieler John Nettles eine Darstellung zum Thema, die unter dem Titel ›Jewels and Jackboots. Hitler’s British Channel Islands‹24 für größere Aufmerksamkeit sorgte. Im Osburg Verlag Hamburg wird dann 2015 die deutsche Übersetzung des Buches von Nettles unter dem Titel ›Hitlers Inselwahn‹25 veröffentlicht und erreicht mit ungefähr 3000 verkauften Exemplaren die bis dahin größte Aufmerksamkeit für das Thema in Deutschland. 2017 zeigt das Zweite Deutsche Fernsehen im Rahmen der Reihe ›ZDF-History‹ eine TV-Dokumentation, in der John Nettles auf Grundlage seines Buches von der Besatzungszeit berichtet und das Thema so noch einem breiteren Publikum vorstellt. Ein Roman der populären deutschen Schriftstellerin Charlotte Link mit dem Titel ›Die Rosenzüchterin‹, der im Jahr 2000 veröffentlicht wird, handelt zumindest in Teilen von der Okkupationszeit auf Guernsey.26
Den Bekanntheitsgrad, den das historische Ereignis der Okkupationszeit auf den Kanalinseln bis in die Gegenwart in der englischsprachigen Welt besitzt, erreicht das Thema in Deutschland trotz ›Inspector Barnaby‹ alias John Nettles, Charlotte Link und TV-Dokumentationen nicht. Die für die deutsche Identität zentrale, aus nationalsozialistischen Verbrechen, Jahrzehnte währender Teilung, gewissenhafter Aufarbeitung der Schuld und schließlich glücklich wiedergewonnener Einheit zusammengesetzte Erzählung ist so dominant, dass das Schicksal unscheinbarer britischer Inseln westlich der Normandie dagegen als Kleinigkeit erscheinen muss.
Das stellenweise sehr persönliche Tagebuch von Aufseß, das dieser vielleicht während eines Teils seiner Zeit auf Jersey verfasste, ist in Großbritannien bereits seit 1985 präsent, als Kathleen J. Nowlan auf Grundlage eines maschinenschriftlichen und überarbeiteten Typoskripts von Hand des Freiherrn eine englischsprachige Ausgabe veröffentlicht. Diese erscheint unter dem Titel ›The Von Aufsess Occupation Diary‹.27 Von Aufseß steuert zu dieser Ausgabe ein Vor- und Nachwort bei. Seine Initiative, das Tagebuch in Deutschland zu veröffentlichen, scheitert mehrmals.28 Dass eine kritische Einordnung des Tagebuches in den historischen Zusammenhang oder eine Untersuchung der Glaubwürdigkeit des Textes 1985 unterbleiben, kann bei der direkten Beteiligung des Freiherrn nicht überraschen. In John Nettles’ Darstellung ist das Tagebuch prominent eingeflossen – ebenso wie offensichtlich in das TV-Drama ›Island at War‹.
Freiherr von Aufseß ist in Deutschland vor allem im bayerischen Raum bekannt, trat er doch nach dem Krieg vor allem als Autor populärwissenschaftlicher Bücher zur fränkischen Heimat- und Kulturgeschichte hervor.
Diese nun vorgelegte deutsche Edition seiner in vielerlei Hinsicht interessanten und aufschlussreichen Tagebücher soll das Thema der Besatzung der Channel Islands ein wenig auch in den Mittelpunkt deutschen Interesses rücken, gleichzeitig aber auch der ambivalenten Figur des Freiherrn von Aufseß neue Facetten hinzufügen.