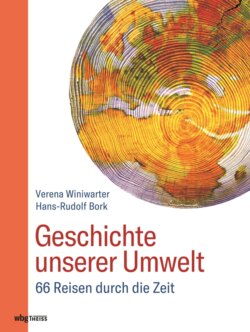Читать книгу Geschichte unserer Umwelt - Hans-Rudolf Bork - Страница 13
DIE ZEIT SEIT 1850 – EIN UMWELTHISTORISCHER SONDERFALL
ОглавлениеHeute leben wir im Zeitalter der Globalisierung. Niemals vorher konnten Rohstoffe, andere Waren und Menschen in solchem Umfang und über solche Distanzen transportiert werden, wie heute (vgl. Kapitel 2.3 Transport, Handel und Umwelt, S. 52). Nie zuvor waren einige Menschen so einflussreich und mit so vielen Gütern ausgestattet. Niemals zuvor wurden natürliche Systeme so sehr verändert und unter Druck gesetzt. Seit 2009 hat eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe sich mit den Grenzen beschäftigt, innerhalb derer die Menschheit ihr Überleben sichern kann. (Abbildung oben). Drei Grenzen sind mit hoher Sicherheit bereits überschritten: die Folgen von Eingriffen in die biogeochemischen Kreisläufe von Stickstoff und Phosphor und das Artensterben liegen noch deutlicher außerhalb des Toleranzraums als der Klimawandel. Neue Substanzen umfassen auch synthetische Chemikalien wie DDT oder Dioxin sowie künstliche Elemente wie Plutonium, modifizierte Lebensformen genetisch veränderte Organismen. Die graue Farbe zeigt nur an, dass eine Quantifizierung schwierig ist, nicht, dass es sich nicht um große Probleme handelt (STEFFEN et al., 2015).
Frontispiz eines LANDWIRTSCHAFTLICHEN HAUSBUCHES aus dem 18. Jahrhundert Unterhalb der intensiv genutzten Kulturlandschaft ist zu lesen: »Natur mit Kunst genau vereint, bezwingt was sonst unmöglich scheint.«
Das erstmals 2009 publizierte Konzept der »Planetaren Grenzen« prägt inzwischen die internationale Umweltdebatte. Der Status der Kontrollvariablen für wichtige ökosystemare Belastungsgrenzen ist hier für 2015 dargestellt. Die grüne Zone ist der sichere Überlebensraum für die Menschheit, er ist mit einer dicken Linie abgegrenzt. Weiter außen folgen die Zone der Unsicherheit (zunehmendes Risiko), dunkelrot ist die Hochrisikozone. Die Mitte der Abbildung stellt keine Werte von o für die Sektoren dar, weil die Variablen normiert wurden. Die für den Klimawandel angezeigte Regelgröße ist die atmosphärische CO2-Konzentration. Prozesse, für die die Grenzen auf globaler Ebene noch nicht quantifiziert werden können, werden durch graue Sektoren dargestellt; dies sind die Belastung durch atmosphärische Aerosole, neue Substanzen und modifizierte Lebensformen sowie die funktionale und genetische Vielfalt der Biosphäre. Globale Mittelungen sind zwar problematisch, zur Verdeutlichung der Probleme ist ihre Verwendung jedoch unvermeidbar. (STEFFEN et al., 2015).
Erst die unbeherrschte und scheinbar unbegrenzte Nutzung fossiler Energieträger – der schnelle Verbrauch von über Jahrmillionen angesammelter und zersetzter Biomasse – ermöglicht das extreme Ausmaß an Eingriffen in die Systeme der Erde. Entsprechend groß sind die Nebenwirkungen. Schon vorher haben Menschen lokal und regional massiv in die Natur eingegriffen. Viele Geschichten dieses Buches zeigen, dass unsere Umweltprobleme nicht mit der Industriellen Revolution angefangen haben (vgl. Kap. 2.2. Mensch und Natur in Agrargesellschaften, S. 28). Sie werden mit dem absehbaren Ende des fossilen Zeitalters auch nicht plötzlich enden. Die auf fossiler Energie basierende Technologie hat uns kurzfristig beispiellose vorwiegend wirtschaftliche Erfolge ermöglicht. Der erfolgreiche Kampf gegen Krankheiten und die immer besser beherrschte Kunst, Energie zu gewinnen, sind zweifelsohne großartige Leistungen. Doch auch hier gibt es Rückkopplungen und unerwünschte Nebenwirkungen.
Seit den 1970er-Jahren wird versucht, den menschlichen Gesamteinfluss auf die Umwelt messbar zu machen, dafür »Indikatoren« zu entwickeln, um feststellen zu können, ob unsere Schutzmaßnahmen die gewünschte Wirkung haben. Der US-amerikanische Biologe und Umweltpolitiker Barry Commoner (1917–2012) schlug 1972 vor, den menschlichen Einfluss auf die Umwelt als Produkt der Anzahl der Menschen, ihres Reichtums und ihrer Technologie zu messen. Diese »IPAT«-Formel ist viel kritisiert worden, hat aber den Vorteil, die historische Entwicklung sichtbar zu machen. Seit 1900 hat sich unser Einfluss auf die Umwelt mehr als vertausendfacht (siehe Abb. Seite 12).
Können wir von der Technik, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute stehen, Lösungen erwarten? Menschen entwickeln und nutzen Technik. Sie haben damit die Möglichkeit und die Verantwortung, über ihren Einsatz zu entscheiden. Der technikkritische Philosoph Günter Anders hat bereits 1956 darauf aufmerksam gemacht, dass Technologie eine immer größere Kluft (»prometheisches Gefälle«) zwischen Menschen und den von ihnen hergestellten Produkten schafft. Die Kluft zwischen den Fähigkeiten des Denkens, Wissens und Herstellens sowie den möglichen Konsequenzen des individuellen und kollektiven Handelns von Menschen wird immer größer. Wir können viel mehr herstellen, als wir nutzen und verantworten können (ANDERS, 1956). Haben Menschen etwas geschaffen, können sie es nicht mehr folgenlos beseitigen – ob es nun Atombomben oder Spurengase in der Atmosphäre sind. Heute ist schon vieles für die Zukunft vorentschieden. Der Blick in die Geschichte lehrt, wie viel (vgl. Kap. 2.5. Die vielen Gesichter der industriellen Lebensweise, S. 96).
Die IPAT-FORMEL: Der Einfluss des Menschen auf die Umwelt resultiert nach Barry Commoner (1972) aus der Anzahl der Menschen, deren Reichtum und der Technologie.
Fossile Energie treibt Gesellschaften an. Die Verteilung der Lasten und des Nutzens ist jedoch sehr unterschiedlich. Der lächelnde Plantagenarbeiter, der französischen Kindern eine Bananenstaude bringt – als ideale Nahrung, wie der erläuternde Text zu dieser Postkarte betont – steht für die Ausbeutung von Menschen überall dort, wo sie sich nicht wehren (können) und gezwungen sind, sich für den Reichtum Weniger opfern zu lassen (vgl. Kap. 2.4. Koloniale Wirtschaft und Umwelt, S. 70). Und so schließt sich der Kreis zur Nachhaltigkeit: Die sozialen, wirtschaftlichen und Umweltprozesse müssen in eine Balance gebracht werden, wollen wir dauerhaft eine ausreichende Lebensqualität für alle Menschen ermöglichen.
WERBEPOSTKARTE für FRANZÖSISCHE BANANEN des 1932 gegründeten »Comité interprofessionnel bananier pour la défense de la banane des colonies françaises«. Auf der Rückseite ein Rezept für Bananenmilch als Kindernahrung.