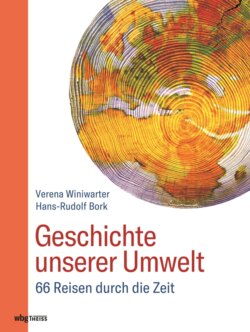Читать книгу Geschichte unserer Umwelt - Hans-Rudolf Bork - Страница 14
EIN FORSCHUNGSREISEFÜHRER
ОглавлениеUmweltverschmutzung, Proteste dagegen, die Staubstürme im Amerika der 1930er-Jahre – denen die betroffene Region ihren Namen Dust Bowl (Staubschüssel) verdankt –, die Zerstörung von Urwäldern und das Aussterben von Spezies waren früh Themen der Umweltgeschichte. Wichtige Fragen wurden behandelt: Wie funktionierte die Landwirtschaft vor der Industriellen Revolution? Gab es eine Holznot im 18. oder im 19. Jh.? Sind die Quellen zu Holzknappheit und Waldfrevel Ausdruck einer realen Knappheit oder eines Expertenstreits? Welche Maßnahmen wurden in den verschmutzten und unhygienischen Städten des 19. Jh. gesetzt, um gesündere Lebensbedingungen und eine sauberere Umwelt zu schaffen? Welche Änderungen haben Menschen über die Jahrhunderte an einem Flusssystem wie dem Columbia River in den USA vorgenommen, und wie wurde über die verschiedenen, einander ausschließenden Nutzungen verhandelt? Wie hat sich das Klima in Europa seit dem Mittelalter entwickelt und wie kann Klimarekonstruktion in Kombination natur- und geisteswissenschaftlicher Methoden unternommen werden? (WINIWARTER & KNOLL, 2007)
Umweltgeschichte ist auch eine Geschichte der Macht über Ressourcen und des Konflikts um Nutzungen. Gerade die Geschichte der Kolonien handelt von Ausbeutung und Zerstörung – von Brasilien bis Indonesien, von Peru bis Lesotho, von Massachusetts bis Sibirien (vgl. Kap. 2.4. Koloniale Wirtschaft und Umwelt, S. 73). Die thematische Breite der englischsprachigen Umweltgeschichte und die Menge an Monographien, Sammelbänden und Zeitschriftenbeiträgen sind inzwischen sehr groß. Neuere Themen, die sich gerade erst in Entwicklung befinden, sind die Umweltgeschichte der Kriege, die Umweltgeschichte des Bodens, die Umweltgeschichte der (Natur-)Katastrophen sowie umwelthistorische Untersuchungen zum Mittelalter.
Die Umwelteffekte menschlicher Eingriffe treten manchmal schleichend und manchmal sehr schnell ein. Sie wirken auf alle Umweltsysteme und damit auf alle Lebewesen. Überraschungen sind normal. Wir vermögen ausgestorbene Tiere nicht wieder lebendig zu machen. Können wir verhindern, dass weitere aussterben? Wir vermögen die Natur früherer Zeiten nicht wiederherzustellen. Können wir aber für ihre und damit unsere Zukunft Vorsorge tragen? Dafür müssen wir über frühere Nutzungen und den Zustand vergangener Landschaften Bescheid wissen. Umweltgeschichte ist die Wissenschaft von den Beziehungen zwischen Menschen und ihrer Umwelt in der Vergangenheit für die Zukunft. Wir wünschen eine gute (Forschungs-)Reise!
Natur, Kultur und Umwelt
Wir verwenden in diesem Buch »Natur« oder »Umwelt« nahezu synonym, denn auch »Umwelt« verweist auf ein »Außen«, um das wir uns bemühen und sorgen. Während der Begriff Natur in Europa seit der Antike verwendet wird, ist die Begriffsgeschichte des Wortes Umwelt weit kürzer. In der deutschen Sprache wurde es 1800 erstmals als Begriff genutzt (WINIWARTER, 1994). Für das Verhältnis der beiden Wörter haben die deutschen Historiker Wolfram Siemann und Nils Freytag die folgende Konstellation vorgeschlagen: Der Mensch sei auf Natur angewiesen, diese wiederum werde durch Existenz und Einwirkungen des Menschen zur Umwelt, die ihn umgibt, aber auch formt (SIEMANN & FREYTAG, 2003: 12f.).
Wie hängt Kultur mit Natur zusammen? Natur wird zweifelsohne durch Menschen als das Gegenstück zur Kultur konstruiert und durch das Ziehen der Grenze zum Anderen, dem Außen, konstituiert. Das Außen gilt als ungekocht, roh, ungezähmt, wild, nicht kultiviert, wenngleich vielleicht kultivierbar. Erst diese Abgrenzungsarbeit erlaubt die Konstitution eines »Innen«, der Heimat, der Kultur. Ohne die Natur als das Außen, für die angelsächsische Welt insbesondere »die Wildnis«, ist Kultur nicht denkbar. Das Außen ist demnach bedeutungsvolle und notwendige Voraussetzung für ein Innen (HAZELRIGG, 1995). Jenseits der Konstruktion tritt uns die fundamentale Natur etwa als Vulkanausbruch oder Wirbelsturm doch ebenso als innere Natur unserer Eingeweide oder als neurobiologisches Substrat unserer Kognition entgegen.
Ob wir »böse« oder »gute« Natur sehen, hängt unmittelbar mit Machtverhältnissen in einer Gesellschaft zusammen (STEINBERG, 2002: 25 ff). Eine historisch besonders wirkmächtige Form dieser Zuschreibung ist die Naturalisierung von fremden Gesellschaften als »edle Wilde« oder aber »unzivilisierte Barbaren«. Für beide Zuschreibungen ist die angenommene Naturnähe der Fremden (früher daher der Begriff »Naturvölker«) konstitutiv, deren Bewertung aber diametral verschieden.
Die Frage, was Natur ist und sein sollte, wurde erst in der Industriegesellschaft explizit zum Thema politischer Auseinandersetzungen (BÖHME, 1996: 86). Die Zuschreibung zu »Natur« oder »Kultur« ist allerdings seit langer Zeit eine politische Frage, mit der Machtansprüche verbunden sind (STAUBER, 1995: 103–123). Der US-amerikanische Geograph Clarence Glacken (1909–1989) hat in einem ideengeschichtlichen Überblick zur europäischen Literatur gezeigt, dass es bis zum Ende des 18. Jh. drei dominante Naturkonzepte gab. Das erste geht davon aus, dass der Planet für die Menschen gemacht ist; eine klare Hierarchie ist die Folge. Das zweite Konzept korreliert Umweltfaktoren mit individuellen und kollektiven Eigenschaften von Menschen, es wird auch als »Umweltdeterminismus« oder »Naturdeterminismus« bezeichnet. Das dritte fokussiert auf die Rolle des Menschen als aktivem Beeinflusser der Natur, als Kultivator von Natur. Die Rolle des Menschen als Zerstörer von Natur wird – von wenigen Ausnahmen abgesehen – erst seit dem 19. Jh. thematisiert (COLLINGWOOD, 2005; GLACKEN, 1967 und 1988: 158–190). Umwelthistorikerinnen und -historiker entwickelten ein Interaktionsmodell, in dem die Konstruktion »Natur« als selbstorganisiertes System konzeptualisiert wird, das mit dem ebenso selbstorganisierten System der Kultur in Wechselwirkungen steht (SIEFERLE, 1997, FISCHER-KOWALSKI & WEISZ, 1999). Ein solches System reproduziert sich in ständigen, nicht zielgerichteten Prozessen immer wieder selbst. Das »Tun« und »Sein« eines solchen Systems ist nicht voneinander zu unterscheiden; das Produkt des funktionalen Zusammenwirkens seiner Bestandteile ist genau jene Organisation, die die Bestandteile produziert.
Die Systeme Natur und Kultur entwickeln sich beide unabhängig voneinander und evolutionär, das heißt ungerichtet aufgrund von unabhängigen Mechanismen der Variation und der Selektion. Festzustellen ist eine Tendenz zu höherer Komplexität, die vor allem durch höheren Differenzierungsgrad (etwa der sinnlichen Wahrnehmung) gekennzeichnet ist. Ist ein solches, der Unabhängigkeit der beiden Systeme Rechnung tragendes Modell entwickelt, können Wechselwirkungen (Interaktionen) benannt und erforscht werden.
ÜBERSCHWEMMUNG DER SEINE am 30. Januar 1910 in Neuilly, Frankreich. (Postkarte)
STURMFLUTMARKEN im Hafen von Tönning unten rechts Vor und nach dem BERGRUTSCH vom 22.4.1935 bei Oberaudorf, Bayern. (Postkarte)
UNWETTERKATASTROPHE am 8. Juli 1927 in Berggießhübel, Sachsen. (Postkarte)
1 Matthias Claudius (1998): aus dem Gedicht »Urians Reise um die Welt« [1786] In: Der Mond ist aufgegangen. Gedichte Frankfurt am Main und Leipzig (Insel) 161ff.