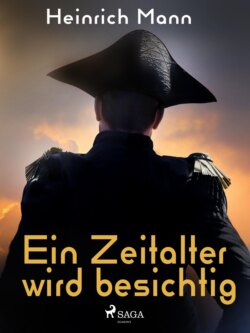Читать книгу Ein Zeitalter wird besichtig - Heinrich Mann - Страница 4
Erstes Kapitel.
ОглавлениеDas Lebensgefühl
Die wenigen Jahrhunderte, die noch nahe genug liegen, daß sie mich nicht befremden, haben offenbar das Leben auf ungleiche Art empfunden. Da sind aufbegehrende Zeitalter, und da sind die zurückgefallenen. Einmal wird ein Glaube revidiert, er drückt nicht die Gemüter, er erhellt sie. Renaissance und Reformation haben, bei stark abweichendem Inhalt, beide das Lebensgefühl verstärkt.
Aber Jesuitismus und Barock setzen es nachher nicht herab; mit anderen Mitteln haben sie es nochmals angespannt. Der Pessimismus wird produktiv: die Tragiker und die Moralisten bezeichnen ein großes französisches Jahrhundert. Das vorhergegangene war ebensowohl italienisch wie deutsch gewesen. Mir bedeutet es viel, daß der Vorrang Frankreichs anhebt in demselben Augenblick, da das Lebensgefühl streng – streng bis zur Ausschweifung wird.
Etwas Äußerstes, von den Erfindungen des Gefühls die gewagteste, war die Majestät. Ludwig der Vierzehnte hatte sie dargestellt, mit innerem Vorbehalt, die Herzen waren es, die sie forderten und ihm grenzenlos zutrugen. Er ist einige Male vor sich erschrocken, hat sich bedacht und sich zurückgenommen.
Achtzig Jahre nach ihm erfuhr die Majestät ein gewaltsames Ende, aber genau so vielversprechend wie vormals sie, trat nunmehr der Zauber der Freiheit ein. Wieder einmal will das Leben sich fühlen und wird spektakulär – mit einer Revolution, die, außer in der Schwärmerei ihres Morgenrots, von niemand als endgültig genommen wurde und für integral gehalten nur von einigen Fremden.
Ihr Sinn ist eigentlich vollendet bei Voltaire, der an ihr wirkliches Erscheinen nie geglaubt hätte. Die Freiheit, will sagen die Unabhängigkeit der Person, geht bei ihm weit, sie kommt der Souveränität gleich; die Fürsten empfanden diesen Geist als die absolute Macht, die sie hätten sein wollen. (Sein eigener König ließ sich nicht verblüffen.) Er folgte aber auf den anderen äußersten Typ, Pascal, den Anbeter der Allmacht, der, vor ihr hingekniet, verzückt, gebückt, sobald er spricht, nur immer bezeugen muß, ihr Thron sei leer. Voltaire, ein Erschütterer alles Weltlichen, tastet Gott nicht an.
So haben Menschen die Autorität ausgeübt, wenn sie ihren Mißbrauch denunzierten, und dem Zweifel arbeiten sie zu, gerade mit ihrem Zuviel an Gläubigkeit. Weltanschauung, was auf deutsch diesen Namen trägt, hat einen doppelten Boden. Nicht mißzuverstehn, notgedrungen ehrlich ist das Lebensgefühl.
Wäre es schmerzlich bis nahe der Selbstvernichtung, das Leben stark fühlen ist alles. Es ergibt die Werke und die Taten. Es bannt das menschliche Gefolge. Der junge Werther beendet seine Leiden freiwillig: die Mitlebenden wurden überzeugt. Sie haben der Nachwelt, als Andenken eines nach außen leichten Jahrhunderts, des achtzehnten, gerade Werther und Manon überliefert. Beide beschwert ihre unstillbare Begierde zu leben, nichts stillt sie, nur der frühe Tod.
Unzählig sind die Werke des Lebensgefühls, die nichts als das sind. Seine Taten ergriffen manchen, der kaum vorbereitet schien. Klopstock und Kant, in ihrer Begierde für die Ereignisse in Frankreich, detonieren. Mozart wird seither so tragisch bedeutungsvoll nicht empfunden, wie er es ein einziges Mal sein wollte. Dennoch, in der »Zauberflöte« vernahmen die Zeitgenossen ein noch unerhörtes Gefühl, sie gaben sich hin und erklärten es nicht. Es war 1791 der Schwanengesang ihres Herzens und seines, bald vollendeten. Die strengen, dunklen Klänge hat er, hellhörig, in sanfter Ahnung der heraufziehenden Leidenschaften, aus Frankreich empfangen.
Ein Weltgeschehen, kaum begriffen, die Gesinnung teilt man nicht, unwiderstehlich ist allein das entfesselte Lebensgefühl, – es begleitet jedes Verhängnis.
Es rechnet mit den Kräften nicht, in dreißig Jahren hat es sie noch immer erschöpft, dann bekennt die nächste Zeitgenossenschaft, daß sie von der Maßlosigkeit ihrer Vorgänger verbraucht ist.
Die Generation nach Napoleon hat ihm im Grunde nur vorgeworfen, daß sie müde sei. Ihr Gefühl belasteten die Toten aus seinen Kriegen. Er verantwortete die Überanstrengung der Nation und die interessanten Ängste der Nachgewachsenen. Stendhal hat sich in Julien Sorel um zwanzig Jahre jünger gemacht, damit ein Anhänger des Kaisers in der müden Welt, die jetzt folgt und die empfänglich für starke Naturen ist, ein Heuchler und ein Mörder werden soll. Julien ist die dunkle Kehrseite der glänzenden Jugendjahre mit dem großen Mann, die seinem Autor erlaubt gewesen waren. Beide hätten ein und dasselbe Lebensgefühl, lägen nicht zwischen ihnen die zwanzig Jahre.
Wieder um eine Generation jünger, erhebt Michelet seine Anklage. Hier bejammert kein Geschädigter mehr sich selbst. Die historischen Nachwirkungen eines Eroberers, der nicht für Frankreich gehandelt habe, erbitterten ihn allein. Napoleon hatte Frankreich entvölkert, das Sterben mißbraucht für Siege ohne nächsten Tag. Was anhält: die Entvölkerung.
Noch mehr, die Revolution, als die wahre, moralische Eroberung, ist abgestumpft worden auf den müßigen Schlachtfeldern. Der überdimensionale Dichter der Revolution, Jules Michelet, hatte damals seine Vision vom leuchtenden und erlöschenden Genie eines Zeitalters beendet. Er war jetzt alt, ohne Geduld; für Napoleon, der dennoch die letzte Fackel der Revolution über Europa getragen hat, findet sein Geschichtsschreiber nur noch zerhackte Beschimpfungen.
Ich vergleiche mit dem Menschentum außerhalb jeden Ranges, das Napoleon, seine Epopöe, seine Erscheinung, einer ganzen Welt zu fühlen gegeben hatte, als er auf ihr wandelte. Nationen verachteten auf einmal jede Macht, die nicht seine ist. Noch wenn sie kriegerisch werden und sich befreien von ihm, vermögen sie nur Frankreich und ihn viel kleiner nachzuahmen. Er ist der einzige Herrscher und General, den die geistigen Spitzen Europas für ihresgleichen gehalten haben. Goethe war sein Freund.
Aber kaum ist seit dem Tode Goethes ein Menschenalter verstrichen, da wird das Monstrum an Machtwillen verworfen ohne Appell. Das Urteil fällt der nationale Geschichtsschreiber Frankreichs: durch seinen Mund die Nation selbst, sie liest ihn seither hundert Jahre. Sie fährt gewiß fort, den einstigen Herrn Europas zu bewundern, da er es mit französischen Heeren wurde. Gleichwohl erkennt sie seit einigem in allen militärischen Eroberungen den Trug und die Vergeblichkeit. Es könnte sein, daß die einmalige, ausgiebige Erfahrung nie verwunden, aber genutzt wäre. Daher mehr als ein Phänomen, das für französisch gilt, aber sich zögernd herangebildet hat seit 1815.
Der einzelne lebt kurz, vollendete Verwandlung erblickt er selten, eher wird er zuletzt noch Zeuge eines Rückfalles der Nation in längst widerlegte Zustände. Als Michelet alterte, mußte er das zweite Kaiserreich über sich ergehen lassen: gerade daher seine uneingeschränkte Verwerfung des ersten. Die militärischen Eroberer haben nicht genug daran, daß sie das Land entvölkern, die Nation ermüden: sie hinterlassen eine Wurzel, die noch treibt. Sie werden nachgeahmt.
Napoleon III. war ein zaghafter Nachahmer des Ersten. Er begehrte seinen Glanz und nicht erst die Mühen. Er hat die Kriege, zu denen seine Herkunft ihn verpflichtete, mit Vorsicht geführt: der letzte, über den er stürzte, mußte ihm abgenötigt werden, ebensowohl von seiner Umgebung wie von dem Angreifer.
Er hat wie jeder andere gefühlt, auf Grund der Erfahrungen Frankreichs mit seinem großen Kaiser hat der gealterte Nachahmer gefühlt: die militärischen Auseinandersetzungen mächtiger Nationen sind vergeblich, sie entscheiden nichts, da immer dieselben, wenigen Gegner, soweit man zurückdenkt, aufeinanderstoßen. Die Kriege in Europa hatten bisher – nur bis auf uns – einen begrenzten, einmaligen Zweck, – der auch anders zu erreichen war.
Gedanken eines kranken Machthabers, falls der gealterte Nachahmer des großen Napoleon sie hatte. Er konnte sie nur empfangen, als er nicht mehr weit hatte und sich eingestand, die Ordnung Frankreichs, das Gefühl der Nation sei von Grund auf demokratisch; sein Reich hänge haltlos über den wirklichen Menschen; er sei verspätet; sein letzter Krieg falle aus der Zeit.
Sein Gegner Bismarck begegnete damals keinem einzigen der Gedanken, die dem anderen nahe lagen, weil er am Ende, die Nation über ihn hinaus war. Die Revolution hat sich dauerhafter erwiesen als der große Kaiser: sein Nachahmer, 19 Jahre, ihre vorläufig unterbrochene Erfüllung, die Dritte Republik, 70 Jahre, und Erfüllungen darüber hinaus werden erwartet.
Bismarck war zehn Jahre jünger als sein Opfer, war gesund und auf ansteigender Linie. Die deutsche Nation fand seine Kriege rühmlich, sie ließ ihn das Reich, das sie wollte, auf seine Art herbeiführen. Für die Nation bis in ihre geistigen Spitzen ist dies alles gewesen, der Sieg und Triumph, ausgedrückt in einem machtvollen Reich. Nicht für Bismarck. Er kannte, als es nun da war, die Gebrechlichkeit des Reiches. Die Gefahr der Triumphe ist ihm immer gegenwärtig gewesen, ohne daß er sie bereute. Oder man müßte an das Wort denken: »Über meine Kriege habe ich mit Gott abgerechnet.«
Er hat das Reich nicht nur geschaffen: es zu erhalten war schwerer. Die gefürchteten Koalitionen abwenden. Die Rache – nicht Frankreichs, sondern aller – ermüdet. Den Frieden, trotz Bedrohungen und Verlockungen den Frieden durchsetzen. Andere haben genug getan, wenn sie ihn nicht brachen. Von 1875 bis 1890 brütete Europa für seinen Krieg die Anlässe, wenn nicht sogar die begründeten Vorwände aus. Sie erschienen überzeugender als je nachher.
Die Deutschen haben ihrem einzigen Staatsmann seine vornehmsten Verdienste nie gedankt, sie kennen sie gar nicht. Er eroberte seinem Reich – nicht Provinzen, die hat er kaum gewünscht, sondern Dauer für seine eigene Lebenszeit. Nach ihm war es sofort in Frage gestellt. Der Bestand des Reiches Bismarcks bleibt weit zurück hinter der Haltbarkeit der französischen Republik. Ohne ihn hätte es auch die knappe Zeit der festen Grenzen, einer halbwegs beruhigten Staatlichkeit niemals erlebt.
Der tiefe Grund des Hasses, den Bismarck gegen Wilhelm II. empfand: er sah ihm die Zerstörung des Reiches an. Der Unernst des Erben gegen das Vermächtnis hat ihn mehr empört als die Leichtfertigkeit, mit der er selbst behandelt wurde: sie verriet nur den ahnungslosen Komödianten einer Geltung, auf die der Erbe kein Recht hatte. Bismarck nennt seither Friedrich den Großen, das angemaßte Vorbild Wilhelms, einen Schauspieler. Er sah den späten Enkel des berühmten Königs sich ergehen und mißtraute ihm selbst. Gewisse Papiere Friedrichs fand er jetzt gefährlich, er schrieb groß und steif darauf: Dauernd geheimzuhalten.
Das ist, wenn ich will, die Abneigung eines Alten gegen die Fortsetzung seines Werkes in weitaus größeren Unternehmungen, die er nicht mehr kennen soll. Ich glaube lieber, daß er sie durchaus gekannt hat. Was er zuletzt mehr fürchtete als äußere Verschwörungen gegen das Reich, war das innere Komplott Deutschlands gegen den europäischen Frieden. Seine Bündnispolitik, die sein erster Nachfolger »zu kompliziert« nannte, beweist, daß er die militärische Macht Deutschlands für begrenzt hielt. Er hat natürlich gewußt, daß die Herausforderung an alle, mit der er den jungen Wilhelm spielen sah, das Ende wäre. Quieta non movere, das Wort seiner späten Tage, heißt eben dies.
Der Fürst wird seine Kriege bereut haben, wenn er an den nächsten dachte. Dies muß der Inhalt seiner Abrechnung mit Gott gewesen sein. Übrigens meine ich, daß von etwas Geschaffenem wenigstens einer den Sinn in sich trägt und begreift: es ist der Autor. Mir gefällt es zu denken, daß auch Deutschland, wie einst das Frankreich Napoleons, nicht völlig blind das Verhängnis der Welt und sein eigenes heraufbeschworen habe. Wenigstens der eine war da, zu wissen und zu warnen. Er hatte, weise geworden, die Folgen eigener Schuld zu unterdrücken oder aufzuhalten.
Zusammenhänge gibt es, man entziffert sie wohl, unter der Bedingung, daß man schon dabei war und nachher lange genug lebt. Sie definieren geht nicht. Ich halte dafür, daß die deutschen Abenteuer von Beginn bis Schluß, sei es wenig oder kaum bewußt, Napoleon nachahmen.