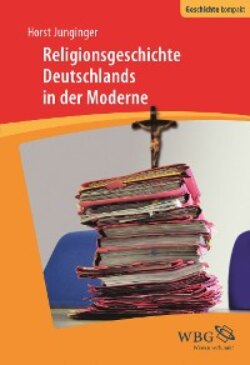Читать книгу Religionsgeschichte Deutschlands in der Moderne - Horst Junginger - Страница 11
1. Die doppelte Bedeutung der Religionsgeschichte
ОглавлениеReligionsgeschichte als Gegenstandsbereich
Im Gegensatz zur christlichen Kirchengeschichte hat die vergleichende oder allgemeine Religionsgeschichte eine in mehrerer Hinsicht weiter gefasste Perspektive. Zum einen ist ihr Gegenstandsbereich umfassender. Er umschließt neben den christlichen Konfessionen, Freikirchen und Sondergemeinschaften die ganze Bandbreite der nichtchristlichen Religionen. Dazu gehören heute neben einer großen Zahl an Gruppen, die der Esoterik und dem New Age zuzurechnen sind, auch Gemeinschaften im Übergangsbereich zu nichtreligiösen Sinndeutungen und Lebensentwürfen. Anthroposophie und Theosophie, der Spiritismus und Okkultismus, Yoga und Feng Shui oder Systeme, die eine Psychologisierung des menschlichen Zusammenlebens religiös überhöhen, können hier als Beispiele genannt werden. Solche Phänomene sind in ihrem religiösen Gehalt nicht leicht zu fassen. Sie illustrieren das weite Feld der allgemeinen Religionsgeschichte und tragen dazu bei, die Spezifik einer religiösen Welterklärung besser zu verstehen. Wollte man sie einem herkömmlichen Kirchenbegriff unterwerfen, ginge das an der Wirklichkeit vorbei. Viele der neuen religiösen Bewegungen treten mit dem ausdrücklichen Anspruch auf, keine Kirche oder Heilsanstalt nach christlichem Muster zu sein.
Religionsgeschichte als Wissenschaft
Der Ausdruck Religionsgeschichte bezeichnet aber nicht nur den Gegenstandsbereich der religionswissenschaftlichen Forschung, sondern auch einen eigenständigen methodischen Ansatz. Dieser ist durch das Absehen von religiösen Glaubensaussagen, den religionsgeschichtlichen Vergleich und die Art der wissenschaftlichen Systematisierung charakterisiert. Indem die Religionsgeschichte alle Religionen grundsätzlich gleich behandelt, verbietet es sich für sie, aus der Vielzahl religiöser Wahrheitsansprüche einzelne herauszugreifen und sie anders als die anderen zu beurteilen. Aus religionsgeschichtlicher Perspektive sind alle Religionen gleich gut oder gleich schlecht. Sind bestimmte Religionsformen zu kritisieren, etwa wenn individuelle Freiheitsrechte unterdrückt oder Gewalthandlungen religiös legitimiert werden, geschieht das nicht aus religiösen Gründen, sondern anhand innerweltlicher Maßstäbe, die auch sonst für die Bewertung menschlichen Verhaltens gelten.
Wenn man den Anspruch erhebt, sich mit allen Religionen der Welt gleichermaßen zu befassen, wäre es verheerend, würde man eine oder einige bevorzugen und ihnen ein höheres Maß an Authentizität oder größere Nähe zum „Göttlichen“ zugestehen als anderen. Die Seriosität der religionsgeschichtlichen Arbeit hängt entscheidend davon ab, dass sie nicht durch religiöse Vorannahmen präjudiziert wird und dass alle Religionen in gleicher, wissenschaftlich neutraler Weise untersucht werden. Dem Bemühen um eine sachgerechte Objektivierung des Religiösen wäre der Boden entzogen, wenn es durch religiöse Interessen oder subjektive Glaubenswahrheiten geleitet würde. So wie es dem religiösen Religionsvergleich darum geht, die besondere Bedeutung des eigenen Glaubens herauszustellen, geht es dem religionsgeschichtlichen Vergleich um die Erkenntnis von Zusammenhängen und systematischen Strukturen.
Religiöse Wahrheit
Ob das in einer Religion Geglaubte wahr ist oder nicht, stellt den Dreh- und Angelpunkt für ihre Anhänger dar. Ohne den Glauben an die Wiederauferstehung Jesu nach seinem in der Bibel überlieferten Tod am Kreuz von Golgatha kann man nicht Christ und redlicher Weise auch nicht Theologe oder Kirchenhistoriker sein. Für die Religionsgeschichte bleibt dagegen die Frage nach dem Wahrheitsgehalt religiöser Überlieferungen und Lehrsätze auf die Vermittlung durch den Glauben daran beschränkt. Transzendente Inhalte sind Glaubenswahrheiten und empirisch nicht erforschbar. Nur der auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebrachte Glaube an Gott, Götter, Engel, Geister, Dämonen und andere übernatürliche Wesenheiten lässt sich wissenschaftlich untersuchen, nicht aber ihr supranaturaler Gehalt. Im Unterschied zu einem theologischen Ansatz sind religiöse Offenbarungen, göttliche Prophezeiungen, mystische Visionen, Gebete oder für heilig erachtete Schriften keine Erkenntnisquellen, sondern gehören in ihrer historischen Ausprägung zum Gegenstandsbereich der religionsgeschichtlichen Forschung. Glaubensaussagen lassen sich nur subjektiv begründen und führen auf dieser Grundlage oft zu folgenschweren Konflikten. Vor allem aus praktischen Gründen wurde deswegen das Konzept der Epoché entwickelt. Es soll verhindern, dass die Religionswissenschaft in den Streit der Religionen hineingezogen wird.
Stichwort
Epoché
Der Begriff Epoché stammt aus der griechischen Philosophie und ist ein wichtiger Bestandteil des antiken Skeptizismus. Er verlangt, sich eines Urteils zu enthalten, wenn man im Streit der philosophischen Systeme keiner der beteiligten Parteien recht geben kann. Als religionswissenschaftliches Prinzip postuliert das Epoché-Konzept die Urteilsenthaltung bei religiösen Wahrheitsfragen.