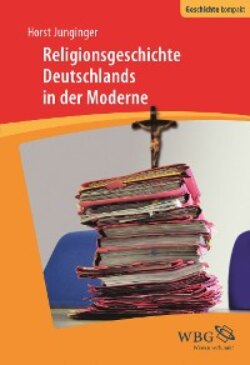Читать книгу Religionsgeschichte Deutschlands in der Moderne - Horst Junginger - Страница 13
3. Religions- als Kulturwissenschaft
ОглавлениеSeparierung von Religion und Wissenschaft
Religion und Wissenschaft treten in der Moderne auseinander und bilden zwei Bereiche, die unabhängig voneinander existieren. Während sich die naturwissenschaftlichen und medizinischen Fächer bereits früher von der Religion abgekoppelt haben, wurde die Religion später auch aus den im 19. Jahrhundert entstandenen Geisteswissenschaften ausgelagert und zu einem eigenständigen Forschungsgegenstand. Religiöse Einmischungen in die Wissenschaft werden nicht mehr toleriert, und niemand erwartet mehr von der Religion, dass sie Antworten auf fachwissenschaftliche Fragen geben könnte. Die Religion wird selbst erklärungsbedürftig. Hat man in ihr früher eine übergeordnete Größe gesehen, auf die hin sich Geschichte, Kultur und Wissenschaft ausrichten, werden nun umgekehrt Geschichte, Kultur und Wissenschaft zum äußeren Referenzrahmen der Religion. Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Christentum und seiner nichtchristlichen Umwelt kehrt sich um.
Perspektivwechsel
Die Entstehung einer nichtreligiösen Religionsforschung gehört zu den Folgen der Separierung von Religion und Wissenschaft. Damit verband sich ein Wechsel der Perspektive von innen nach außen – mit der Konsequenz, dass heilige Dinge zu profanen Objekten der religionsgeschichtlichen Forschung wurden. Der externe Blickwinkel verlagerte den Fokus von der jeder Religion eigenen Selbstreferentialität auf die von außen auf sie einwirkenden Bestimmungsfaktoren. Fragen, die sich auf theologische Lehrinhalte und religiöse Dogmen beziehen, verloren an Bedeutung. Das religionsgeschichtliche Erkenntnisinteresse richtete sich weg von der binnenreligiösen Diskussion um die Wahrheit und Durchsetzungsfähigkeit von Glaubensaussagen. Stattdessen wurde die Einbindung der Religion in ihre äußere Umwelt in den Blick genommen.
Vorwurf des Reduktionismus
Der Wechsel von der religiösen Binnen- zur nichtreligiösen Außenperspektive zeitigte die auf den ersten Blick befremdliche Konsequenz, dass sich eine säkulare Religionswissenschaft herausbildete, für die das Nichtreligiöse wichtiger zu sein schien als das Religiöse selbst. Können Religionen in ihrer Eigengesetzlichkeit überhaupt verstanden werden, wenn man sie auf diese Weise kontextualisiert und von geschichtlichen Entwicklungen, sozialen Prozessen und psychologischen Mechanismen abhängig macht? Wird dabei Religion nicht auf Nichtreligiöses reduziert und ihres eigentlichen Inhalts beraubt?
Sieht man jedoch genauer hin, verliert der von religiöser Seite oft vorgebrachte Vorwurf des Reduktionismus seine Plausibilität, denn er setzt etwas voraus, das nur für den Gläubigen existiert. Ihm liegt ein vormodernes Begründungsschema von Religion zugrunde, in dem das religiöse und wissenschaftliche Wissen noch der gleichen Kategorie angehörten und eine synthetische Einheit bildeten. Würde man dem Argument des Reduktionismus folgen, könnten Religionen nur aus sich selbst heraus verstanden werden. Konsequenterweise dürften die Vertreter einer Religion dann auch nur über ihre eigene und nicht über andere Religionen urteilen. Wie will man auf der Basis subjektiven Glaubens zu einem objektiven Urteil kommen, wie den Anspruch auf wissenschaftliche Geltung einlösen und die Forderung nach intersubjektiver Nachprüfbarkeit erfüllen?
Stichwort
Reduktionismus
Die wissenschaftstheoretisch notwendige Rückführung komplexer Fragestellungen auf einfachere Prinzipien und Sachverhalte. Der religiöse Antireduktionismus behauptet dagegen nur eine Kausalitätsbeziehung, die den vorherigen Glauben an Gott oder einen anderen überempirischen Beweggrund voraussetzt. Sein Kategorienfehler besteht im vermeintlich wissenschaftlichen Gebrauch eines religiösen Arguments.
Anthropologisierung der Religion
Die religiöse Kritik am „Szientismus“ der nichtreligiösen Religionsforschung ist insofern berechtigt, als sie anerkennt, dass es sich dabei um ein rein wissenschaftliches Unternehmen handelt. Die Religion ist der Gegenstand, die Wissenschaft die Methode seiner Erforschung. Für die Religionswissenschaft sind Religionen anthropologische Größen, die auf den Menschen als Urheber und Gestalter zurückgehen. Dass sich dahinter göttliche Wesen verbergen, gehört zu den Grundannahmen jeder Religion, die deswegen ebenso wie die damit in Verbindung gebrachte Kausalordnung einen wichtigen Bestandteil der religionswissenschaftlichen Forschung bilden. Durch die Anthropologisierung der Religion wird diese zu einem weltlichen Gegenstand und die Religionswissenschaft zu einem gewöhnlichen Universitätsfach, das sich einem bestimmten Aspekt des Menschseins zuwendet.
Doppelter Wahrheitsbegriff
Dadurch dass sich die Religionswissenschaft allein mit der menschlichen Seite der Religion befasst, vermeidet sie die in wissenschaftlicher Hinsicht verhängnisvolle Zweiteilung in einen der empirischen Forschung zugänglichen äußeren und einen ihr entzogenen inneren Bereich der Religion. Jede religiöse Religionsforschung ist dagegen zu einem doppelten Wahrheitsbegriff verurteilt. Diesem zufolge kann nur die äußere Erscheinungswelt der Religion mit den Methoden der Wissenschaft untersucht werden. Nur dort gelten ihre Gesetze, die im inneren Kernbereich der Religion außer Kraft gesetzt seien. Um zu dem vorzudringen, was die Religion ihrem innersten Wesen nach ausmacht, bedürfe es der religiösen Empathie und nicht der wissenschaftlichen Rationalität. Eine nur wissenschaftliche Erklärung von Religion erscheint in dieser Logik als defizitär und weit davon entfernt, ihren inneren Sinn erfassen zu können. Die analytische Differenzierung der Religionswissenschaft wird durch eine organische Synthese ersetzt, die das eigentliche Wesen der Religion zum Ausdruck bringe. Trotz seiner erkenntnistheoretischen Unzulänglichkeit ist dieser Ansatz weit verbreitet und die Grundlage fast aller Versuche, die eigenen religiösen und wissenschaftlichen Interessen miteinander zu verbinden.
Wesensbegriff der Religion
Im Zuge des „Cultural turn“ in den Geisteswissenschaften distanzierte sich die Religionswissenschaft nicht nur von der Theologie, sondern auch von solchen Ansätzen, die einen religiösen Universalismus behaupten, dessen amorphe Wahrheit in allen Religionen gleichermaßen enthalten sei. Die Religion wird dabei auf ein allgemeines religiöses Wesen zurückgeführt, das sich dem Menschen nur unterschiedlich offenbare. Zu seinem Träger wird der homo religiosus, der religiöse Mensch an sich erklärt, der sich erst sekundär einem konkreten Glauben zuwendet.
Dass bei einer solchen Sichtweise die äußeren Umstände und geschichtlichen Ausprägungen einer Religion in den Hintergrund treten, leuchtet ein. Was vor allem zählt, ist die religiöse Ergriffenheit des Individuums und seine unmittelbare Begegnung mit dem Göttlichen. Der entscheidende Fehler eines solchen Essentialismus besteht darin, dass ein wahres und eigentliches Wesen der Religion behauptet wird, das von ihrer äußerlichen Gestaltwerdung abgespalten und zu einer nicht mehr hinterfragbaren Größe gemacht wird. Nimmt man dem Religiösen aber seine geschichtliche Konkretion, bleibt nichts übrig.
Stichwort
Essentialismus
Die Annahme eines inneren Wesens der Religion, das im Gegensatz zur sichtbaren äußerlichen Hülle ihren eigentlichen Wahrheitskern ausmacht. Essentialistische Religionsdeutungen ermöglichen die Zuschreibung von Wesenseigenschaften, die sowohl positiv als auch negativ sein können. Sie brauchen keine wissenschaftliche Begründung und rechtfertigen Urteile auf der Grundlage des Meinens. Fakten, die dem Essentialismus entgegenstehen, werden als eine die Regel bestätigende Ausnahme wahrgenommen.
Religions- als Kulturwissenschaft
Wie in der Geschichtswissenschaft gewann nach dem Zweiten Weltkrieg auch in der Religionswissenschaft ein neues Kulturverständnis Oberhand, das eine intensive Beschäftigung mit der Gesellschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte nach sich zog. Die explizite Verortung der Religion in diesen Bezügen öffnete den Blick für die Dynamik religiöser Anpassungsprozesse, deren theologische Begründungsmuster nun verstärkt daraufhin, das heißt im Hinblick auf ihre Anpassungsleistung, untersucht wurden. Ohne die historischkritische Auseinandersetzung mit den heiligen Schriften der europäischen und außereuropäischen Religionen aufzugeben, ließ ein kulturgeschichtlich erweitertes Textverständnis andere Aspekte stärker in den Vordergrund treten. Mit der Erkenntnis, dass sich auch symbolische, körperliche und performative Repräsentationsformen in das kulturelle Gedächtnis einer Gemeinschaft einschreiben, wurde die Funktion der religiösen Vermittlung wichtiger als ihre äußere Form. In diesem kulturwissenschaftlichen Sinn lassen sich Religionen als kulturspezifische Symbolsysteme verstehen und auf der Grundlage eines höheren Abstraktionsgrades besser miteinander vergleichen. Die soziale Verbindlichkeit und der Transzendenzbezug als überempirischer focus imaginarius (Immanuel Kant) bleiben jedoch die beiden Grundvoraussetzungen, ohne die sinnvollerweise nicht von Religion gesprochen werden kann.
Das Problem der Terminologie
Wenn man in der religionsgeschichtlichen Arbeit die Wahrheitsfrage ausklammert, stellt sich das Problem der kommunikativen Vermittlung religiöser Inhalte auf andere Weise. Die religiöse Fachsprache dient der Steigerung des Glaubens, die der Religionswissenschaft der Steigerung des Wissens. Die Binnenterminologie einer Religion ist alles andere als universal. Sie ist an ihre historische Tradition gebunden und kann schwerlich auf Religionen angewendet werden, die in einem völlig anderen geographischen und geschichtlichen Zusammenhang entstanden. Oft gebrauchen die Vertreter einer Religion pejorative Wendungen, um andere Glaubensweisen als falsch, minderwertig oder schädlich zu diskreditieren. Dem eigenen Wahrheitsanspruch wird der Aberglaube der anderen gegenübergestellt. Häretiker sind Menschen, die etwas Falsches glauben, und Ketzer eine Gefahr für das Glaubensverständnis der Mehrheit. Bei solchen Zuschreibungen handelt es sich um relationale Begriffe, deren Gebrauch auf ein feindliches Gegenüber abzielt.
Weil die Sprachentwicklung Europas in hohem Maße durch das Christentum beeinflusst wurde, konnte es nicht ausbleiben, dass in unseren Sprachgebrauch auch religiöse Werturteile Eingang fanden. Sie können selbst dann noch mitschwingen, wenn sich die Sprechenden ihrer Herkunft nicht mehr bewusst sind. Zentrale heilsgeschichtliche Begriffe wie Erlösung, Gnade, Heil, Sünde usw. haben eine spezifisch christliche Wurzel und können aus diesem Grund nicht ohne weiteres verallgemeinert und auf andere Kontexte übertragen werden. Würde man mit ihnen die Ahnenvorstellung des Shintoismus, das alles durchwaltende Lebensgesetz des Hinduismus, die Leidvermeidungsstrategie des Buddhismus, die Harmonielehre des Konfuzianismus, den islamischen Schicksalsgedanken oder die jüdische Ethik beschreiben wollen, müsste das notwendigerweise zu Missverständnissen führen.
Unter den Bedingungen weltanschaulicher Pluralität wird das auf einer religiösen Normativität beruhende Sprechen über Religion zum Problem. Jede übergreifende Terminologie mit allgemeinem Geltungsanspruch muss deswegen in der Lage sein, vom Wahrheitsgehalt religiöser Aussagen zu abstrahieren. Das gilt insbesondere für die Religionswissenschaft, deren Aufgabe darin besteht, religiöse in wissenschaftliche Begriffe zu übersetzen (s. Quelle). Da Sprache aber historisch gegeben ist und die Erfindung neuer Worte in aller Regel zu keinem guten Ergebnis führt, hängt die Qualität der religionswissenschaftlichen Arbeit entscheidend davon ab, inwieweit es ihr gelingt, den Unterschied zwischen der innerreligiösen Objektsprache und der Metaebene der wissenschaftlichen Reflexion deutlich zu machen. Bei vielen religiösen Fachtermini wären relativierende Anführungszeichen nötig, die zumindest mitzudenken sind, auch wenn Begriffe wie Aberglaube, Heidentum, Heilsgeschichte, Sünde, Schuld und Erlösung gewohnheitshalber ohne sie gebraucht werden. Die kritische Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus hat immerhin dazu geführt, dass Redewendungen aus dem Arsenal der christlichen Judenfeindschaft nicht mehr öffentlich benutzt werden können, ohne Widerspruch auszulösen.
Quelle
Die Sätze der Religion und die Sätze der Religionswissenschaft
Aus: Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe, Bd. 1, Stuttgart 1988, S. 22.
Die Sätze der Religionswissenschaft beziehen sich – im Unterschied zu religiösen Sätzen – immer auf (a) empirisch gegebene Sachverhalte (Gegenstände; Personen, Handlungen; Zeichen, Texte, Laute) oder auf (b) die rationale Analyse der Beschreibungen der genannten Sachverhalte und ihre Verbindung mit anderen Gebieten der Human-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften.
Sätze der Religionswissenschaft sind nicht selbst religiöse Sätze, sondern diese sind ihr Gegenstand.