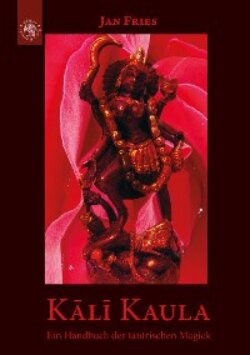Читать книгу Kālī Kaula - Jan Fries - Страница 13
Das Industal
ОглавлениеAls die Ruinen der großen Städte der Industalkultur (auch Harappa-Kultur genannt) entdeckt wurden, führten sie zu einer kreativen Neuinterpretation der Geschichte. Die lange vorherrschende Annahme, dass die indoeuropäischen Eroberer (Ārya) die erste Hochkultur in Indien geschaffen hätten, musste aufgegeben werden. Im Industal und auch in bemerkenswerten Entfernungen von diesem wurde große Städte ausgegraben, von denen jede aus sonnengetrockneten oder gebrannten Ziegeln gebaut war und aus systematisch angelegten langen, geraden Straßen und Gebäuden bestand. Diese Städte schienen zu perfekt, um das Ergebnis einer lokalen Entwicklung zu sein. Sie waren nicht organisch gewachsen, sondern ausgesprochen planvoll angelegt. Folglich wurde ihr Ursprung anderswo vermutet.
Dieses Anderswo erwies sich als Mesopotamien. Nach der derzeitigen Meinung kam das so: die mesopotamischen Obed- und Halaf-Kulturen dehnten sich im sechsten und fünften Jahrtausend v.u.Z. ostwärts aus, in einer Migrationsbewegung, die den größten Teil des Iran und des südlichen Turkmenistan abdeckte und den Indus um das vierte Jahrtausend v.u.Z. erreichte. Diese Migranten hatten eine hochentwickelte Landwirtschaft und eine gute Vorstellung davon, wie man Siedlungen und Städte baute. Sie taten das an vielen Orten und verwendeten immer eine recht ähnliche Architektur und Technologie. Soweit zum allgemeinen Forschungsstand. Es gibt aber, gerade unter patriotischen indischen Forschern, viele, die es bevorzugen würden, dass die Induskultur eine einheimische Entwicklung war. Nach deren Ansicht entwickelten die Industal-Bewohner ihre Kultur selbstständig, wobei sie allerdings in regem Handelskontakt mit Mesopotamien standen. Zu einer städtischen Hochkultur kam es um die Mitte des dritten Jahrtausends v.u.Z. Hinzu kamen eine Vielzahl damit verbundener Siedlungen und Fundorte, von denen bisher weit über tausend entdeckt wurden.
Bild 4
Induskultur, Siegel (nicht Maßstabsretreu)
Oben: Ritualszene. Hergestellt von den Indusleuten, exportiert. Entdeckt auf Failaka, einer Insel nahe Kuwait.
Mitte links: Nashorn. Mohenjo Daro, 3,85 x 3,85 cm.
Mitte rechts: Elefant, Mohenjo Daro, 2,58 x 2,63 cm.
Unten: Stier/Wildrind mit Fisch, Gipsabdruck eines Siegels in Mohenjo Daro.
Zunächst erklärten die Gelehrten des frühen zwanzigsten Jahrhunderts den hohen kulturellen Standard als ein Ergebnis der mesopotamischen Migration. Immerhin hatten Sumer (und übrigens auch Elam, im iranischen Hochland) zu diesem Zeitpunkt die größten Metropolen der Welt aufzuweisen. Diese Theorie wurde durch den Beweis eines lebhaften Handels mit Sumer erhärtet. Güter aus dem Industal wurden ins moderne Dilmun und von da aus nach Mesopotamien transportiert. Im dritten Jahrtausend v.u.Z. waren die Sumerer sehr in den Seehandel involviert. Regelmäßig verließen große Handelsschiffe die Häfen am Persischen Golf, um nach Oman, Äthiopien und eben ostwärts nach Indien zu segeln. Die Sumerer erwähnten diesen Handel in ihren Aufzeichnungen ab ca. 2500 v.u.Z. und nannten das Industal das Land Meluhha. Es gibt sogar fein gravierte sumerische Rollsiegel, die Botschafter aus Meluhha zeigen. Entlang der Handelsroute fand sich eine Anzahl von Gewichten, Schmuckstücken und charakteristischen Töpferwaren. Die Indusleute hatten exzellente technische Fertigkeiten und produzierten eine bemerkenswerte Menge Schmuck für den mesopotamischen Markt. Sie verarbeiteten Gold und Kupfer, aber auch Muscheln, Lapislazuli, Achat und Karneol, die sie schnitten, polierten und mit Gravierungen verzierten.
All diese Materialien waren im fernen Sumer, einem Land, das weder über Bodenschätze noch sonstige natürlichen Ressourcen verfügte, extrem wertvoll. Andererseits war Sumer für seine Getreideüberschüsse und seine feinen Textilien berühmt. Auch das Knowhow der Sumerer, die als erste (bekannte) Kultur eine fortgeschrittene Mathematik, Wirtschaft, Bewässerungstechnologie und Bürokratie entwickelten, könnte die Industalbewohner interessiert haben. So erschien es eine Zeitlang als gesichert, die Industalbewohner als entfernte Verwandte der Sumerer zu betrachten. Doch so einfach sind die Dinge praktisch nie. Zunächst einmal waren die Angehörigen der Obed- und Halaf-Kulturen, welche nach ihrer langen Wanderung im Industal Fuß fassten, keine Sumerer, sondern mit deren Vorgängerkulturen in Mesopotamien verwandt.
Zum anderen war die Bevölkerung, die so einfach als Sumerer bezeichnet wird, zu diesem Zeitpunkt längst eine komplexe Mischung unterschiedlichster Ethnien. Hinzu kommt, dass die neu eingewanderten Migranten im Industal eine weit ältere Bevölkerung vorfanden. Besiedelt wurde das Industal bereits im Mesolithikum, was in diesem Fall das 8. Jahrtausend v.u.Z. bedeutet. In Mergarh schlossen sich die Jäger und Sammler bereits um das 7. Jahrtausend v.u.Z. der Neolithischen Revolution an und wurden zu Bauern. Aus dieser Zeit gibt es Belege für aus Ziegeln gebaute Siedlungen, die Kultivierung von Gerste (Weizen kam später) und die ersten extrem groben menschlichen Figurinen aus ungebranntem Ton. Diese Figurinen stellen üblicherweise sitzende Menschen dar, sie sind aber so primitiv, dass weder Geschlecht noch gesellschaftlicher Status oder Kleidung zu erkennen sind. Einige von ihnen sehen überhaupt kaum menschlich aus. Auf dieser Kulturstufe waren die Menschen noch stark von der Jagd abhängig und die Haustiere ähnelten noch sehr ihren Wildformen. Im Laufe des nächsten Jahrtausends wurde die Rinderzucht zur Grundlage der Gesellschaft, während die Jagd zunehmend an Bedeutung verlor.
Die Siedlungen wuchsen, und der Bestand an wilden Tieren nahm rasch ab. Als die mesopotamischen Migranten eintrafen, begegneten sie einer altansässigen Gesellschaft, die die Grundlagen des bäuerlichen Lebens gründlich beherrschte. Deshalb wird die Induskultur heute meist als eine Mischung aus mesopotamischen Einwanderern und einheimischen Bauern betrachtet, was sowohl die Ähnlichkeit mit den Sumerern erklärt als auch den einzigartigen Charakter der Induskultur. Wie üblich lohnt es sich, einen Blick auf die neuere Forschung zu werfen. Die ersten Ausgrabungen konzentrierten sich auf die berühmten Städte Harappa und Mohenjo-Daro und führten zu der Annahme, dass diese die Hauptstädte einer Kultur waren, die gut organisiert, entwickelt, standardisiert und äußerst langweilig war. Verschiedene Autoritäten erklärten, dass das Industal lange Perioden der Stagnation in Kunst und Handwerk erfahren hat. Dieses Bild musste revidiert werden. Die neueren Ausgrabungen haben gezeigt, dass die Induskultur geografisch größer war als je vermutet und dass es eine Menge einzigartiger lokaler Entwicklungen jenseits des Industals gab. Ganz ähnliche Städte wurden im nordöstlichen Afghanistan entdeckt, an den Ufern des Flusses Oxus zwischen Pakistan und Iran, und nördlich von Bombay. Schätzungen, die auf Ausgrabungen in den 1970ern basieren, sprechen von einem Gebiet von mindestens 750.000 Quadratkilometern; dies ist größer als Pakistan.
Damit ist die Industalkultur geografisch und nach der Bevölkerungszahl größer als die beiden anderen Hochkulturen jener Epoche, Mesopotamien und Ägypten. Doch damit hören die genauen Werte auf. Denn im Gegensatz zu den Mesopotamiern und den Ägyptern sind die Industalbewohner bisher noch reichlich wenig erforscht. Wir haben zum Beispiel keine Ahnung, ob sich die Induskultur über das ganze Gebiet erstreckte oder in einer Reihe von mächtigen Städten isoliert blieb. Wenn es einen Abstand von bis zu tausend Kilometern zwischen der einen und der anderen Großstadt gibt, kann man kaum davon ausgehen, dass die Stadtbevölkerung eine völlige Kontrolle über jeden Bauern und Nomaden dazwischen hatte. Bis zum heutigen Tag bilden die Städte die Hauptquelle unseres Wissens. Sie waren Meisterwerke der Planung und Konstruktion. Viele von ihnen hatten über 50.000 Einwohner. Sie hatten auch den höchsten Sanitärstandard in der gesamten Frühgeschichte des Nahen Ostens.
Von den erhaltenen Häusern war die Mehrzahl mit Brunnen oder einer Frischwasserversorgung ausgestattet; sie hatten auch Abwassersysteme und oft ein Badezimmer. Die Gebäude hatten wahrscheinlich mehrere Stockwerke – Fenster gab es nicht zur Straße, sondern nur zu einem Innenhof. Was wirklich verwirrend ist, ist das Fehlen von repräsentativen Bauten. Es gibt keine Paläste oder Tempel in diesen Städten. Dafür gibt es Belege für große Bäder (?) und öffentliche Plätze. Bäder (d.h. große Wasserbehälter ohne bekannten Zweck) wurden in Mohenjo-Daro und Lothal entdeckt. Große Plattformen aus Ziegeln tauchen vor allem in Mohenjo-Daro, Lothal, Chanhu-Daro, Kot Diji und Harappa auf. Diese Plattformen wurden interpretiert als Versammlungsplätze, Ritualstätten, Fundamente für weitere Gebäude und als eine künstliche Erhöhung in einer Landschaft, die ständig von Überschwemmungen bedroht war. Wenn Du Dir Fotos der Ausgrabungen anschaust, wirst Du den Eindruck bekommen, dass die Industalleute praktisch in einer Wüste lebten. Das ist völlig falsch: das Land war dank der regelmäßigen Überschwemmungen extrem ergiebig und bot große Mengen frischer fruchtbarer Erde. In der Nähe der Flüsse gab es dichte Dschungel, die von Rindern, Tigern, Elefanten, Rhinozerossen, Affen und Krokodilen bevölkert waren.
Die Induskultur erreichte ihren Höhepunkt zwischen 2500 und 1900 v.u.Z. Genau wie die beiden anderen Hochkulturen ihrer Zeit verfügten die Industalbewohner über eine Schrift. Doch diese weicht stark von den anderen ab. Zurzeit gilt die Erfindung einer funktionierenden Schrift (im Gegensatz zur wesentlich früheren Viñca-Schrift, die eher sakralen Zwecken diente) als ein Verdienst der Sumerer. Diese begannen um etwa 3200 v.u.Z. zu schreiben. Die frühesten erhaltenen Texte sind einfach Listen, die der Buchhaltung dienten. Sie wurden von Priestern angefertigt, welche die großen Tempel und deren Manufakturen leiteten.
Da die Tempel in etlichen Stadtstaaten die höchste Macht darstellten, und über den Großteil des Landes verfügten, war die sumerische Buchhaltung alles andere als einfach. Zunächst handelte es sich um einfache Listen von Zahlen, Namen und hübschen Piktogrammen, welche z. B. Rinder oder Schafe bedeuteten. Schon bald darauf folgte die Erkenntnis, dass man nicht nur mit Bildern schreiben kann, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, die Klangform der Bilder zu nutzen. An genau diesem Punkt verwandelt sich eine Ansammlung von Bildern in eine echte Schrift. Das war ein entscheidender Durchbruch, der es ermöglichte, über Themen zu schreiben die nicht als Bilder darstellbar waren. Zwischen ca. 3200 und 3000 v.u.Z. entwickelte sich so ein Schreibsystem, welches immer komplexere Themen darstellen konnte, und dabei immer abstrakter wurde. Wer heute Keilschriftzeichen sieht, würde kaum auf die Idee kommen, dass jedes von ihnen ursprünglich ein Bild war. Als die sumerische Schrift bereits funktional war, wurde die Idee der Schreibkunst von den Ägyptern übernommen. Diese waren allerdings nicht daran interessiert, die Schrift der Sumerer zu kopieren. Sie übernahmen die Prinzipien und Möglichkeiten, gestalteten aber daraus ihre ganz eigene Bilderschrift, welche speziell für ihre Sprache geeignet war und, im Gegensatz zur sumerischen Schrift, keine Vokale darstellt. Das Ergebnis waren viele verschiedene Worte die mit den gleichen Zeichen geschrieben wurden. Für die heutigen Forscher ist das ein deutlicher Nachteil: Übersetzungen der mesopotamischen Literatur sind wesentlich sicherer als es Übersetzungen aus Ägypten jemals sein werden. Im Industal scheint eine ähnliche Entwicklung geschehen zu sein. Die dortige Kultur entwickelte eine eigene Schrift, die auf einzigartigen Symbolen und Bildern basierte. Doch leider ist diese Schrift bis heute nicht entschlüsselt worden.
Ein Teil des Problems ist die relative Seltenheit der Inschriften. Mesopotamische Keilschrift überdauerte die Jahrtausende auf wunderbar haltbaren Tontäfelchen; ägyptische Hieroglyphen auf Steinen, an Bauwerken und in perfekt abgeschlossenen Grabkammern. Ob die Bewohner des Industals auf vergänglichen Materialien schrieben, ist bisher nicht bekannt. Die meisten Texte tauchen auf Siegeln auf. Das sind üblicherweise kleine Objekte aus Steatit, 17 bis 30 mm groß, und es sind durchschnittlich fünf Zeichen sowie Bilder auf jedem Siegel zu finden. Damit wird es wahrscheinlich, dass die Inschriften Namen oder Titel bedeuten, was die Entzifferung extrem schwierig macht. Bis jetzt können sich die Experten noch nicht einmal auf die Anzahl der verschiedenen Zeichen der Indusschrift einigen; Schätzungen reichen von 200 bis 450, je nachdem, ob man separate Zeichenelemente oder Kombinationen zählt. Auf den meisten Siegeln sind, neben der Inschrift, auch Tiere abgebildet. Der große Favorit ist ein Stier, der im Profil mit nur einem Horn zu sehen ist. Ob er ein Einhorn darstellt, wie gerne behauptet wurde, ist unklar. Er ist üblicherweise neben einem mysteriösen Gegenstand zu sehen, der als eine Fahne, ein Ständer, ein Futtertrog und als ein Gerät zum Pressen und Filtern von Soma bezeichnet wurde. Wer kann da noch behaupten, Wissenschaftler hätten keine Phantasie? Rinder wie der Auerochse und das Zebu tauchen auf vielen Siegeln auf, auch Wasserbüffel, Antilope, Rhinozeros und Tiger. Viel seltener sind Bilder von Elefanten und Krokodilen. Es gibt auch einige Fabeltiere wie dreiköpfige Stiere, Tiger mit Hörnern, Antilopen mit Elefantenrüsseln und Menschen mit Tigerköpfen. Abbildungen von Menschen sind die seltensten von allen. Sie zeigen menschliche Gestalten, aber können wir sicher sein, dass es Menschen sind und keine Halbgötter (wie der Held, der zwei Tiger hält, und einem sumerischen Motiv gleicht) oder sogar Gottheiten? Was sollen wir von dem Menschen halten, der auf einem Baum sitzt, angesichts eines Tigers, der unter ihm herumstreicht? Wer identifizierte sich mit einem solchen Bild und machte es zu seinem persönlichen Siegel?
Dies führt zu einem der Rätsel der Induskultur: Woran glaubten diese Leute eigentlich? Bisher ist die Beweislage dafür extrem dünn. Keine Tempel, Kirchen, Schreine und noch nicht einmal Altäre wurden entdeckt. Das Indusvolk könnte zu Hause gebetet haben oder auf den weitläufigen Plattformen, sie könnten rituelle Bäder oder heilige Feuer gehabt haben, aber bisher kann das niemand nachweisen. Es gibt keine Stelen oder großen Statuen von Göttern oder Menschen. Nur sieben steinerne Statuetten wurden bisher entdeckt; sie sind klein und sehen aus, als wären sie nach sumerischen Originalen kopiert. Die Teile sind etwas beschädigt und stellen kniende Menschen dar. Dies lässt den Ausgräbern nur zwei mögliche Quellen, um über religiöse Aktivitäten zu spekulieren. Eine davon sind die Tonfigürchen, die an manchen Orten seit der Neusteinzeit hergestellt wurden. Unter diesen Figürchen finden wir eine große Menge Frauendarstellungen. Und die wurden immer wieder religiös gedeutet. Im frühen zwanzigsten Jahrhundert war der wissenschaftliche Mainstream noch immer fasziniert von der Idee des Matriarchats, und konsequenterweise wurden sie als Beweis für die Verehrung von Göttinnen angesehen. Manche Gelehrten interpretierten sie sogar als Darstellungen einer einzelne große Göttin. Wann immer Wissenschaftler auf weibliche Darstellungen stießen, konnte man sicher sein, dass sie das Matriarchat postulierten, bevor sie anfingen zu denken. Dieser Trend ging bis in die 1960er Jahre. Moderne Forscher sind wesentlich vorsichtiger geworden. Werfen wir einen näheren Blick auf die Statuetten. Heutzutage sind wir froh, eine Ahnung von den verschiedenen Perioden zu haben, in denen Statuetten hergestellt wurden, zumindest an manchen Orten.
Hier erfolgt nun eine kurze Zusammenfassung nach Jarrige (1987 : 95), in Vergessene Städte am Indus. Die erste und zweite Epoche in Mergarh bietet die primitiven Darstellungen der ersten bekannten Siedler; sie ähneln nur entfernt sitzenden menschlichen Wesen, die Beine sind zusammen und ausgestreckt, es gibt keine Arme, Gesichter oder nennenswerte Einzelheiten. Manche Figuren zeigen leichte Wölbungen, die Gürtel oder Halsbänder symbolisieren, einige sind mit rotem Ocker gefärbt. Gleichzeitig taucht roter Ocker bei Bestattungen auf. Besteht hier eine Verbindung der Figuren zu einem (völlig unbekannten) Totenkult? In Epoche 3 verschwinden die menschlichen Figürchen völlig. Sie werden durch tönerne Darstellungen von Stieren ersetzt, manche davon liebevoll verziert. Das klingt nach einer nebensächlichen Umgestaltung, könnte aber auf drastische Veränderungen im religiösen Leben oder auf eine Welle von neuen Einwanderern hindeuten. Epoche 4, ca. 4000 v.u.Z., zeigt eine Wiederkehr der menschlichen Figürchen und einen technischen Durchbruch: Die Figürchen bestehen aus einzelnen Teilen. Hier finden wir weibliche Figuren mit herausragenden Brüsten und einige Versuchen, Haar und Kleidung anzudeuten; sie sind jedoch noch immer grob und sehen nicht sehr verehrungswürdig aus. In Epoche 5 ermöglicht eine neue Tonqualität den Künstlern, feinere Figürchen herzustellen und sie bei höheren Temperaturen zu brennen. Es gibt erste Versuche, Arme und maskenartige Gesichter darzustellen und die Frisur wird höchst ausgefeilt. Dieser Prozess der technischen Verfeinerung hält eine Weile an. Dann in Epoche 7 scheinen einige der Frauen Kinder zu halten (üblicherweise Tonklumpen mit einem Gesicht). Gleichzeitig tauchen männliche Statuetten auf. Sie haben eine andere Körperhaltung und zeigen detaillierte Genitalien. Dies ist ungewöhnlich. Bei den weiblichen Statuetten waren die Brüste üblicherweise deutlich sichtbar, aber die Genitalien nie detailliert dargestellt. Warum war dies bei den Männern der Fall? Mehrere Arten männlicher Frisuren mit Knoten und Zöpfe sind festzustellen. Am Ende dieser Epoche taucht unter den Figürchen ein neuer Typ von Mann mit einem runden kahlen Kopf auf, und ab diesem Zeitpunkt werden die Dinge standardisiert. Die letzte Siedlungsepoche in Mergarh liefert massenhaft produzierte Statuetten in großen Mengen, die meisten von ihnen einheitlich, lieblos und ohne Sorgfalt ausgeführt. Jetzt kommen wir zur großen Frage: waren diese Gegenstände Objekte der Verehrung? Frühe Forscher bezogen sich fast ausschließlich auf die weiblichen Figürchen, und stellten diese gerne als Idole dar. Doch die Realität sieht anders aus. Die meisten Figürchen waren grob, billig und zerbrechlich. Nur wenige davon hätten eine tägliche Handhabung oder einen Transport überstanden. Manche weiblichen Statuetten sehen eher wie Wellensittiche als wie menschliche Wesen aus, ganz zu schweigen von Göttinnen. Sie sind auch oft zerbrochen, beschädigt und gelegentlich verbrannt. Eine ganze Menge von ihnen kam nicht an besonderen Orten zum Vorschein, sondern wurde in Abfallgruben entdeckt.
Statuetten – egal, ob ‘Venusfiguren’ des Paläolithikums oder Tonfiguren aus kretischen Gräbern – sollte man nicht automatisch für Objekte der Verehrung halten. Die ägyptischen Pharaonen hatten Abbildungen von Menschen in ihren Gräbern, weil sie im Jenseits von ihnen bedient werden wollten. Die frühen chinesischen Herrscher ließen sich mit Ministern, Frauen, Wachleuten, Kriegern und Lieblingssklaven begraben, in späteren Zeiten waren Statuen ein billigerer Ersatz. Die Kreter hatten grobe Tonfiguren in ihren Gräbern. Diese Figuren waren keine Götter, sie wurden im täglichen Leben nicht verehrt. Frühere Studien über Kreta überschätzten die weiblichen Abbildungen und behaupteten, dass sie alle eine einige große Göttin darstellten. Ein Besuch in jedem kretischen Museum zeigt, dass es sowohl männliche wie weibliche Statuetten gab, von denen die meisten ziemlich schäbig aussehen. Dies reicht nicht aus, um eine Religion zu rekonstruieren. Im alten Sumer war es in Mode, dass Bessergestellte Abbildungen von sich selbst aus Ton oder Stein anfertigen ließen. Diese Abbildungen (oft grob impressionistisch und keineswegs dafür gedacht, eine Ähnlichkeit zu zeigen) wurden in Tempeln und Schreinen aufgestellt. Da das Abbild den Anbeter repräsentierte, war dieser (theoretisch) zu jeder Zeit im Tempel in frommer Andacht, selbst wenn er auf dem Markt feilschte oder sturzbetrunken im Bett lag. Andere Kulturen hatten Statuetten, die abwesende oder verstorbene Familienmitglieder repräsentierten; besonders verbreitet sind solche Bräuche in Westafrika. Wie Du siehst, kann es eine Menge Gründe geben, Statuetten zu fertigen. Diejenigen aus dem Industal sind oft grob und einfach, und wenn sie wirklich Götter darstellen sollten, dann waren jene Götter eindeutig nicht viel wert. Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass die vielen menschenähnlichen Statuetten Götter bedeuten sollen, geschweige denn, dass diese allesamt auf eine einzige, monotheistische Urzeitgöttin verweisen. Die Fabel von einem matriarchalischen Industal, das eine große Göttin verehrte, wurde also verworfen. Die Möglichkeit dafür bleibt natürlich bestehen, wie auch viele andere Möglichkeiten, aber die Beweislage ist zu dünn, um irgendetwas zu behaupten.
Dann sind da die Steatitsiegel. Wie Du Dich erinnerst, zeigten die meisten Bilder von Tieren. Eine kleine Anzahl zeigt auch menschliche Gestalten. Anders als bei den anderen großen Zivilisationen des Orients sind solche Bilder selten und haben wenig mit dem täglichen Leben zu tun. Die Sumerer liebten es, gesellschaftliche Ereignisse, höfisches Leben, Arbeit, Feiern, Reisen und die Mythen und Versammlung der Götter darzustellen; die Indusleute mieden solche Themen. Ihre menschlichen Darstellungen könnten Menschen sein oder auch Gottheiten. Manche Figuren haben ausgefeilte Kronen, andere tragen Hörner. Es wurde spekuliert, diese seien Gottheiten. Immerhin haben die Sumerer die Hörnerkrone als Symbol für viele ihrer Hochgötter verwendet, und nach ihnen eine ganze Reihe alter Kulturen des Orients. Doch im Industal begegnen wir solcherart geschmückten Menschen, welche ganz so aussehen, als würden sie Bäume und Pflanzen verehren. Handelt es sich um eine Art von Priesterschaft? Galten die Kulte jener Epoche der Vegetation? Die Verehrung von fantastischen Bäumen und Pflanzen taucht auf mehreren Siegeln auf, und gelegentlich gibt es menschliche Figuren, die zwischen den Bäumen stehen und vielleicht Verehrung empfangen. Sollen wir annehmen, dass die Yakṣas, die Baum- und Pflanzengeister der späteren hinduistischen Mythologie, ihren Ursprung in dieser Epoche haben? Beweisbar ist auch hier nichts, doch möglich ist es allemal. Es gibt auch Bilder, die Götter darzustellen scheinen. Manche von ihnen sind dreiköpfig, sie sitzen mit gekreuzten Beinen zwischen Tieren. Auch hier hat die Phantasie der Forscher zu erstaunlichen Deutungen geführt. Zunächst einmal wurden die Figuren im Schneidersitz gerne als frühe Belege für Yoga gedeutet. Diese Annahme ist, wie White (2011 : 48-59) detailliert darstellt, völlig unhaltbar. Der frühe Yoga kennt keine Sitzhaltungen; diese wurden erst um das dritte bis vierte Jahrhundert unserer Zeit langsam bei Randgruppen populär, und die frühesten Darstellungen sitzender Yogīs erscheinen erst um das sechste Jahrhundert herum, also rund 2500 Jahre nach dem Untergang der Industalkultur. Die dreiköpfigen Figuren wurden auch gerne als frühe Darstellungen des wesentlich späteren Gottes Śiva erklärt, der den Titel Paśupati hat: Herr der Haustiere bzw. Herr der Tiere. Die Tiere umringen die Figur, als wären sie noch nicht domestiziert, also haben wir es vielleicht mit Śivas Vorgänger Rudra zu tun, der tatsächlich auch ein Herr der wilden Wälder und ihrer Tiere ist. Es ist jedoch schwer zu sagen, ob die Figur männlich oder weiblich ist, da alle klaren Geschlechtsmerkmale fehlen. Ein angeblicher Phallus könnte genauso gut ein Teil eines Gürtels sein. Auch die Brustgegend ist nicht eindeutig identifizierbar. Das Thema ist ausgesprochen mehrdeutig: Gottheiten, egal ob männlich oder weiblich, die zwischen Tieren thronen, sind im gesamten Nahen und Mittleren Osten ausgesprochen häufig. Sie werden von der Fachwelt als Herr oder Herrin der Tiere bezeichnet. Früher galten sie als einheitliches Thema; heute werden sie wesentlich vorsichtiger behandelt, denn die Figuren haben ausgesprochen unterschiedliche kulturelle Hintergründe und Funktionen. Wer hier, im Stil der vergleichenden Religionswissenschaften, versucht, alles auf einen simplen Archetypus zu reduzieren, verpasst ungeheuer viel. Damit sind wir so ratlos wie bisher. Die beliebten Verallgemeinerungen der letzten Forschergenerationen sind überholt. Die weiblichen Ton-Statuetten sind nicht unbedingt die (oder eine) große Göttin. Der sitzende Gott ist nicht unbedingt Śiva/Rudra. Wie unbequem für all die Enthusiasten, die sie für einen Beweis einer ‘tantrischen’ Religion der Induskultur halten.
Bild 5
Proto-Yantras in der Felskunst.
Meist prähistorisch (oder schwer zu datieren).
Oben links und Mitte links: Diagramme, Chambal-Tal, Indien.
Oben rechts: Labyrinth, Tikla, Madhya Pradesh.
Mitte rechts: quadratische Diagramme, Kharwai, Raisen, Madhya Pradesh.
Unten links: Mesolithische Bilder von Stieren, Jägern, Pfau, Hand, Fisch (?) und Yoni-Dreieck, Bhimbetka, Madhya Pradesh. Unten rechts: Stierköpfe, Chambal-Tal, Zentralindien.
Wir wissen so wenig über die Bewohner jener Städte, dass jeder Versuch, deren Religion zu definieren, auf Spekulation hinausläuft. Man könnte sogar argumentieren, die Industalleute hätten überhaupt keine Religion gehabt. Das ist, zugegeben, recht unwahrscheinlich, aber auch nicht zu widerlegen. Sollen wir uns eine Reihe von kleinen Haushaltsritualen vorstellen? Oder große Rituale, die keine Spuren hinterlassen haben? Hatten die Städte überhaupt eine gemeinsame Religion? Bedenkt man die enormen Abstände zwischen manchen Städten, ist eine eigenständige Entwicklung fast unvermeidlich. Aus den Städten im östlichen Teil der Kultur (Rājasthān, Haryana und Guyarāt) sind weniger Figürchen überliefert als aus denen im Westen. Waren sie weniger religiös? Gab es hier andere ethnische Gruppen? Und während es schon schwierig ist, Vermutungen über die Bewohner der Städte anzustellen, ist das bei den Dörflern und der Landbevölkerung, die weder Siegel noch Figürchen hatte, noch viel schwieriger. Wir haben also im Industal eine Menge wunderbarer Rätsel, die noch ganze Forschergenerationen beschäftigen werden.
Und wie endete die Industalkultur? In älteren Studien kann man viele Spekulationen darüber finden, wie die gewalttätigen Ārya mit ihren gut ausgebildeten Kriegern und ihren von Pferden gezogenen Streitwagen die Industalbevölkerung vernichteten. Diese Hypothese ist heute komplett überholt. Archäologisch gibt es keinen Beweis für eine solche Kriegführung, geschweige denn von den schrecklichen Massakern, die sich manche Gelehrten vorstellten.
Es stellte sich heraus, dass die Induszivilisation Jahrhunderte vor dem Auftauchen der arischen Migranten endete. Hier wäre es schön, eine genaue Zeitangabe zu geben. Doch diese ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unmöglich. Der Handelskontakt mit Mesopotamien endete in der frühen Alten Babylonischen Periode, also zwischen ca. 2000 und 1800 v.u.Z. Zu dieser Zeit verschob sich auch der Machtschwerpunkt vom südlichen Seeland Sumers nach Mittelmesopotamien, und der Seehandel verlor überhaupt an Bedeutung. Stattdessen belebte sich der Überlandhandel von Stadt zu Stadt, insbesondere nach dem Iran und Zentralasien, und die Handelsbeziehung nördlich in Richtung der heutigen Türkei und westlich zum Mittelmeer. Die Invasion der Ārya wird auf etwa 1500-1200 v.u.Z. datiert. Im Industal begann der Zerfall der großen Metropolen ungefähr um 1900-1800 v.u.Z.; die Hochkultur als solche scheint um 1750 v.u.Z. untergegangen zu sein. Was in der Zwischenzeit geschah, ist eine Frage, die noch nicht beantwortet werden kann.
Bild 6
Induskultur, Siegel.
Oben: Eine von mehreren Gottheiten mit drei Köpfen, Mohenjo Daro, 2,65 x 2,7 cm.
Unten: sog. 'Einhorn' und seltsame Gerätschaft, Mohenjo Daro.
Die großen alten Metropolen wurden weder geplündert noch zerstört. Die Einwohner verließen sie und nahmen fast alle nützlichen und schönen Dinge mit, über deren Funde moderne Archäologen froh wären. Was im Industal und seiner Umgebung ausgegraben wird, sind Geisterstädte. Dies bereitet vielen Gelehrten Probleme. Wieso wurden die großen Städte verlassen? Bisher besteht darüber wenig Einigkeit. Es scheint, dass mehrere Einflüsse für den Niedergang verantwortlich waren. Einer davon war die tektonische Aktivität im Himalaya, die Erdbeben und das Austrocknen wichtiger Flüsse (Ghaggar und Hakra) verursachte. Es scheint auch extreme Unregelmäßigkeiten der Niederschläge gegeben zu haben, und manche Städte in der Nähe des Indus könnten überflutet und unter Tonnen von Schlamm begraben worden sein. In anderen Gegenden könnten sich die Flussläufe verändert und von den Siedlungen entfernt haben. Auch wurde das örtliche Klima um 1800 v.u.Z. kälter und der Monsunregen schwächer. Die Städte gingen also unter. Jetzt stellt sich die Frage, warum sie nicht andernorts wieder aufgebaut wurden. Die Industalsiedler hatten das technische Wissen: warum verschwand ihre Kultur so schnell?
Hier besteht die Möglichkeit, dass die Explosion des Vulkans von Thera/ Santorin einen Einfluss hatte: als der Krater um ca. 1644 oder 1629 zerbarst (nach Eiskerndatierungen aus Grönland) setzte eine mehrjährige Verdunklung des Himmels ein. Es wurde nicht völlig finster, doch war der Aschenebel ausreichend, um weltweit schwere Missernten und Hungerkatastrophen auszulösen. Wie bei der wesentlich schwächeren Eruption des Krakatau und des Mount Tambora, kam es zu starken Störungen im Monsun. In manchen Gegenden blieb der Regen völlig aus, in anderen verursachte er unbeschreibliche Überschwemmungen. In dieser Zeit wurden viele Hochkulturen zerstört oder von wandernden Völkern überrannt. In der frühen Bronzezeit waren die Temperaturen noch etwas höher als heute; in der mittleren deutlich kälter. Das Leben wurde rauer, ärmer und gewalttätiger. Gerade diese Zeit von Hunger und Elend kann dazu geführt haben, weitgehende Migrationen zu begünstigen. Vielleicht haben wir hier einen Grund, warum die Ārya ihre (immer noch unbekannte) Heimat verließen und nach Indien hereinströmten. Was immer die Gründe gewesen sein mögen, sie hielten die Bauern im Industal nicht davon ab, weiterhin auf dem Land zu leben. Während die großen Städte verschwanden, wurde eine Anzahl florierender neuer Dörfer gegründet, die sich in den folgenden Jahrhunderten zu kleinen Städten entwickelten. Diese verabschiedeten sich bald von ihrer Vergangenheit. Vorbei war die Zeit der geraden Straßen und großen Plätze, vorbei war es mit standardisierten Ziegeln, Maßen und Gewichten. Jede Siedlung entwickelte eigene Formen und Vorlieben. Als die Ārya nach Indien eindrangen, trafen sie eine analphabetische Bauernkultur an, die nur noch wenig vom Entwicklungsstand der Vergangenheit aufwies. Von den großen Kulturleistungen der Vorzeit wird in den Gesängen der Ārya nichts erwähnt.
Bild 7
Induskultur – Figurinen von Mehrgarh.
Oben: Drei ausgearbeitete weibliche Figuren mit charakteristischer Kopfbekleidung, abstrakten Gesichtern, großen Brüsten, ohne Genitalien. 3300 – 3000 v.u.Z., Ton, gefunden in einer Abfallgrube
Oben rechts: Das erste Stadium der menschlichen Figurinen. Kein Gesicht, keine Glieder, überhaupt keine Details. Wenn es nicht die Vorstufe einer späteren weiblichen Figurine wäre, würden wir dieses Stück Ton überhaupt nicht als Figurine erkennen. In diesem Stadium sieht das Stück kaum menschlich aus, ganz zu schweigen von einer Gottheit.
Unten links: Männliche Figurine, 2700 – 2600 v.u.Z.
Unten rechts: Männliche Figurine von kahlköpfigem Typus, 2800 – 2700 v.u.Z. Zu der Zeit machten männliche Figurinen einen Anteil von 30 Prozent aus.