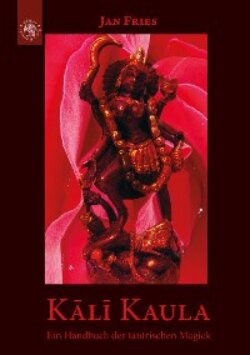Читать книгу Kālī Kaula - Jan Fries - Страница 31
Drei Temperamente
ОглавлениеIndoeuropäer sind im Allgemeinen verrückt nach Dreiheiten. „Alle guten Dinge sind drei.“ Wenn irgendetwas in Dreiergruppen geordnet werden konnte, wurde das auch getan. Du findest dieses Faible unter den Kelten und Germanen genauso wie im griechischen Mythos und in der indischen Kosmologie. Eine der am besten bekannten und am wenigsten verstandenen Dreiheiten sind die Guṇas: sie sind eines der Fundamente der Saṁkhya-Lehre und wurden von vielen anderen Philosophien übernommen. Der Guṇa hat mehrere Bedeutungen; drei davon sind: 1. Faden, Seil, Schnur, 2. Qualität oder Eigenschaft, 3. Sorte, Art, Kategorie. Die drei Qualitäten sind eine der grundlegendsten Ideen in der hinduistischen Philosophie. Śakti als Prakṛti (Natur, Materie, Erscheinung) stellt man sich als aus drei Guṇas bestehend vor: Sattva, Rajas und Tamas. Tamas ist am leichtesten zu verstehen: Das Wort bedeutet ‘Dunkelheit’ und ist verwandt mit dem deutschen ‚dämmrig‘ und dem englischen ‘dim’ für Halbdunkel, Zwielicht, Düsternis. Es wird gebraucht zur Beschreibung von Schwere, Trägheit, Stabilität, Routine, Gewohnheitsverhalten und, im Bereich der menschlichen Empfindungen und Verhaltensformen, für Ignoranz, Faulheit, Bequemlichkeit, Eingleisigkeit, Weltlichkeit und Materialismus. Der oder das Rajas bedeutet in der Saṁkhya-Philosophie vor allem Leidenschaft; in der tantrischen Schattensprache kann es auch Menstruation bedeuten. Rajas ist heiß, energisch, aktiv, rastlos und der einzige veränderliche Guṇa. Im Bereich der menschlichen Erfahrung drückt sich Rajas als Entzücken, Begierde, Frustration, Leidenschaft, Gefühlsausbrüche, Besessenheit, Eifersucht, Triebe, Rastlosigkeit, Verwirrung, Hader, Zorn und Traurigkeit aus. Hierbei geht es stets um starke Gefühle, die sich auch immer wieder gegenseitig erzeugen. Wenn starke Begierde frustriert wird, kommt es z. B. zum Zorn. Dabei handelt es sich im Grunde um Babyverhalten: wenn das Baby nicht bekommt, was es will, brüllt es, bis die Mama die Welt wieder gut macht. Und was für’s Baby funktioniert hat, wird oft von Erwachsenen weiter betrieben. Denk daran, wenn Du das nächste Mal meinst, zornig werden zu müssen.
Sattva, der Saguṇa, wird ‘gut’ im Sinne von ‘Güte’ genannt. Das Wort bedeutet unter anderem Existenz, Realität, Wesen, Geist, Sein, wird aber im Saṁkhya-Denken vor allem als das Prinzip des Guten betrachtet. Das Sattva ist der heikelste der drei Guṇas. Es erscheint als verfeinert, abgehoben, ruhig, friedvoll, ausgeglichen und subtil, schwer zu definieren und nicht immer begreiflich.
Die drei Qualitäten werden oft mit Farben gleichgesetzt. Tamas ist dunkel, schwarz oder braun, Rajas ist rot und feurig, und Sattva ist von einem blassen, kühlen, mondähnlichen Weiß. Diese Farbcodes sind oft in der hinduistischen Literatur zu finden, wo sie manchmal zu einer tieferen Bedeutung führen und genauso oft Verwirrung erzeugen. Ein Beispiel: Für manche Leute folgt die populäre Trinität der Götter dem Muster von Schöpfer, Bewahrer und Zerstörer. Diese Funktionen erfüllen etliche Gottheiten, und nach dem Glauben vieler lautet die richtige Ordnung: Brahmā für die Schöpfung, Viṣṇu für die Bewahrung und Śiva oder Rudra für die Zerstörung. Dies ist eine populäre Vorstellung, die in Büchern einen guten Eindruck macht, aber wenig mit dem zu tun hat, was die Anhänger dieser Gottheiten glauben. Du hast hoffentlich gleich gemerkt, dass diese Trinität alles andere als ausgeglichen ist: zwei der Teilnehmer sind weltumfassende Hochgötter mit gewaltig vielen Anhängern, während Brahmā, bestenfalls ein Schöpfergott unter vielen, ständig auf die Hilfe der anderen zwei angewiesen ist. Wer die Bhagavad Gītā gelesen hat, weiß dass Viṣṇu nicht nur erhält, sondern auch schafft und alles verschlingt. Für die Anhänger Śivas ist dieser nicht nur für die Zerstörung zuständig, sondern für alle drei Funktionen. Derartige kosmische Götter auf simple und einseitige Funktionen zu reduzieren, ist bestenfalls in den Mythen nützlich, während es bei der direkten Gotteserfahrung einfach nur belastet. Śiva bildet oft ein Paar mit Kālī, die den Uninitiierten auch dunkel und zerstörerisch erscheint, und folglich glauben viele Leute, dass Śiva und Kālī von tamasischer Natur sind. Für die Anhänger dieser Götter sehen die Dinge ganz anders aus. Dunkelheit ist ja schön und gut, aber mit Trägheit, Materialismus und Ignoranz haben die beiden herzlich wenig zu tun. Von Kālīs alles verschlingendem Mund sagt man zum Beispiel, dass er alle drei Qualitäten enthalte: Die Lippen sind dunkel (Tamas), der Gaumen ist rot (Rajas) und die spitzen Zähne sind weiß (Sattva). Wenn die Göttin ihre Anhänger verschlingt, gehen diese durch alle drei Guṇas, bevor sie in der zentralen Leere ihre Befreiung finden.
Von den Guṇas geht eine dreifache Struktur aus, die grundlegend für das Verständnis des Tantra ist. Die Tantriker werden oft nach den Qualitäten klassifiziert, die ihren Charakter dominieren. Wir sprechen hier von den Qualitäten, nicht von den Menschen als solchen. Behalte im Sinn, dass dies ein sehr fließendes Modell der Welt ist und dass Menschen sich ständig ändern. Denk Dir einen Faden, der aus drei Fasern gesponnen ist, einer schwarzen, einer roten und einer weißen, und stell Dir das Gewebe der Welt vor. Jedes Lebewesen ist aus den drei Guṇas zusammengesetzt und alle drei sind nötig für Geburt, Dasein und Befreiung. Nur wenn ein Guṇa die anderen dominiert, neigen die Dinge zu Extremen.
Paśu. Zuerst kommen die Paśus – ein Wort, mit dem ein Laie gemeint sein kann, jemand ohne spirituelle Bildung, oder ein Haustier. Abhängig vom Ton des Tantras kann ein Paśu ein simpler und ignoranter Mitmensch sein, oder öfter, ein Lasttier, das mit den Ketten der Bindungen, der Beteiligung und der Sinnlichkeit gefesselt ist. Manche Texte stellen den Paśu als ein dummes Tier, eine grobe und unspirituelle Person dar. Dies stimmt nicht ganz. Der Paśu ist bereits ein Anhänger des Tantra. Das Wort ‘Paśu’ entwickelte sich aus ‘Paś’, was ‘binden’ bedeutet, und ‘Pāśa’ ist eine Schlinge. Das KT listet acht Grundformen der Bindung auf:
1 Mitleid,
2 Ignoranz und Wahn,
3 Furcht,
4 Scham,
5 Ekel,
6 Familie,
7 Brauch und
8 die Stellung in der Gesellschaft, der Klasse.
Jeder, der durch diese Stricke gebunden ist, ist technisch gesprochen immer noch im Reich des Paśu. Und das gilt, zumindest von Zeit zu Zeit, für uns alle. Paśus leiden unter drei Unreinheiten:
1 Kein oder falsches Wissen über das Selbst,
2 Glaube an separate Identitäten und
3 Bindung an Aktivität, Tun und deren Ergebnisse.
Davon frei zu sein, bedeutet Śiva zu sein. Im Paśu wirkt Rajas (Leidenschaft) auf Tamas (Trägheit) und dies neigt dazu, Weltlichkeit, Ignoranz und Faulheit zu erzeugen. Hierüber wurde eine Menge geschrieben, doch es sollte reichen zu sagen, dass der Paśu in einer dualistischen Realität lebt, in der er/sie von den Göttern getrennt ist, die Götter voneinander getrennt sind, die Gesellschaft feste Unterschiede hat und die Kulturen, Religionen und Länder über klare Grenzen verfügen. Der Paśu führt ein weltliches Leben und mag es. Er/ sie ist in einem gewissen Maße religiös, in der Praxis oder im Prinzip, aber es klafft oft eine große Kluft zwischen dem, was im Allgemeinen geglaubt und im Einzelnen getan wird. Die religiöse Praxis der Paśus hat ihre Zeit und ihren Ort, sie erstreckt sich üblicherweise nicht auf das tägliche Leben oder hält den Paśu auch nicht von einem guten Essen ab. Was die Gottheiten angeht, neigen Paśus oft dazu, sie in Elternrollen zu erleben. ‘Hey Vati, diese Jungs waren böse zu mir! Geh und bestraf sie! Hey Mami, bekomme ich Süßigkeiten?’ Wer so betet, ist im Land der Fesseln und der Ignoranz zuhause. In diesem Sinne entscheiden sich viele Anhänger, sich auf dem Schoß von Mutter Kālī zusammenzurollen; nicht weil Kālīs Mythologie besonders mütterlich wäre, sondern in der Hoffnung, dass sie nett zu ihrem kindlichen Anhänger sein wird. Was das tantrische Ritual angeht, ist es normalerweise Paśus nicht erlaubt, nächtliche Rituale durchzuführen; dies schließt sie von der persönlichen Kālī-Verehrung aus. Sie machen üblicherweise keinen Gebrauch von Yantra-Diagrammen noch praktizieren sie nächtliches Japa oder rezitieren spezielle Mantren. Stattdessen folgt die Art ihrer Verehrung oft vedischen Linien, einschließlich externer Opferungen, vielen rituellen Bädern und der Enthaltung vom Verzehr von Fleisch oder Fisch oder vom Geschlechtsverkehr, außer zum Zwecke der Fortpflanzung. Wenn ein Paśu die Pañcamakāras (Fünf M-Prinzipien) durchführen will, sind Fleisch, Wein, Fisch, trockenes Getreide und rituelles Liebesspiel verboten. Stattdessen wird eine Reihe symbolischer Alternativen genutzt. Es sollte hinzugefügt werden, dass ein Paśu wegen des Mangels an spiritueller Kompetenz ein solcher ist. Es gibt Rituale, die für Paśus verboten sind, weil diese sie einfach nicht begreifen können, geschweige denn an ihnen teilnehmen. Ein Paśu, der sich an den fünf Sakramenten in ihrer vīratischen (heldenhaften) Form zu erfreuen versucht, wird nicht viel Verehrung aufbringen können, weil er zu aufgeregt und unreif ist.
Bild 20
Fleckenkantschil.
Diese Hauer kennst Du!
Vīra. Ein Vīra ist wörtlich ein Held. Hier dominiert und agiert Rajas (Leidenschaft) in Sattva (Himmlische). Der Vīra zeigt ein ‘heroisches Temperament’. Sie/er neigt zu Aktivität (wenn nicht Überaktivität), Ambitionen, Zieldenken und ist selten mit einer Leistung zufrieden. Vīras sind erregbar, unruhig, unzufrieden und haben oft einen Sinn fürs Dramatische. Vīratische Verehrung kann Rituale bedeuten, bei denen Schädel, Knochen und sogar Leichen verwendet werden, sie können in Schlafzimmern, Dschungeln, Wüsten, auf nächtlichen Kreuzungen oder Verbrennungsstätten durchgeführt werden. Bei der Begegnung mit Göttinnen und Göttern steht ein/e Vīra aufrecht und integriert heroisch alle Ängste und Sehnsüchte. Vīratische Meditationen beziehen üblicherweise grimmige, schreckliche und widerwärtige Gottheiten mit ein. Für manche Vīras ist Religion so etwas wie eine permanente Mutprobe. Wenn es um die Vereinigung mit gefährlichen Göttern, Geistern, Dämonen oder ganz einfach den inneren Ängsten und Hemmungen geht, transzendiert der Vīra die Grenzen der menschlichen Persönlichkeit. Nicht viel anders ist es mit den Begierden: echte Vīras stehen zu ihren Lüsten und Trieben und suchen sie zu auszuleben, um sie zu transzendieren. Wenn ihr Temperament eher sattvisch ist, wählen sie den Pfad der Befreiung, aber wenn ihr Temperament starke tamasische Einflüsse zeigt, bevorzugt ein Vīra die Kultivierung der Siddhis (magische Kräfte, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Erfolge), um etwas in der Welt zu erreichen. Es gibt auch Vīras, die ganz pragmatisch denken, dass Befreiung ja gut und schön sein mag, ein paar magische Fähigkeiten die Dinge aber leichter machen. Der klassische Ritus der Pañcamakāra wird in vīratischen Begriffen ausgedrückt. Das größte Problem der Vīras besteht darin, dass sie oft schneller handeln als sie denken, und wenig Abstand zu den Dingen haben. Da sie auf Drama, Krise und Aufregung aus sind, erzeugen sie von Natur aus jede Menge davon. In die Welt verstrickt und mit so viel Energie agierend, neigen sie dazu, eine Menge Fehler zu machen und darunter zu leiden. Ihre Umwelt und ihr Bekanntenkreis haben es auch nicht gerade leicht mit ihnen. Die indische Literatur assoziiert Traurigkeit und Sorge mit den Vīras, weil sie so oft auf die Nase fallen oder eine drauf bekommen.
Bild 21
Musikantin (Trommlerin).
Surya-Tempel, Konarak, Orissa, 13. Jahrhundert. Sich selbst durch Musizieren zu erfreuen, wie das KCT nach der morgendlichen Reinigung und vor Beginn der Verehrung empfiehlt, ist der heutzutage der am meisten vernachlässigte Teil der tantrischen Praxis. Dies ist Deine Chance für etwas Neues.
Besorge Dir ein Instrument und verschaffe Dir gute Gefühle!
Divya. Hier begegnen wir denen, die oft als die ‘höchste Klasse der Anbeter’ betrachtet werden, d.h. als jene, in denen die göttliche Qualität am stärksten ist und die sattvische Natur dominiert. Diese Art von Personen ist genauso schwer zu beschreiben wie die göttliche Qualität im Menschen oder in der Welt insgesamt, da beide dazu neigen, paradox zu erscheinen. Das Divya als solches bedeutet unter anderem Himmel, das Himmlische und Göttliche. Es kann sich auch auf einen heiligen Eid oder ein Gottesurteil beziehen. Manche Texte haben die Divyas zu definieren versucht. Das Kubjīkā Tantra, zitiert von Sir John Woodroffe in seiner Einführung in das MNT, liefert eine solche Beschreibung. Um nur ein paar Punkte zu nennen: Wir erfahren, dass unser Divya den größten Teil des Tages mit Anbetung verbringt (mindestens dreimal täglich) und den größten Teil der Nacht Japa oder den Mantra praktiziert, sauber ist, belesen, gebildet, tolerant gegenüber Andersgläubigen, wohltätig, keinen Unterschied zwischen Freunden und Feinden macht, nur Nahrung isst, die vom Guru gesegnet ist, immer die Wahrheit sagt, gottlose Gesellschaft und Gespräche meidet, sich bis zu den Füßen vor Frauen verneigt (die er als seinen Guru betrachtet), alle Gottheiten verehrt, alles der höchsten Göttin darbietet, Śiva in allen Menschen wahrnimmt usw. Das klingt wie Heiligkeit, und wie Heiligkeit kann es auch missverstanden und vorgetäuscht werden. Eine Menge Leute gehen in die Irre, wenn sie den Divya zu spielen versuchen. Imitation von äußerer Heiligkeit kann Narren beeindrucken, aber nicht die Götter, und ganz sicher nicht das All-Bewusstsein. Wenn das Divyatum Anstrengung erfordert, dann ist es offenkundig nicht natürlich. Echte Divyas transzendieren die Rolle des Heiligen, und wenn sie Rituale durchführen, dann scheinen diese oft ganz normale Handlungen des täglichen Lebens zu sein oder finden komplett im Geist statt. Das große Problem der Divyas besteht darin, dass die Leute ringsum nicht ganz so heilig sind. Divyas neigen dazu, die Gottheit in jedem zu sehen. Sie vergessen, dass Menschen von ihrem Ego, ihren Ängsten und Begierden getrieben werden und dass eine potentielle Gottheit in jemandem nicht dasselbe ist wie eine manifestierte. Kurz gesagt, sie nehmen oft das Beste an, vertrauen in das Höchste und erleben regelmäßig Enttäuschungen. Divyas haben auch Probleme, mit der ganzen verdammten Alltagsrealität zurechtzukommen, mit Machtpolitik, Hierarchien und dem Bereich der typischen Menschenspiele.
Wir haben es bei den drei Temperamenten mit zwei Möglichkeiten zu tun. Manche religiösen Lehren bleiben innerhalb des Modells. Hier ist der Paśu ein fauler, träger und ignoranter Anfänger, der am liebsten auf dem Sofa sitzt und das Leben vertrödelt. Wenn er oder sie tatsächlich endlich den Hintern hochbekommt, wird sie/er zum Vīra, und fängt an, durch schiere Hektik, Begierde, Lust und Zorn die Welt zu erobern. In diesem Stadium sind die Kräfte der Trägheit und des Himmlischen noch gleichermaßen stark, und unsere heldenhaften Verehrer werden von den Stürmen des Universums hin und her geworfen. Woran sie meistens selber schuld sind. Erst wenn Held oder Heldin sich weniger wichtig nehmen und das Göttlich in Allem erkennen, was direkt zu Liebe und Mitgefühl führt, tritt Frieden ein, und wir erleben die Divya-Stufe. Und die ist in diesem Modell das Endziel. Soweit ist das Ganze ziemlich simpel. Doch in manchen Tantras sieht die Welt ganz anders aus. Hier haben alle drei Bewusstseinszustände sowohl ihre Bedeutung und Stärken wie ihre Schwächen und Nachteile. In diesen Systemen gilt es, alle drei zu nutzen und zu transzendieren.
Natürlich wirst Du Dich schon gefragt haben, zu welcher Klasse Du gehörst. Das ist ein nützlicher Gedanke, aber auch ein irreführender. Die drei Temperamente sind nicht unbedingt in einer linearen Progression von ignorant über aktiv zu göttlich angeordnet. Stell Dir ein Dreieck vor. Jede der Ecken ist eins der Temperamente; jedes hat seine Stärken und seine Schwächen. Die Temperamente an sich sind keine Rollenmodelle, sondern Extreme. Dein Leben findet im Zwischenraum zwischen den Punkten statt. Denk Dir mindestens zwei Stufen zwischen Paśu und Vīra aus, zwei Stufen zwischen Vīra und Divya, und (hier betreten wir Neuland) zwei Stufen zwischen Divya und Paśu. Du wirst bald bemerken, dass jedes Temperament Vor- und Nachteile hat. Dem Paśu wird ja gerne vorgeworfen, dass er oder sie das halbe Leben mit Videospielen, Soap Operas und in ‚sozialen Netzwerken‘ verplempert. Doch ein Paśu kann beständiger, zuverlässiger und geduldiger in der Praxis sein als beispielsweise ein Vīra, und nebenbei den Dingen der Welt die nötige Aufmerksamkeit schenken. Besonders wenn Paśus an eine Familie gebunden sind, haben sie Verpflichtungen, und diese haben, auf ihrer Ebene und zu ihrer Zeit, eine gewisse Berechtigung. Doch Paśus brauchen manchmal ewig, um in die Gänge zu kommen, und ein Vīra kann Dinge schon fertig haben, während Paśu und Divya noch herumsitzen und darauf warten, dass etwas passiert. Natürlich neigt ein Vīra auch eher dazu, Fehler zu machen; die Nebenerscheinung des Tuns sind immer Missgeschicke, und der Preis für Einmischung ist Bindung. Vīras sind so erregbar und hastig, dass sie oft Dinge beginnen, ohne darüber nachzudenken, was dabei herauskommt. Sie haben auch echte Probleme damit, falsche Ziele und fehlgelaufene Projekte loszulassen, und einfach über sich selbst zu lachen. Divyas können im Vergleich zu ihnen ruhig und heilig sein, haben aber Probleme, normale Menschen zu verstehen. Ein Divya kann dazu neigen, materielle Notwendigkeiten zu vergessen. Divyas brauchen im Allgemeinen oft Hilfe, und sei es nur zum Überleben; nur wenige von ihnen schaffen es, einen ganz normalen Job zu behalten, und Karriere fällt ihnen extra schwer. Auch Geld interessiert sie nicht besonders. Oft schädigen sie ihren Körper, wenn ihre rituelle Ekstase stärker ist als der gesunde Menschenverstand (sie trinken z. B. Ganges-Wasser oder bleiben zu lange in Hitze oder Kälte). Gelegentlich kann ihre Ansicht von ‘Ununterscheidbarkeit’ ihren Körper zerstören oder ihr Hab und Gut aufzehren. Divyas verleihen gerne Geld, das sie nur selten zurück bekommen, und nehmen sich selbst nicht so wichtig, was sie zu leichten Opfern macht. In solchen Fällen können Divyas durchaus von der materiellen Unterstützung durch Paśus abhängig werden.
Mehrere Tantras weisen darauf hin, dass in unseren Tagen und unserem Zeitalter Vīras selten und Divyas noch viel seltener sind. Sie finden es schwer, in einer Welt zu existieren, die von materialistischen Idioten, Kriegstreibern, Profiteuren und Ausbeutern der Unschuldigen beherrscht wird. Mach jetzt eine Pause und stell Dir Dich selbst als alle drei Charaktere vor. Hier geht es nicht darum, Dich möglichst schnell in einen abgehobenen Heiligen zu verwandelt. Viel wichtiger ist geistige Flexibilität. Genau jetzt hast Du eine wundervolle Gelegenheit zu lernen, drei wirklich nützliche Rollen zu spielen. Wer oder was bist Du, wenn Du als Paśu, Vīra und Divya handelst? Wie gibt’s Du Dich, wie verhältst Du Dich, wie sind Deine Atmung, Deine Tonlage, Dein Energietonus, und welche Gefühle hast Du dabei? Zu welchen Zeiten spielst Du diese Rollen? Bei welchen Gelegenheiten? In welcher Gesellschaft? Welche Maske ist am nützlichsten für welche Aktivitäten? Wer bringt Dich dazu, pünktlich zur Arbeit oder nachts in den Wald zu gehen? Wer ist nützlich, um Verpflichtungen einzuhalten, und wer, um sie zu verlachen und loszulassen? Wer gibt sich hin, und wer schafft es, klare Grenzen zu ziehen? Wann wechselst Du von einem Bewusstsein ins andere? Woran bemerkst Du den Moment der Veränderung? Was würde Dir der Wechsel in eine andere Rolle bringen? Wie schnell kannst Du von einem Bewusstsein zum anderen schalten? Und was tut Dir jetzt wohl? Viel Spaß dabei.