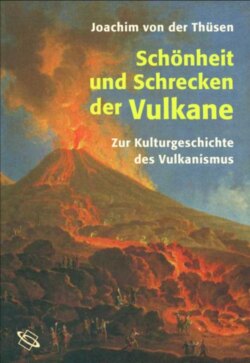Читать книгу Schönheit und Schrecken der Vulkane - Joachim von der Thüsen - Страница 12
Die weise Einrichtung der Schöpfung
ОглавлениеEs ist eine der erstaunlichsten Entwicklungen in der Geschichte des religiösen Denkens, dass in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in England eine Theologie auf den Plan tritt – und nach 1700 rasch den Kontinent erobert –, die radikal mit der jahrhundertelang gültigen Naturauffassung des Christentums bricht. Während nach der traditionellen augustinischen Lehre jede Form von glückhafter Beziehung des Menschen zur Natur als sündige Verfehlung angesehen wird, da die äußere Natur den Menschen von seiner wahren Bestimmung abziehe, lädt nach der neuen Lehre der Physikotheologie die Natur gerade zum Studium und zur freudigen Versenkung in ihre Schönheit ein. Gott offenbart sich in der Majestät seiner Schöpfung, die nach einem gütigen und weisen Plan eingerichtet ist. Damit kommt der sinnlich-wahrnehmenden Beziehung des Menschen zu seiner Umgebung ein neuer Wert zu. Für den Menschen entsteht nun geradezu der Auftrag, dem „wise design to admirable ends“66 überall nachzugehen und den Schöpfungsplan in Naturbeschreibung und Experiment aufzudecken.
Man hat die Physikotheologie als Antwort auf die cartesianische Philosophie gesehen, in deren sich selbst genügender Weltmechanik ein persönlicher Gott keinen Platz mehr hatte.67 Diese Deutung, die der Physikotheologie eine apologetische Rolle zuweist, ist gewiss nicht falsch; der überall in ihren Schriften zu findende Angriff auf die „Atheisten“, die die Natur nur noch aus deren eigener Gesetzlichkeit heraus zu erklären versuchen, spricht eine deutliche Sprache. Doch ist dies nur ein Aspekt dessen, was umfassender benannt werden kann: als das Projekt der Vergleichzeitigung von Wissenschaft und Theologie. Mit ihrer Deutung der Natur als heilsfremd hatte die alte Theologie die Naturerkundung geradezu verboten. Astronomie, Physik und Chemie gehörten zu den Unternehmungen, die abseits der religiösen Lehre einer eigenen Methodik und Dynamik folgten. Indem die Physikotheologie die wissenschaftliche Erkundung der Natur als Gottes Auftrag für den Menschen deutete, versuchte sie, das preisgegebene Terrain in die – neu gefasste – Beziehung zwischen Gott und Mensch hereinzuholen.
Zugleich gelang es ihr, die Schrecken zu mindern, die von der neuen Astronomie ausgegangen waren. Durch die Entdeckung, dass der Kosmos unendlich sei und möglicherweise ungezählte Sonnensysteme umfasse, war der alten Zentralstellung des Menschen in der Schöpfung der Boden entzogen worden. Der Mensch war von einem Gefühl der Verlorenheit im All überfallen worden, ausgedrückt in dem berühmten Wort Pascals: „Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume schreckt mich.“68 Die Physikotheologie zeigte nun, wie die Schöpfung auch in ihrer Unermesslichkeit noch auf den Menschen bezogen war. Im Zentrum des Weltganzen stand noch immer das vollkommenste Wesen der Schöpfung. Gerade durch dessen Bewunderung und Erkenntnisfreude sollten sich Schönheit und Zweckmäßigkeit der Schöpfung enthüllen. So würde sich dieses Wesen zugleich bewusst werden, dass es von einer gütigen Vorsehung getragen sei.
Wenn in der Natur nichts ohne wohltätigen Zweck geschah, so hieß das, dass auch ein so furchtbares Geschehen wie der Vulkanausbruch noch einer weisen Absicht unterliegen musste. Eine Reihe von nützlichen Wirkungen der Vulkane lag auf der Hand; die alten Texte hatten auf sie aufmerksam gemacht, und die Italienführer des 17. und frühen 18. Jahrhunderts memorierten sie im Blick auf den Vesuv erneut.69 Dazu gehörte die Fruchtbarkeit der Vulkanasche, an die nun auch die Physikotheologen erinnerten. Eine zusätzliche Wirkung schrieb man der Erwärmung des Erdbodens am Fuß oder an den Hängen von Vulkanen zu. Auf sie hatte bereits Athanasius Kircher hingewiesen, als er die Qualität des am Vesuv wachsenden Weins auf die Erdwärme zurückführte. Klassischen Texten war zu entnehmen, dass die Schiffsführer sich seit jeher an dem in kurzen Abständen aufflammenden Inselvulkan Strongylus (Stromboli) orientiert hatten. Daraus wurde nun geschlossen, dass Gott die Vulkane als Leuchttürme für eine unbeschwert reisende und handeltreibende Menschheit geschaffen hatte.70 In einer solchen Argumentation verriet sich zugleich die Zwanghaftigkeit der Physikotheologie, dem Schöpfungsplan überall Nutzen abzugewinnen und selbst noch das historisch Zufällige des Menschenlebens ans Naturgesetzliche zu koppeln.71
Auch die kulturgeschichtlich ehrwürdige Auffassung vom Doppelcharakter des Feuers, das sowohl vernichten wie läutern und reinigen kann, wurde herangezogen: In Vulkangebieten komme es zu einer wohltätigen Purifizierung der Luft. Die Miasmen verschwänden aus der Atemluft, wenn ein Vulkan sein Feuer „angezündet“ habe. Noch Diderot sollte sich diese Ansicht zu eigen machen und damit der gängigen Meinung folgen, dass die Aktivität eines Vulkans als reiner Feuerbrand anzusehen sei.72
Nicht allen Physikotheologen freilich schienen diese Vorzüge wirklich ausreichend, um auch bei den Vulkanen noch von einer gütigen Einrichtung der Welt zu sprechen. Zu furchtbar waren die Erkenntnisse, die das vorhandene Schrifttum von den großen Eruptionen des Vesuv (1631) und des Ätna (1669), aber auch von Vulkanausbrüchen in Mittelamerika und Ostindien enthielt. So zogen sich bekannte Physikotheologen wie Friedrich Christian Lesser und Bernard Nieuwentijt denn auch auf eine etwas unentschiedene Position zurück.73 Nieuwentijt beschrieb – nach einem langen Referat der Verwüstungen historischer Vulkanausbrüche –, wie das Feuer durch „den großen und mächtigen Bewahrer daran gehindert“ werde, in alle Richtungen „auszubrechen“ und damit „alles zu vernichten“.74 Der Gewalt des erdinneren Feuers, die Nieuwentijt analog zur Sprengkraft von Pulvermagazinen deutete, sei durch die Vulkanschlote eine Richtung aufgezwungen worden. Für Lesser erwies sich die Güte des Schöpfers lediglich daran, dass Gott die Eruptionsgefahr auf wenige Orte der Erde beschränkt habe. Denn seine Macht habe Gott auch auf eine furchtbarere Weise zeigen können, indem er der Menschheit nirgendwo Schutz vor Vulkanen geboten hätte.75
Was diesen Physikotheologen blieb, war wenig mehr als die traditionell-christliche Auffassung, wonach die Feuerberge den Menschen strafen oder ans Ende der Zeiten mahnen und damit zur Besinnung auf einen gottgefälligen Lebenswandel auffordern.76 Zwar kehrte hiermit das Bild eines furchtbaren und züchtigenden Gottes nicht in seiner ganzen Gewalt zurück, es war aber nicht wirklich außer Kraft gesetzt. Das Problem lag in der eigenartigen Trias „Allmacht, Weisheit und Güte Gottes“ und damit in der Spannung zwischen Gottzentrierung und Menschenzentrierung im physikotheologischen Begriff der Schöpfung. Es war deutlich, dass sich an den Vulkanen Gottes Allmacht auf exemplarische Weise bewies, doch seine gütige und weise Vorsehung war hier nicht für alle ebenso offenkundig.
Anders dagegen die Physikotheologen, die der Argumentation des einflussreichen Werks Physico-Theology von William Derham folgten. Der züchtigende Gott trat für sie zurück hinter dem milden Bewahrer des Lebens. Exemplarisch ist die folgende Passage aus Derhams Werk, das 1713 erschien und 1730 ins Deutsche übersetzt wurde:
Wir wollen zum Exempel das allerärgste nehmen, von allen obbenannten Sachen, nemlich die unterirdischen feurigen Hölen, und Feuerspeyenden Berge. Wiewohl diese erschrecklich die Erde erschüttern, und abscheuliche Zucht-Ruthen in der Hand Gottes sind für die Sünden-vollen Menschen, die auf der Erden wohnen, und können denselben gar wohl dienen zu einem Sinnbilde und Vorstellung der Hölle: Doch haben sie eben auch ihren vielfältigen und großen Nutzen: Indem sie gleichsam Lufft-Löcher und Feuer-Mauren abgeben müssen in den Ländern, worinnen sie gelegen, vor das Feuer und die Dünste, so sonsten eine schreckliche Verwüstung anrichten würden, wie es denn auch öffters würcklich geschiehet, durch grausame Erschütterung und entsetzliche Erdbeben. Ja: wenn die Meynung von dem Feuer und Wasser mitten in der Erden ihre Richtigkeit hat, so scheinet es, dass diese Öffnungen und Ausgänge höchst nützlich seyn, die Erd-Kugel in Ruhe und Friede zu erhalten: Indem die unterirdische Hitze und Ausdünstungen dadurch Lufft kriegen, die sonsten, wenn sie eingesperret bleiben, gewiss auf der Erde und im Wasser allerhand erschreckliche und gefährliche Bewegungen verursachen würden. Dahero haben wir solche billig vor eine sonderbahre Güte und Gnade der Göttlichen Vorsehung zu achten […]77
Dass das Erdinnere Hohlräume enthält und dass in diesen Winde toben, ist eine alte Vorstellung. Archelaos scheint sie zuerst vorgetragen zu haben.78 Von Aristoteles in seiner Meteorologie festgeschrieben und von Seneca ausführlich erörtert, wird sie zur gängigsten Erklärung für die Unruhe der Erdoberfläche.79 Dass Erdbebenzonen oft mit Vulkanregionen zusammenfallen und dass Vulkanausbrüche von Erdbeben angekündigt und von Tremor-Erscheinungen begleitet werden, war im Mittelmeerraum früh bekannt. Naheliegend war denn auch, dass sie eine gemeinsame Ursache haben müssten. Dabei entstand die Erklärungsschwierigkeit, dass die Winde im Inneren der Erde nicht nur Druck ausüben, sondern auch Hitze produzieren oder transportieren mussten. Der anonyme Verfasser des Vergil zugeschriebenen Gedichts Aetna gab dafür die Erklärung, dass die Winde im Erdinneren an brennbaren Materialien vorbeistreichen. Nach dieser Deutung entsteht Feuer in der Erde, das von den Winden an die Oberfläche mitgerissen wird und dort als vulkanischer Brand erscheint. Zu den entzündlichen Stoffen, von denen die Erde große Lager enthalte, werden im Ätna-Gedicht Schwefel, Alaun und Bitumen gerechnet.80 Diese Ansicht von der gemeinsamen Ursache von Erdbeben und Vulkanen hielt sich bis in die Neuzeit, wobei lediglich die Art der Winde – waren es von außen eintretende Luftströme oder im Inneren entstehende Dämpfe? – und die Reihe der brennbaren Materialien variiert wurden. So fügte Georg Agricola im 16. Jahrhundert den entflammbaren Stoffen Schwefel und Bitumen die Kohle als Ursache von Erdbränden hinzu.81
Die Erklärungstradition der Selbstentzündung brennbaren Materials erhält um das Jahr 1700 ihre empirische Unterstützung, als dem französischen Arzt und Apotheker Nicolas Lémery ein „unterirdisches“ Experiment gelingt. Einem in die Erde eingegrabenen Gemisch von Eisenfeilspänen und Schwefelpulver setzt er Wasser zu:
[Die Masse] lässt man ohne Feuer zwei bis drei Stunden arbeiten. Das Gemisch beginnt dann zu gären und sich mit erheblicher Wärme auszudehnen; diese Gärung lässt die Masse an verschiedenen Stellen aufreißen, und es entstehen Spalten, aus denen Dämpfe austreten. Bei einer geringeren Menge der Substanz sind diese Dämpfe lediglich warm, aber wenn sie aus einer großen Masse von dreißig bis vierzig Pfund kommen, entzünden sie sich. […] Dieses eine Experiment scheint mir gänzlich ausreichend zur Erklärung der Weise, wie Gärungen, Erschütterungen und Brände in den Eingeweiden der Erde erregt werden, wie dies im Vesuv, im Ätna und an anderen Orten geschieht: Denn wenn Eisen und Schwefel aufeinandertreffen und sich eng verbinden und ineinander eindringen, muss eine heftige Gärung in Gang gesetzt werden, welche wie in unserer Unternehmung Feuer erzeugen wird.82
Damit hatte die Auffassung von der gemeinsamen Ursache von Erdbeben und Vulkan nun auch ihren experimentellen Segen. Den wissenschaftlich belesenen Physikotheologen war „der Vulkan von Lémery“ höchst willkommen.
Die, gemessen an den erschreckenden Opferzahlen bei Erdbeben, meist geringere Zahl der Toten bei Vulkanausbrüchen – neben den weit über dreißigtausend Toten des Erdbebens von Lissabon 1755 konnten die etwa viertausend Opfer des Vesuvausbruchs 1631 schon fast als gnädige Bewahrung erscheinen83 – ist den Physikotheologen, die über die Katastrophen des Zeitalters gut informiert sind, der Beweis für die schützende Hand Gottes: Die göttliche Vorsehung hat dem Menschengeschlecht Vulkane gegeben, welche den gefährlichen Druck des Erdinneren entweichen lassen.84 In die Bildlichkeit dieses Mechanismus geht nicht nur die ältere Erfahrung von Unglücken mit Pulvermagazinen ein, sondern auch die neue Vorstellung von dem Druck, der in Dampfmaschinen erzeugt wird und der unter bestimmten Umständen, wenn eine Ventilentlastung fehlt, zur Explosion führt.
Als Lissabon am 1. November 1755 von dem verheerenden, das Jahrhundert in Atem haltenden Erdbeben heimgesucht wird, erheben sich viele Stimmen, die auf die Vulkanferne Portugals hinweisen (Abb. 9). Ein Vulkan in der Nähe Lissabons hätte die schlimmsten Verwüstungen verhindern können. Nun war zwar die Vulkanferne Lissabons gar nicht erwiesen, und tatsächlich entdeckte Dolomieu 1778 gerade hier Spuren eines alten Vulkanismus, doch damit hätte er die herrschende Meinung zwei Jahrzehnte zuvor wohl kaum umgestimmt – denn hatte dieser Vulkan nicht gerade seine „Brennstoffe verzehrt“, so dass er den Bewohnern nicht mehr zu Hilfe kommen konnte?85
Um 1755 herrscht freilich die physikotheologische Naturdeutung nicht mehr unangefochten, und wer zu dieser Zeit sagt, dass ein Vulkan die Gewalt eines Erdbebens verringern kann, meint damit oft schon einen Ausgleich der Kräfte, der der Natur inhärent ist. Die Physikotheologie beginnt insbesondere auf dem europäischen Kontinent einer deistischen Sicht Platz zu machen, die die Grundthese von einer sinnvollen, auf den Menschen bezogenen Schöpfung übernimmt, dies aber nun einem allgemeinen Prinzip der Vorsehung in der Natur selbst zuschreibt. In der Natur geschieht nichts ohne Zweck.86
Abb. 9: „Das Erdbeben zu Lissabon“, zeitgenössischer Kupferstich
Aus der Flut der europäischen Reaktionen auf das Erdbeben von Lissabon ragen die drei Schriften Kants aus dem Jahr 1756 heraus. Kant begibt sich nur noch am Rande auf eine Suche nach dem metaphysischen Sinn der Naturkatastrophe; seine Hauptaufgabe betrachtet er als die des Naturphilosophen: Bedingungen, Gründe und Verlaufsformen des Ereignisses zu untersuchen, um an ihnen Grundsätzliches über die Wirkungen der Natur darzulegen. Kant erinnert an Lémerys Experimente und daran, dass es „einem Naturforscher etwas Leichtes [sei,] ihre Erscheinungen nachzuahmen“. Bei dem Lémery’schen Versuch sehe man „nach Ablauf einiger Stunden […] einen dicken Dampf aufsteigen, die Erde wird erschüttert, und es brechen Flammen aus dem Grunde hervor“. Man könne nicht bezweifeln, dass Eisen und Schwefel „in dem Innern der Erde häufig angetroffen“ würden und dass sie durch „das Wasser, das sich durch Spalten und Felsenritzen durchseigert, in Gärung“ gebracht werden könnten. Hieraus schließt Kant auf die Verbindung von Vulkan und Erdbeben, und im Anschluss an Derham und Lulofs87 trägt er seine Überzeugung von der Wohltat der Vulkane vor:
Man hat längst wahrgenommen, daß ein Land von seinen heftigen Erschütterungen befreit worden, wenn in seiner Nachbarschaft ein feuerspeiender Berg ausgebrochen, durch welchen die verschlossenen Dämpfe einen Ausgang gewinnen können, und man weiß, daß um Neapolis die Erdbeben weit häufiger und fürchterlicher sind, wenn der Vesuv eine lange Zeit ruhig gewesen. Auf diese Weise dient uns öftermals das, was uns in Schrecken setzt, zur Wohltat, und ein feuerspeiender Berg, der sich in den Gebirgen von Portugal eröffnen würde, könnte ein Vorbote werden, daß das Unglück nach und nach sich entfernte.88
Waren Kants Erdbebenschriften an entlegener Stelle erschienen,89 so galt dies nicht für den Artikel „Volcans“ in der französischen Encyclopédie, dessen ersten Teil Baron d’Holbach verfasst hatte. In dem Artikel findet sich die gleiche positive Deutung des Vulkans als Ventil für das entzündliche Gemisch im Erdinneren:
Die Vulkane müssen als die Luftlöcher der Erde oder als Kamine betrachtet werden, durch welche die Erde sich der brennenden Stoffe entledigt, die ihren Leib verzehren. […] Ansonsten würden diese Kräfte auf unserem Erdrund viel schrecklichere Umwälzungen hervorbringen als die, die wir bei den Erdbeben am Werk sehen.90
Die Verfasserschaft des Beitrags zeigt, dass die These von der schützenden Funktion des Vulkans nun vollends ins Reich einer sich selbst regulierenden Natur übergegangen ist. Holbach, der Übersetzer deutscher geologischer Schriften und der Verfasser des Système de la Nature, macht keine Zugeständnisse mehr an eine planende und eingreifende göttliche Hand.
Am Ende des Jahrhunderts wird die Funktion des Vulkans als „Luftloch des unterirdischen Brennofens“ eine wichtige Stelle in James Huttons – noch einmal deistisch ausgerichteter – geologischer Theorie einnehmen.91 Hier freilich erhalten, wie noch zu zeigen ist, die Wärme im Erdinneren und das Aufschmelzen von Gesteinen eine weit zentralere Bedeutung für die Erdgeschichte, als dies in den sich ausschließlich an Einzelkatastrophen orientierenden Vorstellungen von der Wohltat der Vulkane bis dahin der Fall war.
Hatten die Physikotheologen die Deutung der Feuerberge als Geißel der sündigen Menschheit noch nicht aufgegeben, so verschwand dieser moralisch-metaphysische Aspekt in der deistischen Erklärung der Vulkane vollständig. Vulkane waren nicht zur Bekehrung der Menschheit da. Erst damit waren die Feuerberge zur eindeutig segensreichen Einrichtung der Natur geworden. Was Physikotheologen und Deisten in ihrer Theorie der Druckentlastung des Erdinneren allerdings verband, war die Tatsache, dass beide das Problem des Katastrophisch-Unbegreiflichen verschoben hatten. Wenn die Vulkane ein Beweis für das Prinzip der menschenfreundlichen Vorsehung in der Natur waren, welche Rolle kam dann den Erdbeben zu? Offensichtlich gab es nicht überall auf der Erde Vulkane, die die ungeheure Kraft im Inneren der Erde abführten, und weil dies so war, wurde die erdinnere Gewalt zum eigentlichen Affront des Vorsehungsgedankens. Als Verursacherin der Erdbeben sorgte die erdinnere Kraft für ein primäres Gefühl der Ungeborgenheit – denn wenn der Boden schwankte und sogar aufriss, verlor alles Leben seinen sicheren Grund. Hinzu kam die geografische Unbestimmtheit: Erdbeben konnten anscheinend überall auftreten. Nicht nur waren die großen Erdbebenkatastrophen noch in erstaunlicher Ferne zu spüren – das Lissaboner Erdbeben ließ in London die Glocken anschlagen –, auch eine Zuordnung erhöhter Erdbebenwahrscheinlichkeit zu bestimmten Regionen war im 18. Jahrhundert nur begrenzt möglich. Denn wenn, wie in Chroniken zu lesen war, in Basel im Jahre 1356 viele Häuser und Kirchen eingestürzt waren (Abb. 10) und wenn auch Mittelengland 1750 von einem größeren Erdbeben heimgesucht worden war, bestätigte sich, dass gerade die vulkanfernen Orte Schlimmes zu befürchten hatten.92 Vulkane dagegen hatten einen unverrückbaren und gleichsam zugewiesenen Ort, der – nach herrschender Auffassung – nur in der Grenzzone von Land und Meer liegen konnte.
Abb. 10: „Das Erdbeben zu Basel“, Holzschnitt des 16. Jahrhunderts
Die Ermächtigung des Menschen gegenüber der Naturgewalt, die durch die Funktionsbestimmung und topografische Eingrenzung des Vulkanischen erreichbar geworden schien: Hier war sie dem Menschen wieder genommen. Die Energie im Innern der Erde war das eigentlich Unbekannte und Widerständige, das den Gedanken des Gleichgewichts in der Schöpfung bedrohte.