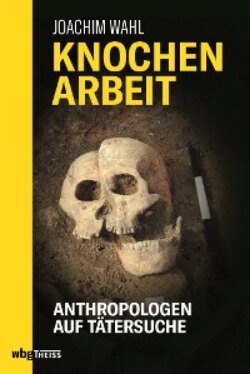Читать книгу Knochenarbeit - Joachim Wahl - Страница 9
3 Krapina und Kebara – Kannibalismus bei Homo neanderthalensis und überhaupt
ОглавлениеNach seiner Entdeckung 1857 musste der Neandertaler noch mehrere Jahrzehnte um seine Anerkennung als eigenständiger Hominide kämpfen. Dank intensiver Forschung ist er inzwischen aber längst kein unbekanntes Wesen aus grauer Vorzeit mehr, sondern dem modernen Menschen insofern immer ähnlicher geworden, als zunehmend mehr Gemeinsamkeiten zutage treten. Das ist im Grunde auch nicht verwunderlich, denn beide stammen aus Afrika und gehen auf einen gemeinsamen Ahnen, den Homo heidelbergensis, zurück. Vor 300.000 bis 400.000 Jahren verließen seine Vorfahren den schwarzen Kontinent und spalteten sich in zwei Gruppen auf, von denen eine sich in Europa und Westasien zum Neandertaler und die andere östlich davon zum Denisova-Menschen entwickelte. Aus den in Afrika verbliebenen Vormenschen war mittlerweile Homo sapiens entstanden, der sich einige Zeit später auf den Weg machte und – nach bisheriger Lehrmeinung – vor ca. 40.000 Jahren in Europa auf seinen bereits dort ansässigen Vetter stieß und diesen binnen zehntausend Jahren von der Bildfläche verdrängte. Doch die paläogenetische Analyse eines unscheinbaren Teilstücks eines Neandertaler-Oberschenkelknochens aus der Stadelhöhle des Hohlensteins im Lonetal lieferte 2017 einen neuen, unerwarteten Aspekt des Verhältnisses zwischen beiden Spezies. Vertreter des modernen Menschen mussten demnach viel früher – vor 250.000 bis 300.000 Jahren – schon einmal europäischen Boden betreten, Kontakt zu Neandertalern gehabt und Spuren in deren Erbgut hinterlassen haben. So oder so, alle Nichtafrikaner sind Nachfahren der Vermischung von Homo neanderthalensis und Homo sapiens und Europäer wie Asiaten tragen noch heute ein paar Prozent Neandertaler-Gene in sich.
Zu dem, was wir aktuell über den Neandertaler wissen, haben Anthropologen und Archäologen in gleichem Maße und in jüngster Zeit vor allem Isotopen- und DNA-Analysen beigetragen. Demnach waren sie eher hellhäutig, zu einem gewissen Prozentsatz rothaarig und damit einhergehend wohl auch sommersprossig. Das auf Chromosom 16 gelegene, bisweilen auch als Ginger-Gen bezeichnete, die Pigmentierung steuernde MC1R-Gen soll nebenbei noch Einfluss auf das Schmerzempfinden haben. Neandertaler waren körperlich früher reif als Homo sapiens und zumeist Rechtshänder. Männer und Frauen gingen unterschiedlichen Tätigkeiten nach. Ihre Gruppenstrukturen waren patrilokal orientiert. Sie betrieben Krankenpflege, bestatteten ihre Toten, vermochten Birkenpech herzustellen, benutzten Zahnstocher und konnten Bitteres schmecken. Auf ihrem Speiseplan standen vor allem Mammut, Rhinozeros und Pferd, aber auch Hirsch, Wisent und Auerochse, Kleintiere wie Hasen, Kaninchen und Federwild, manchmal Rentier und bisweilen auch Fisch und andere Meeresfrüchte sowie ab und zu Mensch. Je nachdem, was ihr Habitat ihnen bot, waren einige Gruppen – wie etwa jene im spanischen El Sidrón – offenbar auch vegetarisch unterwegs.
Krapina. Eine Gruppe von Neandertalern bei einer Kannibalen-Mahlzeit. Illustration des bekannten tschechischen Künstlers Zdeněk Burian aus dem Jahr 1952.
Ob Neandertaler überhaupt zu einer artikulierten Sprache fähig waren, war in Fachkreisen lange umstritten. Doch in Anbetracht der Tatsache, dass die Jagd auf Großtiere ohne Planung und Abstimmung, die Suche nach bestimmten Rohmaterialien und die Weitergabe ausgeklügelter Herstellungstechniken ohne sprachliche Kommunikation kaum möglich sind, hätte das schwerlich in Zweifel gezogen werden können. Mit dem Fund eines Zungenbeins in Kebara und letztlich durch den Nachweis des FOXP2-Gens war diese Diskussion vom Tisch.
Die Neandertaler hatten zehntausend Generationen Zeit, sich an die Umweltbedingungen im Norden anzupassen. Einer Studie aus dem Jahr 2016 zufolge scheinen aus deren Erbgut stammende, für den modernen Menschen zunächst positive Eigenschaften für uns heute eher negative Auswirkungen zu haben: verstärkte Blutgerinnung (erhöhtes Infarktrisiko), Überstehen von Hungerphasen (erhöhtes Diabetes-Risiko), optimiertes Immunsystem (erhöhte Allergieanfälligkeit). Als einer der letzten Unterschiede zwischen Homo neanderthalensis und Homo sapiens steht im Raum, dass Neandertaler nicht eigenständig künstlerisch tätig gewesen sein sollen. Angesichts von Felsgravuren, Handabdrücken sowie zugerichteten Muscheln aus spanischen Fundplätzen und Adler-Krallenbeinen aus Kroatien, die als schmückende Accessoires angesprochen werden, gerät allerdings auch diese Einschätzung inzwischen ins Wanken.
Im Hinblick auf die Frage, ob unsere ausgestorbenen Vettern Kannibalen waren, kommt üblicherweise als Erstes der rund 45 km nördlich von Zagreb gelegene Fundort Krapina ins Spiel. Dort waren zwischen 1899 und 1905 neben mehreren Hundert Steinartefakten und Tierknochen – darunter Höhlenbär, Vielfraß und Höhlenhyäne –, fast 900 Knochenbruchstücke und etwa 200 Zähne von mindestens 23 Neandertalern gefunden worden, die auf ein Alter von um 130.000 Jahren datiert werden. Die Skelettreste waren unter dem mehrere Meter starken Deckenversturz eines ehemaligen Felsüberhangs auf neun Schichten mit einer Gesamtmächtigkeit von elf Metern verteilt angetroffen worden. Sie decken das gesamte Altersspektrum vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen ab und wurden aufgrund ihrer starken Fragmentierung, charakteristischer Bruchmuster sowie vereinzelter Schnitt- und Brandspuren zunächst als Speiseabfall eingestuft: Das Ganze folglich als Bestattungsplatz, an dem ritueller Kannibalismus praktiziert worden sei. Detaillierte Nachuntersuchungen haben inzwischen jedoch ergeben, dass der überwiegende Teil der vorliegenden Defekte auf Aasfresser, den Einsturz der Höhlendecke, Grabungsbeschädigungen oder grobe Reinigungsmaßnahmen zurückgeführt werden kann. Um das kompakte Sediment zu lösen, waren bei der Ausgrabung seinerzeit sogar Sprengungen durchgeführt worden. Lediglich an einem Stirnbein (Krapina 3) sind eng beieinanderliegende Scharen kurzer, nur ein bis zwei Zentimeter langer Schnittspuren festzustellen, die auf eine zeitgenössische Sonderbehandlung dieses Stücks schließen lassen.
Ebenfalls eine spezielle Prozedur hatte offensichtlich das Skelett des bereits erwähnten, etwa 30-jährigen Neandertalers erfahren, der vor rund 60.000 Jahren in der Kebara-Höhle in Israel bestattet worden war. Während sein Unterkiefer und die übrigen Skelettelemente bei der Ausgrabung noch in korrekter anatomischer Lage vorgefunden wurden, fehlten ihm das Kalvarium, das rechte Bein und der linke Fuß. Dass der Oberschädel einst vorhanden war, bezeugt der rechte obere Weisheitszahn, der isoliert überliefert ist. Da an den verbliebenen Knochen keinerlei Anzeichen von Manipulation festgestellt wurden, bleiben hinsichtlich der vermissten Körperteile nur zwei Szenarien übrig: Sie könnten für rituelle Zwecke gezielt aus dem Grab entnommen oder von Aasfressern verschleppt worden sein. Auch wenn Krapina seine Sonderstellung als Kannibalen-Hochburg mittlerweile eingebüßt hat, stehen noch einige andere Neandertaler-Fundstellen zur Debatte, die aufgrund der Spurenlage mit dem Verspeisen von Zeitgenossen in Verbindung gebracht werden, so Combe-Grenal, Marillac und Moula-Guercy in Frankreich, El Sidrón und Zafarraya in Spanien oder Goyet in Belgien, wo zudem vier Knochenteile noch als Gerätschaften zur Herstellung von Steinwerkzeugen Verwendung gefunden hatten. Für den modernen Menschen des Jungpaläolithikums stehen diesbezüglich beispielsweise die Brillenhöhle in Deutschland oder Gough’s Cave in England in der Diskussion.
Als typische Indizien für Anthropophagie werden in der Fachliteratur rund ein Dutzend Phänomene an Menschenknochen beschrieben, wobei solche Erscheinungen als besonders aussagekräftig gelten, die mit den an den Tierknochen festgestellten Spuren identisch sind. Dazu gehören Schnitt-, Hack-, Kratz- und Abriebspuren in bestimmten anatomischen Regionen (Zerlegen des Schlachtkörpers, Entfleischen), spezifische Bruchmuster, zerschlagene Wirbel und Langknochen, Brandspuren und Ähnliches (Gewinnung von Fett und Knochenmark, Kochen/Braten), eröffnete Schädelbasen (Hirnentnahme) sowie die identische Behandlung (Verteilung, Deponierung) des Speiseabfalls. Ein untrügliches Zeugnis seien menschliche Kauspuren oder Zahnabdrücke, die jedoch nur schwer von Bissmarken anderer Fleischfresser oder Omnivoren zu unterscheiden sind. Manche Autoren sehen sie in charakteristischer Form als seichte Impressionen oder linear und quer zur Längsachse verlaufende Furchen auf der Knochenoberfläche oder sogenannte double arch punctures an Knochenenden. Spuren von Skalpieren, Ausbrüche, die mit der Herstellung von Schädelschalen einhergehen, oder andere Manipulationen sind im Kontext von Kannibalismus möglich, können aber auch gänzlich ohne diesen Aspekt auftreten.
Für den Verzehr von Zeitgenossen werden sehr unterschiedliche Beweggründe diskutiert. Neben der aus der Ethnografie entlehnten allgemeinen Unterscheidung zwischen Endo- und Exokannibalismus – Verspeisen von Mitgliedern der eigenen oder fremder Gruppen – sowie dem Bestreben, sich die Kraft oder die Fähigkeiten des Verstorbenen einzuverleiben, erscheint bei der Beurteilung prähistorischer Fundkomplexe in neueren Arbeiten eine Klassifizierung in drei Kategorien plausibler: 1. Kannibalismus, um zu überleben (Notkannibalismus); 2. Vernichtung, Entmenschlichung, Demütigung eines besiegten Feindes (Aggressions-Kannibalismus) und 3. Kannibalismus als zeremonielle Handlung im Rahmen eines Trauer- oder Begräbnisrituals, möglicherweise im Zusammenhang mit Sekundärbestattungspraktiken. Rein kulinarische Aspekte dürften dabei nur in den seltensten Fällen eine Rolle gespielt haben.
Aber wie sieht es überhaupt mit dem Nährwert eines menschlichen Körpers aus? Eine erste Schätzung dazu wurde 1970 in der Zeitschrift „American Anthropologist“ publiziert. Ausgehend von einem Körpergewicht von 50 kg kalkulierten die Autoren mit 30 kg verfügbarer Muskelmasse, die bei einem Proteingehalt von 4,5 kg rund 18.000 Kalorien (kcal) liefern. Ebenfalls verwertbare Bestandteile wie Hirn, Leber, Nieren, Herz, Blut, subkutanes Fettgewebe und Knochenmark flossen in deren Berechnung nicht ein. Im Rahmen einer Modellrechnung zum spätbandkeramischen Grabenwerk von Herxheim ergaben sich 2012 unter der Annahme einer Ausschlachtung von 55 Prozent und Einbeziehung dieser Komponenten für einen 60 kg schweren Erwachsenen ein Energiewert von etwa 114.000 kcal, für einen Jugendlichen 90.000 kcal und für ein sechs- bis siebenjähriges Kind 38.000 kcal. Nach der im Frühjahr 2017 von James Cole von der University of Brighton veröffentlichten Erhebung resultiert ein Summenwert von ca. 126.000 Kalorien, wobei hier in Anlehnung an ethnografische Daten auch die Haut und die Genitalien einkalkuliert wurden. Allein auf die Masse der Skelettmuskulatur bezogen, steuerten in seinem Ansatz rund 25 kg knapp 20.000 Kalorien bei. Insofern differieren die aus den genannten Studien vorliegenden Daten größenordnungsmäßig nur wenig.
Größere Beutetiere wie Mammut, Wollnashorn oder Steppenbison lieferten zweifellos ein Vielfaches, aber die Jagd auf sie war deutlich aufwändiger und wohl auch riskanter. Trotzdem stellten die Neandertaler und frühen anatomisch modernen Menschen auch sehr viel kleineren Tieren nach. Sie dürften ihre Zeitgenossen im Rahmen dieses Spektrums also kaum unter ernährungsphysiologischen Gründen ausgewählt oder gezielt erlegt, sondern eher dann zugegriffen haben, wenn sich etwa beim Tod eines Angehörigen die Gelegenheit ergab. Wie lange eine Sippe von einem menschlichen Körper zehren konnte, hing von ihrer Größe und Zusammensetzung ab. Man kann aber davon ausgehen, dass diese Ressource nicht die einzige Nahrungsgrundlage darstellte. Zudem steht die Frage im Raum, ob und in welchem Maße der Energiebedarf eines Neandertalers größer war als der eines Homo sapiens?