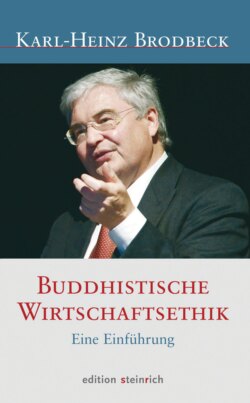Читать книгу Buddhistische Wirtschaftsethik - Karl-Heinz Brodbeck - Страница 18
Die Erklärung des Leidens
ОглавлениеWarum gibt es überhaupt Leiden? Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir zunächst den Begriff klären. Etwas »erleiden« heißt ganz allgemein: abhängig sein von etwas anderem. Zur bloßen Abhängigkeit kommt die Erfahrung dieser Abhängigkeit hinzu. Menschen und Tiere leiden nicht nur, weil sie faktisch abhängig sind von anderen Dingen, die sie letztlich nicht kontrollieren können (wie die Lebensfunktionen des eigenen Körpers im Sterbeprozess), sie leiden, weil diese Abhängigkeit auch ein Gefühl enthält. Die Abhängigkeit von Nahrung, der Zuneigung anderer, der Umgebung usw. wird körperlich empfunden und gefühlt, selbst bloße Gedanken lösen Gefühle aus. Das Leiden ist deshalb auch die sinnliche, körperliche Erfahrung jenes Grundsatzes der buddhistischen Philosophie, dass alle Phänomene gegenseitig abhängig sind (pratītyasamutpāda). Die Erfahrung des Leidens ermöglicht also unmittelbar einen Zugang zur Erkenntnis gegenseitiger Abhängigkeit, damit letztlich der Leerheit.
Dies war auch der Weg des Buddha. Der Buddha war überwältigt von der Erfahrung des Leidens, das ihm besonders deutlich vor Augen trat, weil sein Vater in seiner Jugend alles tat, diese Erfahrung von ihm fernzuhalten. Je größer der Unterschied, desto deutlicher kann eine Sache erkannt werden. In den tradierten Schriften (Sutras) wird berichtet, dass der Buddha als Sohn eines Königs aufwuchs, der ihn in seinem Palast einsperrte, zugleich aber mit allen nur erdenklichen Sinnesfreuden überhäufte, um jeden Mangel fernzuhalten und alle seine Bedürfnisse zu befriedigen. Als der Buddha eines Tages doch den Palast verließ, weckte das Leiden der gewöhnlichen Menschen in den Dörfern so sehr sein Mitgefühl, dass er sich entschloss, ein Leben als Wanderasket zu führen, um die Ursachen für dieses Leiden zu entdecken.
Nach vielen Entbehrungen und asketischen Übungen fand der Buddha einen mittleren Weg zwischen Askese und einem Leben in Ausschweifung, und er gewann schließlich eine sehr tiefgründige Erkenntnis von der Natur des Leidens. Durch diese Erkenntnis (bodhi) wurde er zu einem »Erkennenden« oder einem »Erwachten« – einem Buddha. Ein Buddhist ist jemand, der diese Erkenntnis des Buddha für sich selbst aus eigener Erfahrung des Leidens nachvollziehen möchte. Buddhist wird man also nicht durch einen Akt des Glaubens oder das Erlernen einer Theorie, sondern durch eine praktizierte Erkenntnis. Dies ist die praktizierte Erkenntnis der gegenseitigen Abhängigkeit, die der mitfühlenden Motivation mit allen Lebewesen entspricht.
Der Buddha hat aber nicht nur die Universalität des Leidens und die gegenseitige Abhängigkeit aller Phänomene entdeckt, er hat vor allem erkannt und erklärt, weshalb diese gegenseitige Abhängigkeit als Leiden erfahren wird. Die Tatsache, von etwas abhängig zu sein, ist offenbar nur ein notwendiger, kein hinreichender Grund für die Erfahrung von Leiden. Wer von der Zuneigung anderer Menschen abhängig ist und diese Zuneigung auch tatsächlich erfährt, der ist vermutlich glücklich. Die gegenseitige Abhängigkeit aller Dinge ist also sowohl für Glück wie für Leid verantwortlich. Weshalb dominiert dann aber letztlich immer (und das todsicher) die Erfahrung des Leidens?
Die Antwort des Buddha ist einfach: Der Grund ist eine Täuschung. Sie beruht auf einem Mangel an Wissen und führt zu einer falschen Wahrnehmung der Welt. Die Menschen existieren nicht zuerst als Menschen und unterliegen dann, wie nebenbei, auch noch so etwas wie einer Täuschung. Vielmehr ist dies, ein Lebewesen zu sein, selbst ein Prozess der Täuschung. Das klingt dunkel, und es ist auch sehr schwer, die volle Tragweite dieser Erkenntnis zu sehen – deshalb gibt es nicht besonders viele Buddhas unter den Menschen. Dennoch ist der Grundgedanke relativ einfach verstehbar.
Ein Mensch zu sein heißt, in einem grundlegenden Nichtwissen (avidyā) gefangen zu sein. Weil dieses Nichtwissen jedoch beim Menschen den Charakter eines Irrtums besitzt, deshalb kann man ihn auch beseitigen. Auch andere Lebewesen unterliegen einem grundlegenden Nichtwissen. Ihnen fehlt aber durch eine schwach entwickelte Vernunft die Möglichkeit, dieses Nichtwissen aus eigener Kraft zu durchschauen. Ein Irrtum ist immerhin schon eine Form vernünftiger Einsicht, allerdings eine verkehrte. Nur wer die Fähigkeit besitzt, etwas erkennen zu können, kann sich auch täuschen. Das Nichtwissen offenbart als Täuschung damit etwas ganz anderes.
Worin besteht diese Täuschung? Sie besteht, negativ ausgedrückt, darin, dass die gegenseitige Abhängigkeit aller Phänomene, dass die Leerheit nicht erkannt wird. Dieses Nichtwissen, die Unwissenheit, ist deshalb nicht etwas Passives, sondern selbst sehr aktiv. »Es kann keinen größeren Fehler geben, als zu denken, dass Unwissenheit irgendetwas Dumpfes oder Blödes sei, dass sie passiv sei oder ein Mangel an Intelligenz. Im Gegenteil. Sie ist gewieft und aalglatt, geschmeidig und genial im Spiel der Täuschung. (…) Unter Einsatz unserer ganzen Intelligenz rechtfertigen wir also unsere falschen Sichtweisen und konstruieren um uns herum ein sorgfältiges geschütztes, undurchdringliches Abwehrsystem.«33
Die Aktivität dieses Nichtwissens hat den Namen »Ego«, den wir auch mit »Ich« übersetzen. Wir Menschen glauben, wir hätten eine individuelle Existenz nur für uns selbst. Weil wir das glauben und weil im Gegenteil die Welt abhängiger Phänomene ein unaufhörlicher Prozess des Wandels ist, deshalb entsteht ein Widerspruch zwischen unserem Glauben an ein dauerhaftes Ego und der Erfahrung des Wandels. Die alltäglichen Erfahrungen widersprechen unserem Glauben. Dennoch behalten wir diesen Glauben bei. Und eben deshalb leiden wir.
Man kann diesen aktiven Irrtum nicht nur beim Menschen beobachten. Auch Tiere haben so etwas wie einen Selbsterhaltungstrieb. Richard Dawkins spricht vom »egoistischen Gen«. Das ist eine terminologische Übertreibung; dennoch liegt darin eine einfache Wahrheit: Es gibt auch in der Natur eine unaufhörliche Tendenz der Selbstbehauptung von Strukturen. Die genetische Reproduktion hat formal tatsächlich eine ähnliche Struktur wie der Ego-Prozess. Der Widerspruch zwischen dem Bestreben, sich zu erhalten, und einer sich wandelnden Umwelt ist der Grund für den Prozess der Evolution des Lebendigen.
Die Verblendung des Nichtwissens hat also sehr tiefe Wurzeln. Der buddhistische Philosoph Vashubandhu spricht vom »angeborenen Ich-Wahn«, 34 wie er mit der Selbsterhaltungstendenz des Körpers geboren wird. Das bewusste Ego als Denkprozess überlagert und kontrolliert diesen Ich-Wahn. Das bedeutet, dass der Ego-Prozess nicht leicht zu durchschauen ist. Die Überwindung des Leidens ist somit keine einfache Aufgabe, die in einem Wochenend-Seminar bewältigt werden könnte. Deshalb sagt der Buddha, auf dem von ihm gelehrten Weg ist »die Praxis eine allmähliche, ist die Betätigung eine allmähliche, ist der Pfad ein allmählicher, und es gibt kein plötzliches Vordringen zur vollen Erkenntnis«.35 Auch für Fragen der Wirtschaftsethik ist somit Geduld eine wichtige Tugend. »Revolutionäre« Lösungen, gleich welcher Art, verkennen die Struktur der ethischen Aufgabe und sind deshalb auch nahezu immer historisch gescheitert. Es geht hierbei primär um die schrittweise Verwandlung der Wahrnehmung und des Denkens, nachgelagert um die Reform von Institutionen.