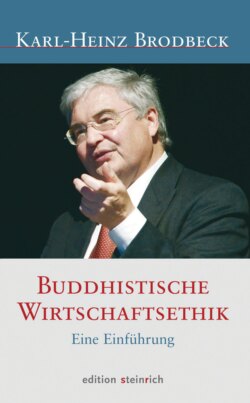Читать книгу Buddhistische Wirtschaftsethik - Karl-Heinz Brodbeck - Страница 19
Die Psychologie der Selbsttäuschung36
ОглавлениеDas Leiden der Menschen, das sie selbst erzeugen, beruht auf einer falschen Wahrnehmung, auf einem Erkenntnisirrtum. Dieser Irrtum drückt sich im Ich-Gedanken aus. Wir gehen davon aus, ein dauerhaftes Ego für uns selbst zu haben oder zu sein. Da wir aber faktisch auf vielfältige Weise von anderen Menschen, Lebewesen und der Umgebung abhängig sind, kann sich dieser Irrtum nur behaupten, wenn man auf die Veränderungen der umgebenden Situation immer wieder neu reagiert. Das Ego ist keine »Substanz«, sondern ein unaufhörlicher Kampf. Die Illusion des Egos – Ausdruck des Nichtwissens – ist aktiv. Die Aktivität des Egos entfaltet sich in zwei grundlegenden Emotionen, in denen es seinen Prozess aufrechterhält: durch Begierde und Aggression.
Weil ein dauerhaftes, bleibendes Ich eine leere Illusion ist, muss sich diese Illusion – wie der Körper – unaufhörlich von etwas Fremdem ernähren. Das entfaltet sich als Begierde. Man ergreift Menschen, Gedanken, Dinge und verwandelt sie in ein Mein: Mein Beruf, mein Haus, meine Kinder, mein Geld, mein Leben. Das, was wir mit »mein« bezeichnen, begrenzt das Territorium des Egos. Dieses Territorium ist aber nichts Dauerhaftes, sondern einem unaufhörlichen Wandel unterworfen, weil alles, was wir ergreifen oder besitzen, durch etwas anderes bedingt ist. Die negative Verteidigung des Ego-Territoriums entfaltet sich als Aggression oder als Hass; in milderen Formen als Gleichgültigkeit, Abneigung oder Ablehnung. Die Illusion des Ichs, die Täuschung des Nichtwissens ist also nicht etwas Statisches, sondern ein Prozess, in dem sich das Ego unaufhörlich in wechselnden Situationen durch Ergreifen oder Ablehnen selbst zu definieren und damit zu erhalten versucht. Das Ich ist etwas, was sich als situativer Prozess reproduziert.
Als Modell für diesen situativen Prozess verwendet man im Buddhismus die fünf Skandhas. Es sind fünf zentrale Aspekte, in denen man diesen Prozess und damit die Dynamik der Ich-Täuschung darstellen kann. In diesem Modell ist eine Situation charakterisiert durch (1) Sinnesgegenstände, wozu auch unser Körper gehört, (2) durch Emotionen und Stimmungen, (3) durch das aktive Wahrnehmen und Unterscheiden verschiedener Aspekte einer Situation, (4) durch die gewohnten, teils unbewussten Bewegungsmuster und (5) durch Denkprozesse.
Diese fünf Skandhas sind Aspekte einer dynamischen Situation. Man kann sie nicht trennen. Um eine Form als Form zu erkennen, muss sie in der Wahrnehmung erscheinen, die sich wiederum auf Erinnerungen, Erfahrungen, Gedanken stützt und von Gefühlen begleitet wird. Auch die gewohnten Bewegungsmuster umfassen alle fünf Skandhas, denn es gibt Bewegungen in vielfältigen Formen. Die fünf Skandhas drücken eigentlich die jeweils besonders aktualisierte Achtsamkeit aus, allerdings nicht in reiner, sondern in einer illusionären, mit Gewohnheiten durchsetzten Dynamik.
Durch die fünf Skandhas lässt sich die Verblendung als Prozess mit exakter Struktur darstellen. Man kann diesen Prozess deshalb erkennen und verändern. Es gibt im Buddhismus nicht eine Seele mit bestimmten festen, angeborenen Eigenschaften. Die Psyche ist ein Prozess. Die fünf Skandhas kann man deshalb auch als fünf Phasen des Ego-Prozesses beschreiben. Ich möchte das kurz an einem Beispiel erläutern:
1. Skandha (sinnliche Erscheinung): Ich begegne jemandem auf der Straße.
2. Skandha (Emotion): Der Anblick löst in mir eine angenehme, freudige Stimmung aus.
3. Skandha (Wahrnehmung, Unterscheidung): Auf der Basis dieser Emotion unterscheide ich diese Person von anderen Menschen, die auf der Straße unterwegs sind; ich erkenne diese Person als meinen Freund Peter.
4. Skandha (Gewohnheitsmuster): Ich gehe auf ihn zu, begrüße und umarme ihn.
5. Skandha (Denkprozesse): Während der Wahrnehmung spreche ich innerlich zu mir selbst (»das ist doch Peter!«) oder es tauchen Bilder der Erinnerung auf.
Derartige Prozesse verlaufen sehr rasch. Vor allem die Denkprozesse spielen hierbei eine zentrale Rolle. Durch einen endlosen inneren Dialog begleiten wir die abwechselnde Dynamik von sinnlicher Wahrnehmung, Gefühl und gewohnter Reaktion. Während wir handeln und denken, üben wir bestimmte Gewohnheitsmuster ein. Die Summe aller eingeübten Gewohnheitsmuster (samskāra) bildet das Karma oder die karmischen Muster. Man gewöhnt sich daran, bestimmte Dinge auf diese oder jene Weise zu interpretieren, wahrzunehmen und darauf gegründet zu handeln. Hinzu kommt der begleitende Denkprozess, der all diese Erfahrungen nach »mein« und »dein« taxiert, Dualitäten wie »gefällt mir«, »gefällt mir nicht« einübt und dies durch vielfältiges inneres »Ich-Sagen« verfestigt.
Dass sich darin ein täuschender Prozess vollzieht, erkennt man schon daran, dass jeder zu sich selbst das Wort »Ich« sagt. Das Ich ist also nichts Besonderes, sondern etwas Massenhaftes und Gewöhnliches. Jeder ist solch ein »Ich«. Jeder handelt aufgrund von Erfahrungen mit Dingen der Umgebung, um sie nach »mein« und »dein« einzuteilen, mit »das mag ich« oder »das mag ich nicht« zu bewerten und ein rein fiktives Territorium des »Mein« aufzubauen. Milliarden Menschen denken in denselben Begriffen, teils in denselben Sätzen – z. B. der Weltsprache Englisch –, haben die gleichen Gefühle und klammern sich an die gleichen Dinge – doch jeder glaubt, er sei darin etwas ganz Besonderes und Einmaliges. Dieser Ich-Glaube kann sich natürlich auch hinter nationalen, ethnischen, religiösen, wirtschaftlichen, politischen oder wissenschaftlichen Identitäten verbergen: »Ich als Deutscher«, »Ich als Christ, Buddhistin oder Muslim«, »Ich als Liberale« usw. Schopenhauer sagt an einer Stelle seiner »Aphorismen zur Lebensweisheit«: Wenn so ein armer Tropf gar nichts mehr ist oder besitzt, dann klammert er sich an seine Nation, auf die er stolz sein will. Von solcher Kargheit ist jeder Ich-Gedanke. Es ist ein leerer Schatten.
Gleichwohl ist dieser Prozess der Ich-Täuschung sehr mächtig und eine so stark verankerte Gewohnheit, dass man ihn trotz seiner Einfachheit gar nicht mehr bemerkt. Wie entsteht dieser Ego-Prozess? Der Zen-Meister Bankei sagt mit entwaffnender Einfachheit: Dadurch, dass die Kinder das verblendete Verhalten der Eltern nachahmen. Wir würden vermutlich ergänzen: durch die Schule, die Nachahmung von Menschen aus den Medien oder die wechselseitige Imitation der Kinder und Jugendlichen. Unsere Gewohnheitsmuster sind somit auch sozial und kulturell bedingt. Vor allem aber: Es ist nicht schwer, verblendet zu sein. Gleichwohl ist es sehr anstrengend, die Ich-Illusion aufrechtzuerhalten. Wir verschwenden unendlich viel Zeit damit, unseren Begierden nachzujagen oder unsere kleinen Feindschaften, Wutanfälle oder unser Beleidigtsein und Selbstmitleid zu pflegen. All dies sind Formen des Ego-Prozesses.
Halten wir fest: Die Ich-Illusion beruht auf dem Nichtwissen darüber, dass alle Phänomene, alle Erfahrungen voneinander abhängig sind und es keine isolierte Insel in der Welt gibt. Es gibt keine Ich-Substanz und keine Substanz der Dinge, nur eine Vielfalt ineinander verflochtener, dynamischer Prozesse. Das Nichtwissen ist also nicht statisch, es reproduziert sich durch viele Gedanken und Handlungen, die das Ego-Territorium verteidigen – entweder durch das begehrliche Ergreifen oder die aggressive Ablehnung von Menschen und Dingen.
Das Ego selbst, das sich auf die fünf Skandhas stützt, ist leer. Im wohl bekanntesten Sutra des Buddhismus, dem »Herz-Sutra«, werden die fünf Skandhas als leer bezeichnet. Das heißt: Sie sind jeweils für sich keine abgetrennte Substanz und werden auch von keiner anderen Substanz getragen, sondern sind ein Prozess, der sich unentwegt selbst erzeugen muss. Da das Ego nichts für sich selbst ist, sondern in dieser blinden Dynamik auf einem fundamentalen Nichtwissen beruht, muss es sein fiktives Territorium unaufhörlich ausweiten oder verteidigen. Das Bestreben nach Ausweitung zeigt sich in der Begierde, die von der vergeblichen Hoffnung angetrieben wird, die eigene Leere zu erfüllen. Die Verteidigung des Ego-Territoriums zeigt sich als Aggression, innerlich durch Furcht und Angst begleitet. Emotional schwankt das Ego beständig zwischen dumpfer Unwissenheit, greifender Begierde und aggressiver Selbstverteidigung; der begleitende Denkprozess ist unaufhörlich zwischen Hoffnung und Furcht hin- und hergerissen.
Diese illusionäre Dynamik der Aufrechterhaltung des Ego-Territoriums bezeichnet man im Buddhismus als die drei Gifte: Unwissenheit, Begierde, Aggression. Sie gründen in der Unwissenheit, der verdunkelten Achtsamkeit, und entfalten darauf gestützt ihre Gewohnheits-Dynamik. Die Achtsamkeit ist nicht verschwunden, sondern latent in den Gewohnheiten des Ego-Prozesses gegenwärtig – wie der blaue Himmel hinter den Wolken.37 Diese drei Gifte verdecken also etwas, und sie sind bedingt. Sie sind nicht dauerhaft. Mehr noch. Wir müssen deshalb unaufhörlich aktiv sein, um diese drei Gifte und damit unseren Ego-Prozess in Bewegung zu halten, um die fünf Skandhas wie ein Rad im Kreise zu drehen. Eben deshalb kann man aber auch diesen Prozess der Verblendung verändern. Weil die Verblendung etwas ist, das wir machen, deshalb können wir es auch lassen. Die Quelle zu dieser Veränderung, die Achtsamkeit – die sich auf den nachfolgenden Seiten auch als Mitgefühl zeigen wird –, ist schon da.