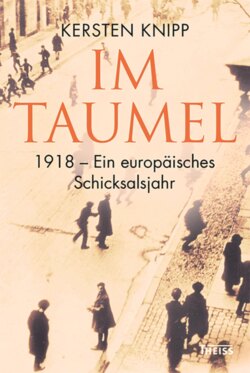Читать книгу Im Taumel - Kersten Knipp - Страница 16
Menschen in elenden Hütten
ОглавлениеDie Polen hatten dem Ende des Weltkriegs voller Hoffnung entgegengesehen. Er schien ihnen zu bringen, was sie seit rund 125 Jahren nicht mehr hatten: einen eigenständigen Staat. Am 11. November ruft Kommandant Józef Piłsudski, einer der führenden Unabhängigkeitskämpfer des Landes, die neue Republik aus. Es ist ein Freudentag: Fast eineinviertel Jahrhunderte lang hatten Polens mächtige Nachbarn – das Zaren-, das Habsburger- und das Deutsche Reich – das polnische Territorium unter sich aufgeteilt. Doch diese Reiche gibt es nun nicht mehr, ihre Regenten sind abgetreten oder wurden, wie der russische Zar, gestürzt und ermordet. Die Polen aber: Sie haben es geschafft, sie haben ihren Staat nach endlos langer Zeit wieder.
Und doch ist es zunächst ein gefährdeter und ein geschwächter Staat. Der Krieg hat dem Land riesige Wunden gerissen. 7500 Brücken und 940 Bahnhöfe sind zerstört, Landwirtschaft und Industrie haben große Produktionsverluste hinnehmen müssen.53 Während des Krieges haben die Besatzungstruppen das Land nach Kräften geplündert oder, wo das nicht möglich war, zerstört. Schon 1915 hatte sich die russische Armee aus den zunächst eroberten Gebieten zurückgezogen. Auf ihrem Marsch verwandelte die Armee das Gebiet in ein einziges waste land. Die Soldaten zündeten Felder an, rissen Gleise aus den Schienen, zerstörten die Industrieanlagen oder demontierten sie. Zugleich zwangen sie eindreiviertel Millionen Zivilisten, ihr Land zu verlassen, viele der Vertriebenen wurden gezwungen, mit in Richtung Osten zu wandern. Von diesem Raubzug erholte sich das Land die gesamte Kriegszeit über nicht mehr. Dies umso mehr, als nach dem Rückzug der Russen die Truppen des Deutschen und des Habsburgerreichs die Region besetzten und systematisch auspressten. Zehntausende Motoren und Maschinenteile sind zerstört, vernichtet von den Deutschen, die zynisch von einer „De-Industrialisierung“ Polens sprachen.54 Auch die Bevölkerung haben die Truppen des Feindes nicht verschont. Elf Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche sind zerstört, sechs Millionen Hektar des Baumbestandes gefällt. Außerdem haben die Deutschen zwei Millionen Stück Vieh, eine Million Pferde und eine halbe Million Schafe mitgenommen: Nahrungsmittel, die nun fehlen, sodass der Bevölkerung zwei harte Hungerwinter bevorstehen. Die Folgen sind verheerend: 1918 war die tägliche Lebensmittelzuteilung auf 900 Kalorien gefallen, in Warschau stieg die Zahl der Tuberkulose-Erkrankungen auf das Fünffache.
Zudem muss das Land gewaltige Verluste von Menschenleben verkraften. Die Polen haben in drei verschiedenen Heeren gekämpft, je nachdem, zu welchem der Reiche ihre jeweilige Heimatregion gehörte. Lebten vor dem Krieg 30,3 Millionen Menschen in dem Gebiet des neu gegründeten Staates, waren es 1918 fünf Millionen weniger. Eine humanitäre Katastrophe, die der spätere US-Präsident Herbert Hoover, seit Frühjahr 1917 Leiter der US-amerikanischen Hilfsmission, 1919 in eindringlichen Worten beschrieb. Es gebe „etwa 28 Millionen Menschen, die innerhalb von vier Jahren von vier Invasionen während dieses einen Krieges geschändet worden sind, wo Schlachten und sich zurückziehende Armeen zerstört haben, und wieder zerstört haben. In einigen Landesteilen gab es sieben Invasionen und sieben vernichtende Rückzüge. Hunderttausende sind verhungert. Die Heime von Millionen sind zerstört worden; dort lebten die Menschen in elenden Hütten … In den Städten gab es fast keine Nahrung. Typhus und andere Epidemien breiteten sich über ganze Provinzen aus.“55
Vor allem aber sind die Grenzen der jungen Republik noch keineswegs gesichert. Zwar hat Präsident Woodrow Wilson im dreizehnten seiner Vierzehn Punkte als Bestandteil der neuen Friedensordnung auch die Erschaffung eines unabhängigen polnischen Staates genannt; zwar hatte sich Frankreich bereits im Herbst 1917 für die polnische Unabhängigkeit eingesetzt – aber friedlich wäre die Geburt des neuen Staates nur bei gutem Willen seiner Nachbarn möglich gewesen. Doch der gute Wille fehlte: Auf Kompromisse waren weder Polen noch seine Nachbarn aus. Alle sahen sie die Neuordnung Mitteleuropas als Nullsummenspiel, bei dem das, was der eine Staat gewänne, der andere verlieren würde.
Kaum war darum der Waffenstillstand in Compiègne unterzeichnet, deuteten sich die neuen Konflikte an. In ihnen geht es vor allem um eines: das Territorium des wieder auferstandenen Staates zu sichern und, wenn möglich, zu erweitern. Deutschland, Tschechien, Litauen, vor allem aber Russland und die Ukraine: Überall versuchten die Polen in den kommenden Jahren, sich gegen die Ansprüche der Nachbarn zu behaupten. „Der Weltkrieg war nur an der Westfront beendet; in den alten Gebieten der Adelsrepublik ging er weiter: als Bürgerkrieg, in dem Nachbarn aufeinander losgingen, als Kolonial- und Befreiungskrieg, in dem die Bewohner der Grenzprovinzen gegen die bisherige Staatsmacht rebellierten, am seltensten als regulärer Krieg zweier Armeen, in dem es nur um Grenzverschiebungen ging.“56
So war Polen alles andere als ein friedlicher Staat. In den Monaten nach dem in Paris unterzeichneten Waffenstillstand lebte Joseph Wittlin wieder in Galizien und erlebte die dort gefochtenen Kämpfe. Bereits im November startete Piłsudski einen Krieg gegen die Truppen der Ukraine. Diese waren zunächst auf polnisches Terrain vorgedrungen, dann aber drängten die Polen sie wieder zurück. Umgehend begannen sie ein Pogrom an den dort lebenden Juden. Die Jagd auf die Wehrlosen, rechtfertigten sie sich, sei die Rache dafür, dass diese sich im Ringen um die Region für neutral erklärt hatten. Von den Ausschreitungen erfuhr auch der Dichter Joseph Wittlin. Die Verbrechen, erklärte der überzeugte Pazifist, waren unentschuldbar. „Wenn ich den österreichischen Krieg mit reinem Gewissen ein Verbrechen nennen konnte, für das die Monarchen, Diplomaten, Journalisten und Lieferanten die Verantwortung tragen“, notierte er, „wie sollte ich mich angesichts der Kämpfe um Lemberg verhalten, deren Ausgang mir nicht gleichgültig war? Konnte ich denn, angesichts des von mir ersehnten polnischen Sieges, die Augen vor dem dreitägigen antijüdischen Pogrom verschließen? Ich wurde hier zum Zeugen eines Ereignisses, das alle meine bisherigen Ansichten über den Krieg umwertete.“57
Dass der Krieg nach dem Krieg brutal und entschlossen geführt würde, fürchtete auch der angehende Anwalt Arthur Lehman Goodhart. Der junge Mann reiste 1919 mit der Morgenthau-Kommission durch Polen, um Vorwürfe zu untersuchen, auch das polnische Militär beteilige sich an antisemitischen Übergriffen. Während der Reise von Wien nach Warschau unterhielt er sich mit einem Oberst, der von seinen guten Eindrücken aus der Tschechoslowakei berichtete. In Polen hingegen lagen die Dinge offenbar anders. „Als wir an einem kleinen Bahnhof auf dem Lande hielten, sahen wir eine Schar Jungs von etwa vierzehn Jahren, die im Exerzierschritt an uns vorbeimarschierten. Statt echter Gewehre trugen sie kleine Imitate aus Holz. ‚Es sieht nicht so aus, als wären diese Leute davon überzeugt, dass der letzte Krieg gerade vorbei ist‘, sagte der Oberst. ‚Sie werden diesen Militarismus satt haben, noch ehe Ihre Reise beendet ist. Überall herrscht Chauvinismus. Soweit ich das beurteilen kann, ist gerade jeden zweiten Tag in diesen neuen mitteleuropäischen Staaten ein Feiertag, um die unerwartete nationale Unabhängigkeit zu feiern.‘“58
Den heftigsten Krieg führten die Polen aber gegen Sowjetrussland. Zunächst rückten die Polen auf weißrussisches Gebiet vor und von dort aus weiter in Richtung Ukraine, um im Mai 1919 sogar Kiew einzunehmen. Doch dann drängte die Rote Armee sie zurück. In dem Krieg ging es um viel mehr als darum, das jeweils eigene Staatsgebiet zu erweitern. Lenin hielt den Zeitpunkt für geeignet, den schwachen Nachbarn unter den Einfluss des geplanten bolschewistischen Großreichs zu zwingen – nicht allerdings, ohne das Risiko des Unterfangens zu sehen. „Wenn wir Polen angreifen, greifen wir auch die Alliierten an“, erklärte er. „Indem wir die polnische Armee zerstören, zerstören wir auch den Versailler Frieden, auf dem das gesamte derzeitige System der internationalen Beziehungen beruht.“59 Dennoch schien das Risiko einen Versuch wert: Im Sommer 1920 installieren die Bolschewisten in den eroberten Gebieten eine „Polnische Sozialistische Republik“. Die Staatsführung dieses kurzfristigen Gebildes ist schwach, entsprechend gewalttätig geht es dort zu. Leidtragende sind vor allem die Juden. Der jüdische Schriftsteller Arnold Zweig beschreibt im Sommer 1920 die Gräuel der Region: „Polen und Pogrom ist über das Ostjudenvolk hereingebrochen, das in großen Städte(n) gehäuft wohnt, und das über Dörfer und Städtchen verstreut ist. Aus großen Städten kommen erschütternde Nachrichten, aber die Dörfer und Städtchen, ohne Eisenbahn, ohne Telegraphen, bleiben lange stumm. Langsam hört man, was dort geschieht: Mord oder Metzelung.“60
Unterdessen schreitet die Rote Armee weiter Richtung Westen. Im August steht sie vor den Toren Warschaus. Doch dann gelingt es dem gewieften Strategen Piłsudski, die Russen in einer raffinierten Gegenoffensive zurückzudrängen. Das Ereignis ist seitdem in Polen als „Wunder von der Weichsel“ bekannt. Bald darauf, im März 1921, einigen sich die beiden Kriegsgegner im Vertrag von Riga auf den künftigen Grenzverlauf. Polen erhält Teile der Ukraine und Weißrusslands. Die Ostgrenze des neuen Staats ist damit weitgehend etabliert – und aus der Rückschau die erste Schlacht des seit 1945 in aller Wucht einsetzenden Ost-West-Konflikts geschlagen.