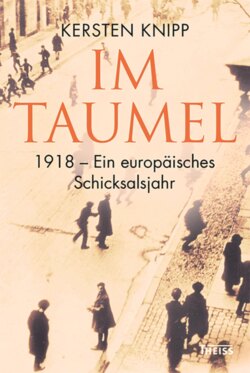Читать книгу Im Taumel - Kersten Knipp - Страница 19
Abschied von der Provinz
ОглавлениеDer Modernisierungsschub, der die Bürger letztlich an das Reich band, setzte mit voller Kraft im 18. Jahrhundert ein. Als Erste erkannte Erzherzogin Maria Theresia den Zwang zur Veränderung. Der Österreichische Erbfolgekrieg (1740–1748) und der Siebenjährige Krieg (1756–1763) hatten das Reich an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Zwar hatte es beide Kriege ohne große Verluste überstanden – einzig die Provinz Schlesien hatte man an Preußen verloren –, aber eines lag doch auf der Hand: Weitere Kriege dürfte das Reich in seinem derzeitigen Zustand nicht überstehen, geschweige denn gewinnen. Die Armee musste reformiert werden, und mit ihr die gesamte Reichsverwaltung. Diese hatte bislang auf vier in verschiedenen Ländern angesiedelten Hofkanzleien beruht, deren Aufgabe es auch war, mit den Provinzfürsten über Steuern zu verhandeln – ein zähes und mühseliges Verfahren, hatten diese Fürsten doch ganz unterschiedliche, teils einander widersprechende Interessen. Sie arbeiteten zwar auch für das Wohl des Gesamtreichs, mehr aber noch für das ihrer eigenen Staaten und zudem ganz wesentlich auch für das ihrer eigenen Häuser. Die Hofkanzleien, erkannte die Kaiserin, hatten als Einzelne zu wenig Macht. Zugleich waren sie, bislang von Mitgliedern des Adels geleitet, oft zu wenig kompetent. Es brauchte also Konzentration und Fachwissen. An die Stelle der Fürsten setzte sie – gegen deren erheblichen Widerstand – Berater, die sich mehr und mehr aus qualifizierten bürgerlichen Kreisen rekrutierten und die unter ihrem Sohn Joseph II. eine zunehmend professionellere Ausbildung durchliefen. Diese, aus allen Reichsteilen angeworben, bildeten mehr und mehr eine ganz eigene Klasse, eine „zweite Gesellschaft“ innerhalb des Staates, die sich ihren Herkunftsprovinzen nicht mehr verpflichtet fühlte. „Die Bürokraten sympathisierten weder mit dem Lokalpatriotismus noch mit den Adelsprivilegien; ihr Ideal war ein gleichförmiges Reich, regiert auf Basis aufgeklärter Prinzipien.“17
Auf das Engste verknüpft war der neue Geist mit dem Ethos des jungen Kaisers. Der, seit 1765 Mitregent seiner Mutter und nach deren Tod alleiniger Herrscher, sah sich nicht als Eigentümer, sondern als „Diener“ und „Organ“ des Staates. „Jeder Untertan“, schrieb Joseph 1786, „erwartet von seinem Herrn Schutz und Sicherheit. Darum obliegt es dem Monarchen, die Rechte seiner Untertanen festzusetzen und ihre Handlungen so zu leiten, dass sie dem allgemeinen Wohle und dem der einzelnen zum Besten gereichen.“18 Verpflichtung einzig und allein gegenüber dem Gesamtwohl war die Maxime des neuen Kaisers, der er alles andere unterordnete. Eine repräsentative Regierung, Gesetzesherrschaft und juristische Gleichwertigkeit ausnahmslos aller Bürger, das Toleranzedikt, kurz darauf das Judenpatent, Einführung des ersten Teils des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Förderung des Volksunterrichts: Das waren nur einige der Reformen, die Joseph, teils gegen starken Widerstand durchsetzte – und zwar mithilfe seiner Berater, von denen der asketisch lebende Herrscher strengste Disziplin forderte. Seine Erwartungen formulierte er in seiner 1784 veröffentlichten „Erinnerung an seine Staatsbeamten“, auch bekannt als „Hirtenbrief“. Darin umriss er die ethischen Prinzipien, denen seine Beamten fortan zu folgen hätten. Ganz wesentlich: der konsequente Verzicht auf allen Eigennutz. Der Eigennutz, heißt es in dem Schreiben, „ist das verderben aller geschäften und das unverzeihlichste laster eines staatsbeamtens. Der eigennuz ist nicht allein von geld zu verstehen, sondern auch von allen nebenabsichten, welche das einzige wahre beste, die aufgetragene pflicht und die wahrheit im berichten und die genauigkeit im befolgen, verdunkeln, bemängeln, verschweigen, verzögern oder entkräften machen.“ Ein solches Verhalten sei ab sofort nicht mehr hinnehmbar. „Ein chef, der von seinen untergebenen dieses leidet, ist meineidig gegen sein jurament, worgegen keine erbarmnis oder nebenruksichten platz zu greifen haben. Ein untergebener, der seinen vorgesezten nicht angiebt, handelt gegen seine pflicht, so er seinen landesfürsten und allen seinen mitbürgern schuldig ist.“19
Mit diesem Brief setzte Joseph einen weiteren Schritt in Richtung jenes Beamtentums, auf dessen Grundlage er fortan den Staat organisieren wollte. Einen Staat, der die unterschiedlichsten Länder, Menschen und Sprachen umfasste, ein Herrschaftsgebiet, das von dem Gebiet der heutigen Ukraine bis nach Tirol, von der Adria bis zum heutigen Tschechien reichte. Ein solches Reich, erklärte der Kaiser, bedürfe einer unbestechlichen, überall nach denselben Vorgaben handelnden Verwaltung. Kein Land dürfe gegen das andere ausgespielt werden. „Da das gute nur eines sein kann, nemlich jenes, so das allgemeine und die gröste zahl betrift und ebenfalls alle provinzen der monarchie nur ein ganzes ausmachen und also nur ein absehen haben können, so muss nothwendig alle eifersucht, alles vorurtheil, so bis itzo öfters zwischen provinzen und nazionen, dann zwischen departemens so viele unnütze schreibereyen verursacht hat, aufhören … Nazion, religion muss in allen diesen keinen unterschied machen und als brüder in einer monarchie müssen alle sich gleich verwenden um einander nuzbar zu seyn.“20 Damit war die Politik des Vielvölkerstaats zumindest theoretisch umrissen: Keine Provinz hatte ein Vorrecht gegenüber anderen, kein Stand, keine Schicht durfte sich privilegiert fühlen, keine Ethnie, keine Konfession konnte auf Sonderrechte zählen. „Österreich war eine imperiale Organisation, kein Land; Österreicher zu sein, hieß, frei von nationalen Gefühlen zu sein – keine Nationalität zu besitzen.“21
Doch woran sollte man sich klammern, wenn nicht an die Nation? Schon dieses Konzept, im heutigen Sinn verstanden, war vielen Menschen des 18. Jahrhunderts nicht einsichtig. Im damaligen Ungarn waren damit nur diejenigen Adligen gemeint, die im Landtag vertreten waren, sowie diejenigen, die die dort versammelten Repräsentanten wählen durften. Das waren Bürger, die von der Steuerpflicht ausgenommen waren. Alle anderen, also die große Mehrheit der Ungarn, gehörten hingegen nicht zur ungarischen „Nation“.22 In Polen wiederum hatten die Freiheitskämpfer größte Mühe, die Bauern zu überzeugen. Von den Habsburgern nach der ersten Teilung von Frondienst und Zwangsabgaben an den Adel befreit, brauchte es seitens der aufgeklärten Teile des Adels Jahrzehnte, um die Bauern für die polnische Sache zu gewinnen. Nach einer langen Zeit der Rechtlosigkeit sahen diese keinerlei Anlass, sich zusammen mit den Adligen, die für ihre deprimierende Lage verantwortlich waren, gegen die österreichischen Herrscher zu wenden. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten die galizischen Bauern erste Ansätze eines Nationalgefühls – und das auch nur, weil sie zuvor heftig umworben und geradezu als Inkarnation des Polentums dargestellt worden waren. Mit massivem literarischen und wissenschaftlichen Einsatz schufen Künstler und Intellektuelle ein neues Bild der polnischen Bauernschaft, werteten sie auf und gliederten sie so in das Bild der entstehenden Nation ein. Selbstverständlich, das zeigt sich auch an diesem Beispiel, ist im Prozess der Nationswerdung kaum etwas.
Es leuchtet ein: Wenn schon die Entwicklung des nationalen Bildes erheblichen Aufwands bedarf, war die Schaffung einer imperialen Identität ein noch viel komplexeres Unterfangen. Allein mit ideologischen und kulturellen Mitteln wäre das unmöglich. Was es brauchte, so erkannte der Schriftsteller und Verwaltungsreformer Joseph von Sonnenfels, waren massive Investitionen in die soziale und juristische Ordnung. In seinem 1771 veröffentlichten Memorandum Ueber die Liebe des Vaterlands machte er darum Vorschläge, wie man die Bürger des Reichs für dieses gewinnen und, mehr noch, in ihnen regelrechte Zuneigung zu diesem wecken könne. Grundlegend dafür, schrieb er, sei vor allem eines: Man müsse sie davon überzeugen, dass sie unter der Krone der Habsburger gut aufgehoben seien. Die Reichsbewohner müssten darum die Gewissheit haben, dass ihr persönliches Wohlergehen zu großen Teilen auf dem Umstand gründe, Bürger des Habsburgerreiches zu sein. Auf dieser rationalen Grundlage lasse sich dann ein affektives Verhältnis zum Staat entwickeln. „Ein glücklicher Bürger“, schrieb er, „ist darum noch kein Patriot, aber so gewiss, als er sein Glück liebt, wird er es werden, wenn er sein Vaterland als die Quelle seines Glücks erkennt.“23 Um dieses Glück aber dauerhaft zu sichern, müsse der Staat in die Pflicht genommen werden und die Voraussetzungen schaffen, auf denen die Zuneigung der Bürger zu ihm gründen könne. Dafür sah Sonnenfels vor allem die unbedingte Herrschaft von Recht und Gesetz als relevant an, und zwar ausnahmslos im gesamten Reich. Keine Region dürfe gegenüber anderen benachteiligt sein, für alle Provinzen und Länder wie auch die in ihnen lebenden Bürger müsse das gleiche Recht gelten. „Das unbedingte Vertrauen der Unterthanen wird durch die Überzeugung bekräftiget werden, dass wir es nicht missbrauchen. Dieses Vertrauen kann auch dadurch nur gewinnen. Gute Gesetze führen die Gründe immer mit sich, warum sie gut sind, und schlechte – aber wenn sichs die Gesetzgebung selbst zur Pflicht macht, die Ursachen mit einzuschalten, so kann es keine schlechten Gesetze geben.“24
Eine missbräuchliche Auslegung der Gesetze wäre etwa dann gegeben, wenn sich einige Gruppen ihrer Geltung entziehen könnten. Dabei hatte von Sonnenfels besonders eine Klasse im Blick: den Adel. Der war in den Provinzen der verlängerte Arm des Königs und war verantwortlich dafür, dass die in Wien vorgegebene Ordnung vor Ort tatsächlich umgesetzt wurde. Im Gegenzug genoss er erhebliche Privilegien. So war er etwa von der Steuerpflicht ausgenommen, genoss juristische Sonderrechte oder konnte sogar die auf seinen Gütern lebenden Bauern an einem oder mehreren Tagen der Woche zu unentgeltlichen Diensten verpflichten. Dies war vornehmlich in Ungarn und den slawischen Reichsteilen der Fall, wo die Bauern unter der teils sehr massiven Last des Frondienstes kaum dazu kamen, ihre eigenen Felder zu bestellen. Gegen solche schwer hinnehmbaren Sonderrechte gelte es vorzugehen, war von Sonnenfels überzeugt. Denn nur die Gewissheit, durch das Gesetz gegen Willkür vonseiten Dritter, insbesondere des Adels geschützt zu sein, verschaffte jene Bindung zwischen Reich und Bürgern, die für Stabilität und Prosperität des Staates unverzichtbar war. „Der Adel betrachtet sich als den Herrn des Volkes, aber er muss ihm entweder schmeicheln, um es seiner Stärke vergessen zu machen, oder es unterdrücken, um ihm seine Stärke zu nehmen“, schrieb darum von Sonnenfels.25 Er erkannte, wie fragil dieses System war, wie sehr die Bauern darauf erpicht sein mussten, das System zu hintergehen oder, besser noch, zu stürzen.
Von Sonnenfels war ein weitsichtiger Autor. Wenige Jahre vor der Französischen Revolution erkannte er die innere Gefährdung des Reiches, die Risiken, denen es, blieben seine rechtlichen Grundlagen ohne Korrekturen, ausgesetzt wäre. So verstanden, ist seine Schrift ein Beitrag zur Revolution von oben, dem von der Staatsspitze angeregten Reformprozess, der das Reich langfristig sichern soll. Zugleich will von Sonnenfels auch die Produktivität der Bürger erhöhen. Im Vertrauen auf den Schutz der Gesetze sollen sie ihre Arbeitskraft entfalten, ihren Wohlstand erhöhen, durch den sich qua Steuern auch der des Staats vermehrt. In moderne Terminologie übersetzt geht es von Sonnenfels um die Aktivierung der Zivilgesellschaft, jedenfalls deren ökonomischer Seite. Der Wohlstand des Einzelnen fördert den des Gesamtstaats. Deshalb lohnt es sich für diesen, das Wohlergehen seiner Bürger zu fördern. „Wie jeder Einzelne seinen Antheil von der Masse der allgemeinen Glückseligkeit empfängt“, notiert von Sonnenfels, „so lässt sich auch jeder bereitfinden, diese Masse durch denjenigen Beytrag größer zu machen, der in seinen Kräften steht.“26