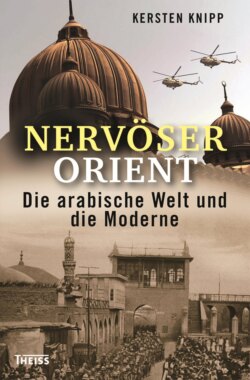Читать книгу Nervöser Orient - Kersten Knipp - Страница 10
Der Islam – und was man aus ihm nicht lernen kann
ОглавлениеEs sind, so die These dieses Buches, diese millionenfach gemachten Erfahrungen von Verlust und Scheitern, die den Orient und seine Menschen irgendwann haben nervös werden lassen. Erwartungen, die sich nicht erfüllten, Aspirationen, die ins Leere liefen, im persönlichen Leben ebenso wie in der Gesellschaft als ganzer: Sie haben dazu beigetragen, jene Atmosphäre der Hektik, Ungeduld und Verdrossenheit entstehen zu lassen, die für weite Teile der Region derzeit so typisch ist.
Dazu ein persönliches Wort: Irgendwann nach dem 11. September 2001, den spektakulären Attentaten von New York und Washington, hielt es mich nicht mehr: Während einer Reise nach Tunesien kaufte ich mir ein Lehrbuch der arabischen Sprache. Ich wollte wissen, wovon sie getrieben wird, die arabische Welt, und zwar aus erster Hand. So hielt ich nach einigem Stöbern ein, grünes, reichlich abgeschabtes Bändchen in der Hand. Zerknickt und mit Falten auf dem Umschlag, war es alles andere als ansehnlich. Aber es tat seinen Dienst. Es führte mich in die arabische Schrift ein, jene so exotisch anmutenden Zeichen, die für mich bis dahin das verlockendste Rätsel des Orients gewesen war, viel anziehender noch als die anderen Attraktionen der Region. Viel mehr als Kamele, Dattelpalmen, Moscheen und fliegende Teppiche interessierten mich die Schriftzeichen. Ich lernte also Arabisch. Ein work in progress, mit der Betonung auf beidem: der Arbeit, aber auch dem Fortschritt. In meiner Erfahrung ist beides untrennbar miteinander verbunden: Kniet man sich rein, geht es voran. Verschiebt man das Üben auf den nächsten und den übernächsten Tag, wird die Sprache ein Rätsel bleiben. Inzwischen, nach zahllosen Stunden über Grammatiken, Vokabellisten und Privatstunden, bin ich halbwegs zufrieden – ganz werde ich es aber nie sein.
Zugleich begann ich, über die Region zu lesen. Eine Reise nach Paris hatte mich in das wunderbare Centre du Monde Arabe nahe der Sorbonne gebracht. Das von mehreren arabischen Staaten finanzierte Kulturzentrum, ein Areal von durchaus beachtlicher Größe, bietet zahllosen Veranstaltungen – Ausstellungen, Musikaufführungen, Diskussionsrunden – eine Bühne. Und es hat eine eigene Buchhandlung, eine der bestausgestatteten in Europa, was Bücher zur arabischen Welt angeht. Dort wurde ich zu einem guten Kunden. Von jeder Reise nach Paris kam ich schwerbeladen zurück. Und so entdeckte ich die großen arabischen Historiker, Politologen, Soziologen und Kulturwissenschaftler der Gegenwart, die Bücher eines Hischam Dschait, Samir Kassir, Sadiq al-Azm, Georges Corm, um nur ein paar zu nennen. Wenn es bis ins Mark gehende, also geradezu physisch spürbare intellektuelle Erschütterungen gibt, dann haben die Bücher dieser Autoren sie ausgelöst. Hier fand ich die Probleme der arabischen Welt auf ganz andere Art beschrieben als auf jene, die ich aus vielen deutschen Texten gewohnt war. In gewisser Weise schrieben diese Autoren über die Welt auf eine geradezu exotisch anmutende Weise: nämlich nüchtern, präzise und konkret. Keine großen Spekulationen über das Mega-Thema „Islam“, stattdessen Blicke auf das Umfeld: auf Politiker, Staatsmänner und Regierungen, auf Diplomaten und internationale Unterhändler, auf Bildungspolitik, Schulen und Universitäten; auf den Arbeitsmarkt, die politische Kultur, rechtstaatliche Prinzipien und deren Geltung, auf Menschenrechte, Medien und die Kultur. Kurzum, auf all das, was sich auf das Leben der Bürger unmittelbar auswirkt, ihr Daseinsgefühl bestimmt, dazu beiträgt, wie sie die Welt sehen. Noch anders gesagt: Die arabischen Analytiker beschrieben (und beschreiben) ihr Welt so, wie westliche Analytiker die ihre beschreiben: nüchtern, sachlich, nachvollziehbar. Auf eine Weise also, die sich gründlich von derjenigen unterschied, mit der man damals in Deutschland, jedenfalls außerhalb des akademischen Feldes, über die arabische Welt schrieb. Inzwischen, insbesondere seit den Aufständen des Jahres 2011, ist zwar auch die hiesige Literatur konkreter und nüchterner geworden. Aber nach wie vor steht im Zentrum sehr vieler Debatten der Islam. Er muss für alles herhalten: für die politischen Missstände in der Region; den erbärmlichen Zustand der Menschen- und Bürgerrechte; das Scheitern demokratischer Aspirationen auch nach dem Revolutionsjahr 2011; für ihren ökonomischen Rückstand; das oft schlechte Ausbildungsniveau von Schülern und Absolventen, kurzum: eigentlich für alles.
Die Autoren, die mich in den letzten Jahren beschäftigt haben, sehen es anders: Sie alle sind weit davon entfernt, den in der Tat oft bedauerlichen Zustand des Islams rechtfertigen zu wollen. Im Gegenteil: Da, wo es angebracht ist, äußern sie sich in aller Schärfe. Aber sie weisen eben auch auf die anderen Faktoren, den politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen Hintergrund, hin. Aus ihrer Sicht sind die theologischen Debatten von den politischen Realitäten kaum zu trennen. Mehr noch: Aus ihrer Sicht bildet der politische Alltag nicht nur den Hintergrund des religiösen Denkens, sondern wirkt direkt und unmittelbar darauf ein. Ich selbst habe darauf verzichtet, in diesem Buch ein Kapitel zu schreiben, das sich mit „dem“ Islam befasst. Viel mehr als auf das, was im Koran steht, so meine Überzeugung, kommt es auf die Intentionen an, mit denen er gelesen und gedeutet wird. Ohnehin sind die Suren des Korans vielfältig auslegbar; sie zu deuten, hat über die Jahrhunderte Generationen von Exegeten beschäftigt.7 Umso mehr kommt es auf die Interessen derer an, die ihre Interpretationen vortragen. Die mögen wissenschaftlich oder politisch motiviert sein, gemäßigten oder fundamentalistischen Strömungen zuarbeiten, reinen Herzens oder mit Hintergedanken dargelegt werden. Eines aber verbindet alle Auslegungen des Korans: endgültig und absolut sind sie, wie alle Interpretationen gleich welcher Texte, nie. Sie sind notwendig beschränkt, werfen auf das nie überschaubare Ganze stets einen mehr oder weniger eingeschränkten Blick. Und immer bleiben sie vorläufig.
Nein, es bringt nichts, einzelne Koranverse hervorzuziehen und aus ihnen auf die Beschaffenheit „des“ Islams (als ob es von ihm nur eine und nicht unendliche viele Varianten gäbe) zu schließen. Viel wichtiger, wie gesagt, ist es, auf die Motive derer zu schauen, die ihn deuten und ihre Deutungen in die Welt tragen. Genau das tut dieses Buch. Es erzählt die Geschichte einer in Unordnung geratenen Welt und der Versuche, diese wieder in Ordnung zu bringen – auch, aber nicht nur, mit Hilfe der Religion. Doch die Religion ist nur eine Art, die Erschütterungen der Region zu bewältigen. Und um sie, die Geschichte dieser Erschütterungen, geht es in diesem Buch vor allem.
Es ist die Geschichte einer Erschütterung, wie sie größer, umfassender – und leider oft auch tödlicher – kaum sein könnte. Es ist eine sehr konkrete, oft genug traurige Geschichte.