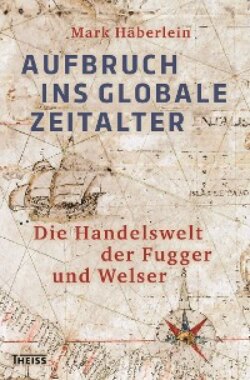Читать книгу Aufbruch ins globale Zeitalter - Mark Häberlein - Страница 9
Eine kurze Geschichte zweier Handelshäuser
ОглавлениеAuch auf dem Höhepunkt ihres Reichtums und Ansehens machten die Fugger kein Hehl daraus, dass sie von einem Weber abstammten, der 1367 aus dem Dorf Graben nach Augsburg gekommen war. Dieser Hans Fugger war allerdings kein armer Mann: Seine erste Zahlung, die das Augsburger Steuerbuch verzeichnet, lässt auf ein gewisses Startkapital schließen, und durch zwei vorteilhafte Ehen konnte er dieses Kapital vermehren. Hans Fugger und seine zweite Frau Elisabeth, die Tochter eines Weberzunftmeisters, erwarben 1397 ein eigenes Haus, und 1408 besaß Fugger etwa 2000 Gulden Vermögen. Bis 1434 konnte seine Witwe dieses auf fast 5000 Gulden steigern.
Nach 1440 treten Hans Fuggers Söhne Andreas und Jakob in Erscheinung. Im Jahre 1448 verfügten sie bereits über das fünftgrößte Vermögen der Reichsstadt. Nach anfänglicher Zusammenarbeit trennten sich ihre Wege: Im Augsburger Steuerbuch von 1453 sind sie erstmals getrennt veranlagt. Andreas Fugger, auf den die Linie der „Fugger vom Reh“ zurückgeht, starb bereits 1457. Die von seinem Sohn Lukas geführte Gesellschaft trieb in den 70er- und 80er-Jahren des 15. Jahrhunderts erfolgreich Fernhandel zwischen Italien, Oberdeutschland und den Niederlanden; Lukas konnte sein Vermögen beträchtlich vermehren und bekleidete verschiedene städtische Ämter. Nach 1480 engagierte sich die Handelsgesellschaft der „Fugger vom Reh“ auch in Finanzgeschäften: Sie überwies Gelder an die Kurie in Rom und erhielt für einen Kredit an Erzherzog Sigismund Anweisungen auf Tiroler Silber. Ende der 1480er-Jahre übernahm Lukas Fuggers Gesellschaft Geldtransfers, die König Maximilian zur Bezahlung von Truppen in den Niederlanden benötigte. Für ein Darlehen in Höhe von 9600 Goldgulden übernahm die Stadt Löwen die Garantie. Als Löwen sich weigerte, diesen Kredit zurückzuzahlen, ging die Firma der „Fugger vom Reh“ bankrott, weil sie selbst viel Fremdkapital aufgenommen hatte und die Gläubiger nun ihre Einlagen zurückforderten.25
Wie sein Bruder Andreas begründete Jakob Fugger eine eigene Handelsgesellschaft, die nach seinem Tod im Jahre 1469 von seiner Witwe Barbara, der Tochter des ehemaligen Münzmeisters Franz Bäsinger, erfolgreich weitergeführt wurde. Nach und nach stiegen auch die Söhne des Paares ins Geschäft ein: zunächst Ulrich (1441–1510), der in der Augsburger Geschäftszentrale tätig war, dann Georg (1453–1506), der sich von Nürnberg aus um die Beziehungen nach Mittel- und Ostdeutschland kümmerte. Nachdem mehrere weitere Brüder jung verstorben waren, trat der Jüngste, Jakob (II.) Fugger (1459–1525) in die Gesellschaft ein. Die Brüder wurden Mitglieder der Augsburger Kaufleutezunft, führten seit den 1470er-Jahren ihr eigenes Wappen mit der Lilie und erlangten durch Heiraten mit angesehenen Bürgerfamilien Zutritt zur Herrentrinkstube, dem exklusiven gesellschaftlichen Treffpunkt der Augsburger Oberschicht.26
Seit Mitte der 1480er-Jahre streckten Ulrich, Georg und Jakob Fugger den Herrschern Tirols große Summen vor, die durch Silber- und Kupferlieferungen aus den reichen Tiroler Bergwerken getilgt wurden. Binnen weniger Jahre stiegen sie zu den wichtigsten Finanziers König Maximilians auf und brachten einen großen Teil der alpenländischen Montanproduktion auf den Markt. Seit 1494 bauten die Fugger zudem mit Hans Thurzo aus Krakau den „Gemeinen Ungarischen Handel“ auf, der die Ausbeutung der Bergwerke von Neusohl (Banská Bystrica) in der heutigen Slowakei sowie Verhüttung und Vertrieb des Neusohler Kupfers organisierte. Dafür errichteten die Fugger spezielle Schmelzwerke (sog. Saigerhütten) in Thüringen und Kärnten und gründeten Niederlassungen in Ofen (Budapest), Leipzig, Breslau, Krakau und Danzig.27
Jakob Fugger der Reiche, aus Fuggerorum et Fuggerarum Imagines … (1618)
Kupferhandel und Kredite an das Haus Habsburg bildeten fortan die beiden zentralen Säulen des Unternehmens. Außerdem waren die Fugger zeitweilig stark in Finanzgeschäften mit der römischen Kurie engagiert: Seit 1495 übermittelten sie Servitien – Abgaben, die bei der päpstlichen Bestätigung eines neu gewählten Bischofs oder Abts anfielen – und Annaten – regelmäßige Abgaben von kirchlichen Ämtern und Pfründen – sowie Kreuzzugssteuern und Ablassgelder aus mittel- und nordeuropäischen Bistümern nach Rom. Nach 1500 gewährten die Fugger den Päpsten auch Kredite, finanzierten Gesandtschaften und unterstützten die Anwerbung Schweizer Söldner (hier liegen die Ursprünge der heutigen Schweizergarde im Vatikan). Sie pachteten zeitweilig die päpstliche Münze und übernahmen den Transfer von Ablassgeldern, der vor allem während des Pontifikats Leos X. (1513–1521) große Ausmaße erreichte. Hinzu kamen Lieferungen von kostbaren Stoffen, Edelsteinen und Luxuswaren an ihre fürstlichen Kunden. Wichtige Faktoren für den Erfolg der Fugger waren, neben den überragenden unternehmerischen Fähigkeiten und dem strategischen Weitblick Jakob Fuggers, ein kompetenter und loyaler Stab von Mitarbeitern in den Faktoreien der Handelsgesellschaft, deren Netz sich über große Teile Europas erstreckte, und der Zugang zu Kapital, das von Mitgliedern der Augsburger Oberschicht und geistlichen Würdenträgern wie dem Brixener Fürstbischof Melchior von Meckau kam.28
Als Maximilian I. 1518 starb, war er der Fuggerfirma rund 350.000 Gulden schuldig. Vor diesem Hintergrund stand außer Frage, dass Jakob Fugger bei der anstehenden Wahl eines Nachfolgers Maximilians Enkel Karl, der bereits Herzog von Burgund und König von Spanien war, unterstützen würde. Karls einstimmige Wahl durch die Kurfürsten im Juni 1519 wurde durch Wahlgelder in Höhe von mehr als 850.000 Gulden ermöglicht, von denen Jakob Fugger mit 543.585 Gulden rund zwei Drittel aufbrachte. Anschließende Vereinbarungen mit Karl V. und seinem Bruder Ferdinand sicherten den Fuggern weiterhin den Zugriff auf Tiroler Silber und Kupfer und ermöglichten ihnen überdies den Einstieg ins Spaniengeschäft. Auch intern stellte Jakob Fugger entscheidende Weichen für die weitere Entwicklung des Unternehmens: Gesellschaftsverträge, die 1502 und 1512 geschlossen wurden, schlossen Frauen und Geistliche aus dem Handel aus, und der kinderlose Firmenleiter machte seine Neffen zu Teilhabern, ohne ihnen allerdings ein Mitspracherecht einzuräumen.29
Anton Fugger, Porträt von Hans Maler von Schwaz (um 1525)
Nach Jakob Fuggers Tod im Jahre 1525 wurde sein Neffe Anton (1493–1560) sein Nachfolger. Eine zwei Jahre später erstellte Firmenbilanz wies Aktiva in Höhe von rund drei Millionen Gulden aus, denen 870.000 Gulden Passiva gegenüberstanden. Nach dem Ableben seines Bruders Raymund (1535) und der Auslösung seines Vetters Hieronymus nahm Anton Fugger 1538 vier Söhne Raymunds als Teilhaber auf, behielt sich aber nach dem Vorbild seines Onkels die alleinige Entscheidungskompetenz vor. Während die Faktorei in Rom nach dem Sacco di Roma – der Plünderung der Ewigen Stadt durch kaiserliche Truppen 1527 – aufgegeben wurde, wurden die Beziehungen zum spanischen König und deutschen Kaiser Karl V. durch zahlreiche weitere Kreditvereinbarungen systematisch gepflegt. Dafür sicherten sich die Fugger Ansprüche auf Einkünfte des Herrschers in Kastilien. Auch Erzherzog Ferdinand, dessen Wahl zum römischen König 1530 das Augsburger Handelshaus ebenfalls finanzierte, gehörte mit Verbindlichkeiten von rund einer Million Gulden im Jahre 1533 zu den größten Schuldnern der Fugger. Diese Schulden wurden weiterhin durch Lieferungen Tiroler Silbers und Kupfers, daneben durch Einkünfte Ferdinands aus dem Königreich Neapel bedient. Anton Fugger war aber nicht ausschließlich Finanzier der Habsburger, sondern vergab auch Darlehen an die Könige von Portugal, Dänemark und England sowie an den Großherzog der Toskana. Eine wichtige Zäsur stellte seine 1546 getroffene Entscheidung dar, den ungarischen Handel angesichts rückläufiger Erträge und steigender Risiken aufzugeben. Um diese Zeit überlegte Anton Fugger sogar, die Handelsgesellschaft, die damals mit Aktiva von über sieben Millionen Gulden und Passiva von rund zwei Millionen Gulden ihren Zenit erreicht hatte, komplett zu liquidieren. Aufgrund des starken Engagements in Tirol, Spanien und den Niederlanden ließen sich diese Pläne jedoch nicht realisieren.30
Nach Anton Fuggers Tod 1560 trat dessen Neffe Hans Jakob (1516–1575) ein schwieriges Erbe an: Riskante Finanzgeschäfte in Antwerpen hatten das Handelshaus 1557 in eine Krise gestürzt. Die Schulden der spanischen Krone beliefen sich 1563 auf drei Millionen Dukaten. Das Handelshaus war mittlerweile stark auf Fremdkapital angewiesen, und das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital stellte sich ungünstig dar. Zudem konnte Hans Jakob Fugger seine hohen privaten Schulden nicht mehr bezahlen; er verließ Augsburg, begab sich nach München, wo er zu einem der engsten Berater Herzog Albrechts V. aufstieg, und schied 1564 aus der Handelsgesellschaft aus. In der Folgezeit wurde die Eigenkapitalbasis durch weitere Auszahlungen geschmälert. Christoph Fugger kehrte der Firma 1572 den Rücken, und 1578 verließen auch die Erben Georg Fuggers, der bis zu seinem Tod 1569 neben Marx Fugger die Geschäfte geführt hatte, die Gesellschaft, um ein eigenes Unternehmen zu gründen. Am „Gemeinen Handel“ der Fugger waren danach nur noch Anton Fuggers Söhne Marx, Hans und Jakob beteiligt, wobei Marx als „Regierer“ fungierte und sein Bruder Hans ihn bei der Führung der Geschäfte unterstützte.31
Trotz dieses Aderlasses gelang es Marx Fugger, der bis Mitte der 1590er-Jahre die Geschicke des Unternehmens lenkte, durch Restrukturierung, Kostensenkung und Konsolidierung das Stammkapital zu erhöhen und die Abhängigkeit von Fremdmitteln zu verringern. Zahlreiche Niederlassungen – darunter einst wichtige Faktoreien wie Venedig – wurden aufgegeben. Stattdessen ließen die Fugger ihre Interessen an diesen Plätzen von Kommissionären wahrnehmen, die auf Provisionsbasis arbeiteten. Eigene Niederlassungen hatte das Handelshaus um 1575 lediglich noch in Madrid, Almagro, Antwerpen, Nürnberg und am Kaiserhof in Wien bzw. Prag; infolge des Krieges in den Niederlanden wurde 1576 die Antwerpener Faktorei nach Köln verlagert. Wichtigstes Standbein der Gesellschaft unter der Leitung Marx Fuggers wurde die Maestrazgopacht (s. Kapitel 5) mit dem Quecksilberbergwerk von Almadén. Die dort erwirtschafteten Gewinne versetzten die Fugger in die Lage, den spanischen und österreichischen Habsburgern weiterhin große Darlehen zu gewähren.32
Marx Fugger, Kupferstich von Dominicus Custos, aus: Iconem Deces (1592)
Obwohl die Fugger in der europäischen Geschäftswelt noch immer einen guten Namen hatten, wurde die Lage ihres Handelshauses seit der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert zunehmend problematischer. Nach Marx Fuggers Tod 1597 machten seine Söhne seinem Bruder und Nachfolger Hans die Firmenleitung streitig. Im Laufe der Zeit schieden mehr und mehr Teilhaber aus und zogen ihr Kapital ab. Nach 1600 hatte keiner der Teilhaber mehr eine kaufmännische Ausbildung genossen, und wichtige Aufgaben wurden Angestellten übertragen. Die Geschäfte in Spanien gestalteten sich angesichts rückläufiger Edelmetallimporte aus Amerika, einer tiefen Wirtschaftskrise und der desolaten Finanzlage des Staates immer schwieriger. 1645 gaben die Fugger den spanischen Handel endgültig auf. Der Niedergang der Tiroler und Kärntner Montanunternehmungen, der sich bereits im späten 16. Jahrhundert abzeichnete, wurde durch den Dreißigjährigen Krieg weiter beschleunigt, und bis 1657 wurden auch diese Unternehmensteile aufgegeben.33
Von anderer Herkunft waren die 1246 erstmals in Augsburg belegten Welser. Sie gehörten zu den „alten Geschlechtern“, das heißt sie waren eine der ältesten Augsburger Patrizierfamilien. Als Fernhändler treten sie allerdings erst zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Erscheinung: Bartholomäus (III.) Welser (gest. 1446) arbeitete zunächst für die Handelsgesellschaft seines Stiefbruders Lorenz Egen, machte sich aber um 1414 gemeinsam mit seinem Schwager Hans Prun als Kaufmann selbstständig. Die Welser-Prun-Gesellschaft, die Bartholomäus Welser nach dem Tod seines Schwagers 1424/25 allein weiterführte, importierte Baumwolle aus Venedig und vertrieb Augsburger Barchenttuche auf den Frankfurter Messen. In den 1460er-Jahren führten die Brüder Bartholomäus (IV.), Ulrich, Jakob und Lukas Welser eine Familienhandelsgesellschaft, in der Bartholomäus die Geschäfte von Augsburg aus lenkte, Jakob die Beziehungen nach Köln und in die Niederlande pflegte und Lukas für Italien zuständig war. In den 1470er-Jahren investierte die Welser-Gesellschaft auch in den sächsischen Bergbau und intensivierte ihre Kontakte nach Ostmitteleuropa. Die Heirat von Lukas Welsers Sohn Anton (I., 1451–1518) mit einer Tochter des Memminger Großkaufmanns Hans Vöhlin im Jahre 1479 bildete die Grundlage einer engen Zusammenarbeit beider Firmen: Anton Welser siedelte nach Memmingen über und übernahm die Rolle eines „Juniorchefs“ in der Handelsgesellschaft seines Schwiegervaters. Die enge Kooperation zwischen den Augsburger Welser und den Memminger Vöhlin, die durch die Heirat zwischen Hans Vöhlins Sohn Konrad und Anton Welsers Schwester Barbara 1487 sowie durch die Rekrutierung von Teilhabern und Angestellten aus dem Kreis der Welser und ihrer Verwandten gefestigt wurde, mündete nach Hans Vöhlins Tod im Herbst 1496 in die Gründung der Handelsgesellschaft „Anton Welser, Konrad und Mitverwandte“, die damit als Nachfolgerin der Memminger Vöhlin-Gesellschaft anzusehen ist.34
Noch im Gründungsjahr dieser Gesellschaft zog Anton Welser wieder in seine Geburtsstadt Augsburg und schloss 1498 einen Steuervertrag mit dem Rat der Stadt, während er sein Memminger Bürgerrecht behielt.35 Damit verlagerte sich auch der Schwerpunkt der Firma nach Augsburg, das um diese Zeit die anderen schwäbischen Reichsstädte als Handels- und Gewerbezentrum zunehmend überflügelte.36 Die „alte“ Augsburger Welser-Gesellschaft dürfte bereits nach dem Tod von Anton Welsers Vater Lukas liquidiert worden sein.37
Nach Aufzeichnungen aus dem Jahre 1508 war die Welser-Vöhlin-Gesellschaft ein Zusammenschluss einer größeren Zahl von Familien, die untereinander verwandt bzw. verschwägert waren. Die damals 18 stimmberechtigten Teilhaber kamen aus den Familien Welser, Vöhlin, Lauginger, Pfister, Haintzel, Reihing, Imhoff, Honold, Seitz und Rem.38 Anton Welser und Konrad Vöhlin waren nicht nur die namensgebenden Gesellschafter, sondern leiteten auch die Geschäftszentralen in Augsburg und Memmingen. Spätestens nach dem Tod Konrad Vöhlins 1511 verlor Memmingen allerdings seine Funktion als zweite Zentrale und sank auf den Status einer Faktorei herab, die der Augsburger Zentrale untergeordnet war. Faktoreien – deren Leiter (Faktoren) eine feste Besoldung erhielten und gegenüber der Firmenzentrale rechenschaftspflichtig waren – als dauerhafte Niederlassungen an einem Ort waren die wichtigsten Organisationseinheiten süddeutscher Handelsgesellschaften im 16. Jahrhundert. An Orten, an denen sie keine Faktoreien unterhielten, nahmen die Handelshäuser die Dienste von Kommissionären in Anspruch, die häufig selbstständige Kaufleute waren und Geschäfte für verschiedene Auftraggeber erledigten.39
Um 1500 sind für die Welser-Gesellschaft 17 Faktoreistandorte nachweisbar, von denen zehn im süddeutsch-schweizerischen Raum lagen. Diese räumliche Konzentration weist auf das starke Engagement der Firma im Handel mit Textilien hin: So bestanden Faktoreien in schwäbischen Textilzentren wie Ulm, Kempten, Biberach und Ravensburg. Ulm war zugleich ein wichtiger Umschlagplatz im Handel zwischen Oberdeutschland und Italien; über Lindau und St. Gallen führten die Handelswege in die Wirtschaftszentren Mailand und Lyon. Darüber hinaus hatte die Gesellschaft eigene Vertretungen in Venedig, Köln, Antwerpen und Wien.40
In den folgenden eineinhalb Jahrzehnten vollzog sich eine Expansion des Handelsnetzes der Welser-Gesellschaft: Neue Faktoreien entstanden in Leipzig, Brünn, Como, Genua, Rom, Saragossa, Lissabon und auf Madeira. Langfristig bedeutsam war vor allem die Etablierung auf der Iberischen Halbinsel: Nach der Gründung einer Niederlassung in Lissabon 1503 schalteten sich die Welser-Vöhlin in den Asienhandel ein und beteiligten sich 1505 und 1506 an Indienfahrten. Saragossa war ein Zentrum des Safran- und Pastellhandels und Como ein wichtiger Standort der Textilproduktion. Wie im Fall der Fugger diente die Faktorei der Welser in Rom in erster Linie Geldgeschäften mit der Kurie. Festzuhalten ist jedoch, dass sich die Geschäftsfelder der Fugger und Welser im frühen 16. Jahrhundert deutlich unterschieden: Während Erstere sich auf Kupfer- und Silberhandel sowie Finanzgeschäfte konzentrierten, handelten Letztere mit einem breiten Sortiment an Gütern wie Textilien, Farbstoffen, Gewürzen, aber auch Metallen, Leder und Zucker.41
Bartholomäus (V.) Welser, Kupferstich von Georg Christoph Eimmart, spätes 17. Jahrhundert
Die Ende 1517 vorgenommene Generalrechnung sowie der Tod des Firmenleiters Anton Welser im folgenden Jahr leiteten eine Umstrukturierung ein: Mehrere Teilhaber, darunter Anton Welsers Bruder Jakob, schieden aus der Gesellschaft aus, an deren Spitze Bartholomäus Welser (V., 1484–1561) trat. Damit näherte sich die Organisationsstruktur der Welserfirma derjenigen der Fugger an: Sie umfasste nun einen deutlich kleineren Teilhaberkreis – zu dem Bartholomäus Welsers Bruder Anton (II.) und Hans Vöhlin gehörten – und wurde von einem starken „Regierer“ gelenkt. Das Ausscheiden von Teilhabern wurde, wie im Fall der Fugger, durch die Aufnahme von festverzinslichem Depositenkapital, vor allem seitens Verwandter und Familien der städtischen Oberschicht, ausgeglichen. Jakob Welser gründete in Nürnberg ein eigenes, zeitweilig sehr erfolgreiches Handelshaus, das eine wichtige Rolle im mitteldeutschen Saigerhandel spielte und nach seinem Tod 1541 von seinen Söhnen weitergeführt wurde.42 Im Jahre 1535 engagierte sich Jakob Welser sogar in einem Amerikaunternehmen: Gemeinsam mit dem Augsburger Kaufmann Sebastian Neidhart rüstete er ein Schiff der Flotte Pedro de Mendozas aus, die zur Eroberung des Gebiets um den Rio de la Plata im heutigen Argentinien aufbrach.43
Seit Mitte der 1520er-Jahre ist eine Verlagerung der Schwerpunkte der Augsburger Welserfirma erkennbar: Während das Textilgeschäft im oberdeutsch-schweizerischen Raum reduziert wurde und Faktoreien wie Memmingen, Kempten und St. Gallen aufgegeben wurden, intensivierte Bartholomäus Welser, der neben Jakob Fugger einen maßgeblichen Beitrag zur Kaiserwahl Karls V. 1519 geleistet hatte, die Beziehungen nach Spanien. Die Welser-Gesellschaft avancierte zu einem der wichtigsten Finanziers Karls V. und war von 1528 bis 1537 an der Pacht der Ländereien der spanischen Ritterorden beteiligt. Das Spaniengeschäft wurde von einer Faktorei am spanischen Hof aus koordiniert; daneben gewann die Faktorei Sevilla zeitweilig große Bedeutung. Der Zahlungsverkehr zwischen dem spanischen Hof, Sevilla, Lyon und Antwerpen lief häufig über die kastilischen Messen. Die Errichtung einer Faktorei auf der Karibikinsel Hispaniola 1526 und die Übernahme der Statthalterschaft über die südamerikanische Provinz Venezuela zwei Jahre später sind im Kontext dieses starken Engagements in Spanien zu sehen. Darüber hinaus investierten die Welser in den 1520er-Jahren in den böhmischen und sächsischen Kupfer- und Zinnbergbau.44
Während die Fugger angesichts ihrer starken Bindung an das Haus Habsburg keine feste Niederlassung in Frankreich unterhielten, waren die Faktoreien der Welser in Lyon und Toulouse stark im Safran- und Pastellgeschäft engagiert. Darüber hinaus scheuten sie sich nicht, der Krone Frankreichs Darlehen zu gewähren, obwohl diese der Hauptgegenspieler Karls V. in der europäischen Mächtepolitik war und mehrere Kriege gegen diesen führte. Bei französischen Kronanleihen, aber auch bei Warengeschäften und Finanzdienstleistungen arbeiteten die Welser in Lyon jahrzehntelang mit dem Florentiner Handelshaus Salviati zusammen.45
Bartholomäus Welser hatte seinem Schwiegersohn Hieronymus Sailer, der sich bei riskanten Finanzgeschäften zwischen Lyon und Antwerpen verspekuliert hatte, finanziell unter die Arme gegriffen. Daraufhin schied sein Bruder Anton, der mit dieser Stützungsmaßnahme nicht einverstanden gewesen war, im Herbst 1551 aus. Nachdem in den Jahren zuvor bereits andere langjährige Teilhaber wie Hans Vöhlin die Gesellschaft verlassen hatten, leitete Anton Welsers Schritt einen Generationswechsel ein: Auch Bartholomäus Welser selbst zog sich nun aus dem aktiven Geschäftsleben zurück und übergab die Leitung seinem Sohn Christoph. Von 1551 bis 1580 firmierte das Familienunternehmen unter dem Namen „Christoph Welser und Gebrüder“ bzw. „Christoph Welser und Gesellschaft“. Neben Christoph Welsers Brüdern Hans und Leonhard, der allerdings bereits 1557 starb, gehörten dieser Firma zeitweilig auch Christophs Vettern Matthäus und Marx Welser sowie weitere Verwandte an.46
In den 1550er-Jahren war der Umfang der Warengeschäfte – insbesondere mit Textilien, Gewürzen und Farbstoffen –, des Kommissionsgeschäfts sowie der Finanztransaktionen in den Niederlanden noch sehr beträchtlich. Zugleich nahm die Christoph-Welser-Gesellschaft interne Umstrukturierungen vor, modernisierte ihre Buchhaltung und gab eine Reihe von Faktoreien zugunsten einer Vertretung durch Kommissionäre auf. Ende der 1550er-Jahre bestanden neben der Augsburger Zentrale noch Niederlassungen in einem Dutzend Städten – unter anderem in Ulm, Nürnberg, Antwerpen, Venedig, Lyon, Saragossa, Valladolid und Lissabon.47
In den folgenden Jahrzehnten reduzierte sich die Eigenkapitalbasis durch das Ausscheiden mehrerer Teilhaber erheblich. Seit 1580 war keiner der Söhne Bartholomäus Welsers mehr an der Handelsgesellschaft beteiligt, die nun unter dem Namen „Marx und Matthäus Welser“ firmierte. Ihr Einstieg in den portugiesischen Gewürzeinkauf in Asien 1585 suggeriert zwar eine unverminderte Leistungsfähigkeit; tatsächlich überdehnte die Gesellschaft damit jedoch ihre Kräfte. Forderungen aus Kreditgeschäften in den Niederlanden, in Spanien und im Heiligen Römischen Reich erwiesen sich als uneinbringlich. Die Übernahme des Reichspfennigmeisteramtes durch Matthäus Welser im Jahre 1603 verschlimmerte die ohnehin prekäre Lage noch zusätzlich, weil der Inhaber dieses Amtes die vom Reichstag bewilligten Türkensteuern vorfinanzieren musste. Da sich Matthäus Welser und seine Brüder Marx und Paul zudem stark auf ihre gelehrten Interessen und ihre Ämter – Marx bekleidete das höchste reichsstädtische Amt des Stadtpflegers, Paul das Amt des Baumeisters – konzentrierten, wurde die Geschäftsleitung vernachlässigt. Nachdem 1614 Wechsel in Frankfurt geplatzt waren, brach die Welser-Gesellschaft unter der Last ihrer Schulden zusammen. Während Marx Welser kurz vor dem Bankrott verstorben war, verbrachten Matthäus und Paul viele Jahre in Schuldhaft.48 Der von Jakob Welser begründete Nürnberger Zweig der Familie hatte sich zu dieser Zeit bereits aus dem aktiven Handelsgeschäft zurückgezogen.