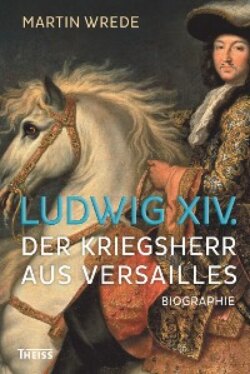Читать книгу Ludwig XIV. - Martin Wrede - Страница 12
Die Regierungsübernahmen Ludwigs XIV.
ОглавлениеSucht man den Anfang von Ludwigs Regierungszeit zu bestimmen, so verfügt man zumindest formal über eine gewisse Auswahl an möglichen Daten. Natürlich ist zuerst der 14. Mai 1643 zu nennen, der Tag, an dem der Vater starb und – der Tod setzte nach französischer Verfassungstradition den Nachfolger unmittelbar ins Amt ein – die Krone an den Sohn überging. Sodann der 5. September 1651, als Ludwig mit dem Eintritt ins vierzehnte Lebensjahr für volljährig erklärt wurde – ein Schachzug, der die Autorität der Krone gegenüber den Frondeuren hatte erhöhen sollen. Allerdings blieben die Königin-Mutter und der Kardinal-Premier weiterhin die entscheidenden Persönlichkeiten im Rat, regierten nach wie vor in des Königs Namen. Wichtiger, zumindest symbolisch, war daher vielleicht der 7. Juni 1654, der Tag von Ludwigs Krönung und Salbung in der Kathedrale von Reims. In früheren Jahrhunderten war dies noch der entscheidende Rechtsakt und Übergangsritus gewesen, der den König eigentlich erst zum König gemacht hatte. Im 17. Jahrhundert war das nicht mehr der Fall, und bis ans Ende des Ancien Régime sollte die Legitimationskraft von Krönung und Salbung weiter nachlassen. Zumindest bis zu Ludwig XV. blieb sie freilich beachtlich.35
In diesen Jahren, nach Volljährigkeit und Krönung, etablierte sich eine Art Triumvirat an der Staatsspitze, allerdings unter Einbeziehung von nur zwei Männern: Ludwigs und Mazarins. Der dritte „Mann“ war die Königin-Mutter. Sie saß dem königlichen Rat weiter vor, doch ihr tatsächlicher Einfluss ging spätestens gegen Ende der 1650er-Jahre deutlich zurück. Seit 1658 wohnte der König den Ratssitzungen regelmäßig bei. Bis dahin war er das politische Instrument Mazarins und der Königin-Mutter gewesen. Doch dies konnte so nicht bleiben, und Anna von Österreich strebte es auch gar nicht an. Sie dürfte dabei wohl das warnende Beispiel ihrer Vorgängerin in der Rolle der ehemaligen Regentin vor Augen gehabt haben, nämlich der Maria de Medici. Diese hatte fast vierzig Jahre zuvor mehr als einmal versucht, das Heft bzw. die Regierungsgeschäfte in der Hand zu behalten und ihren Sohn, Ludwig XIII., fortdauernd zu dominieren. Sie war damit, nach Querelen, Aufruhr und Bürgerkrieg, fulminant gescheitert. 1631 hatte sie Frankreich verlassen, einige Jahre später war sie im Kölner Exil gestorben.36
Anders als Maria de Medici räumte Anna daher nach der Eheschließung ihres Sohnes den zeremoniell zweiten Platz am Hofe zugunsten von dessen Gemahlin, und auch ihrer eigenen allmählichen Marginalisierung in den Entscheidungsprozessen, die von Ludwig und Mazarin ausging, setzte sie keinen echten Widerstand entgegen.37 Mazarin führte Ludwig systematisch in die Staatsgeschäfte ein, bereitete mit ihm die Sitzungen und Beschlüsse des königlichen Rates vor. Die Königin-Mutter wurde nicht mehr zwangsläufig einbezogen. Dass es insofern tatsächlich ein Duumvirat, eine Zwei-Männer-Herrschaft, gewesen war, die Frankreich schließlich unter Annas Ratsvorsitz regiert hatte, wurde deutlich, als Ludwig nach Mazarins Tod am 9. März 1661 erklärte, fortan selbst herrschen zu wollen, ohne Ersten Minister. Solange sein Pate und Mentor lebte, hatte Ludwig ihn gewähren lassen. Sein Tod war der Auslöser für die auch offizielle Neuverteilung der Macht. Und der König regierte nun auch formal ohne seine Mutter: Anna von Österreich wurde gezwungen, den reorganisierten königlichen Rat zu verlassen – dies zwar sehr zu ihrer Erbitterung, aber eben doch ohne politischen Konflikt.38 Und nun erst begann die eigentliche, die Selbstregierung Ludwigs XIV. Und mit ihr das Grand Siècle, das „Große Jahrhundert“. Es ließe sich auch als „Jahrhundert der Größe“ verstehen – zumindest der königlichen Größe.