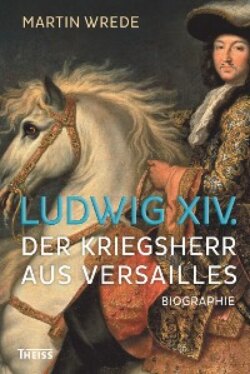Читать книгу Ludwig XIV. - Martin Wrede - Страница 14
II.
Wege zum frühen Ruhm – Krieg und Politik bis zum Nimweger Frieden Grundlagen
ОглавлениеDas 1966 erschienene Buch des Sozialhistorikers Pierre Goubert, „Louis XIV et vingt millions de Français“,1 ist einer der Marksteine der französischen Geschichtswissenschaft des 20. Jahrhunderts. Es brachte zwei zentrale Änderungen in der Perspektive auf den „Großen König“: Wesentlich war bereits, dass sich Goubert seinem „Helden“ bzw. dem Thema nicht mehr mit der bis dahin üblichen Unterwürfigkeit näherte. Er hinterfragte Motive und benannte Fehler. Zuweilen fällte er harsche Urteile. Noch wichtiger aber – kritische Stimmen gab es immerhin seit jeher in anderen Sprachen als dem Französischen – war vielleicht, dass Goubert Ludwig XIV. in unmittelbare Beziehung setzte zu dem von ihm regierten Land und zu den „20 Millionen Franzosen“, die es ausmachten. Ohne sie hätte es den „Großen“ bzw. den „Größten aller Könige“ schlechterdings nicht gegeben.
Der wichtigste Hinweis steckte dabei bereits im Titel: Demographisch war Frankreich ein Riese unter den europäischen Mächten. Die Einwohnerzahl Spaniens lag am Ende des 17. Jahrhunderts unter 8 Millionen, die Englands unter 6 Millionen, die Schwedens oder der Niederlande bei 2 Millionen. Das römisch-deutsche Reich besaß nach dem Dreißigjährigen Krieg wohl noch etwa 16 bis 17 Millionen Einwohner, die allerdings bekanntlich nicht allein dem Kaiser Gehorsam schuldeten. Die Einwohnerzahl der kaiserlichen Erblande und -königreiche lag, für sich genommen, wohl zwischen jener Englands und der Spaniens. Für ihren König bedeuteten diese 20 Millionen Franzosen die wichtigste aller Ressourcen. Die Zahl selbst ist dabei nicht einmal besonders genau, denn sie wurde erst im Laufe von Ludwigs Regierungszeit durch Ausdehnung der französischen Grenzen erreicht. Gouberts Buch hat sie allerdings emblematisch gemacht. Doch auch das Frankreich von 1650 zählte bereits ebenso viele Menschen – 17 Millionen – wie das erheblich größere römisch-deutsche Reich.
Die hohe Bevölkerungszahl resultierte aus den vergleichsweise vorteilhaften Bedingungen eines meist fruchtbaren, vielfältigen Agrarlandes. Île de France, Burgund, die Normandie, auch große Teile des Südens waren einigermaßen prosperierende Regionen. Die großen Hafenstädte an der Küste strahlten auf ihr Umland aus. Verkehrswege waren unzulänglich, aber weniger unzulänglich als anderwärts. Und doch sollte dies kein uneingeschränkt vorteilhaftes Bild erzeugen: Die Lebensbedingungen der Landbevölkerung waren natürlich allermeist mäßig bis miserabel, die Wirtschaftsmethoden rückständig. Hungerkrisen zeigten sich immer wieder und forderten einen hohen Tribut, wenn sie auch nie das Land im Ganzen erfassten. Wohlstand und ökonomischer Fortschritt waren in jener Zeit nicht in Frankreich zuhause, sondern in den Niederlanden. Metalle und Waffen mussten zum Großteil von jenseits der Grenzen eingeführt werden, denn Bergbau und Montanwirtschaft gab es im Königreich kaum. Überseeische Unternehmungen waren in unregelmäßiger Folge eingeschlafen, gescheitert oder hatten nur zu bescheidenen Ergebnissen geführt – etwa in Kanada –, die dem Mutterland nicht wirklich Gewinn brachten. Und doch war das relativ dicht besiedelte, relativ gut erschlossene, fruchtbare Land Frankreich eine Kraftquelle erster Ordnung. Es sollte auch höchsten Belastungen standhalten – wie eben der Herrschaft Ludwigs XIV.2
Regiert wurde das Land vom Prinzip her und in der Tiefe gleichfalls recht traditionell. Die „Zentralisierung“ Richelieus und das Scheitern der Fronde hatten der hochadeligen Autonomie die Grundlage entzogen, den Ambitionen der amtsadeligen Richter die Spitze genommen, doch ohne oder gar gegen den Adel war das Land schlechterdings nicht zu regieren. Auch städtische Autonomien bestanden fort – in bescheidenerem Umfang freilich als etwa im römisch-deutschen Reich – und erhebliche Unterschiede zwischen den Provinzen blieben bestehen: Es gab Provinzen, die eigene Ständeversammlungen besaßen, mit denen der Monarch seine Forderungen – etwa die nach Steuern – auszuhandeln hatte, es gab Provinzen, die zwar über keine Ständeversammlung, aber über ein eigenes parlement verfügten, mit dem die Krone gleichfalls rechnen musste, denn die Pariser Jurisdiktion erstreckte sich keineswegs über ganz Frankreich. Und es gab Provinzen, die das alles nicht hatten, wodurch sie aber nicht zwangsläufig leichter zu regieren waren. In jedem Fall mussten königliche Entscheidungen, Forderungen, Gesetze vor Ort von den lokalen Instanzen durchgesetzt werden. Im Normalfall waren das Adel, Amtsträger und städtische Patriziate, auch die Kirche wäre nicht zu vergessen.3
Adel und Patriziate bzw. Adel und Beamtenschaft lassen sich dabei noch viel weniger klar trennen, als dies etwa im deutschen Raum der Fall war, d.h. im Grunde gar nicht. Zwangsläufig besetzte die städtische Oberschicht die vor Ort und in dessen Umkreis jeweils verfügbaren Ämter, es mochten städtische oder königliche sein. Die meisten dieser Ämter – zumal der königlichen – waren nun erstens Kaufämter, d.h. sie gingen ins Eigentum des Erwerbers über, der damit auch nicht mehr absetzbar war. Sie konnten i.d.R. mit geringem Aufwand vererbt werden, d.h. gegen eine Gebühr. Und sie erhoben zweitens den Erwerber oder doch dessen Erben in den Adelsstand. Die Inhaber bildeten den sogenannten Amtsadel, der vom qua Geblüt legitimierten Schwertadel zwar oft geschmäht, ebenso oft aber auch geheiratet wurde, und der sich diesem in vielem anzugleichen suchte, etwa in Lebensführung und Selbststilisierung. Oder der dafür zumindest dessen Elite in den Blick nahm, denn geringer, verarmter Landadel wurde weder am Hof noch in der Stadt sonderlich ernst genommen. Die Spitzen des Amtsadels hingegen verfügten gerade in der Hauptstadt Paris über erhebliches soziales wie auch politisches Gewicht.4
Diese Amtsträger waren nun, ebenso wie der landgesessene Schwertadel, ausführende Organe der königlichen Zentralgewalt, noch mehr aber deren Herrschaftspartner, denn ohne ihre Mitwirkung gab es kaum Durchgriffsmöglichkeiten. Und Sanktionsmöglichkeiten ihnen gegenüber gab es gleichfalls nur wenige. Dafür sorgte der Eigentumscharakter der Kaufämter. Hiermit musste auch Ludwig XIV. rechnen – und dies in doppelter Hinsicht: Der Ämterhandel war eine der Haupteinnahmequellen der Krone und er sollte es bleiben.
Neben diese traditionellen Amtsträger trat freilich im 17. Jahrhundert ein Beamter neuen Typs: der eines nur seinem Auftrag und Auftraggeber verpflichteten „Kommissars“, aus fürstlicher Machtvollkommenheit nominiert und natürlich dementsprechend auch wieder abberufbar. Dieser sollte gerade unter Ludwigs Herrschaft großes Gewicht erlangen. Seine Etablierung war allerdings ein allmählicher Prozess, und quantitativ handelte es sich um eine vergleichsweise kleine Gruppe. Die Abhängigkeit der Krone von Amtsträgern und Ämterhandel relativierten Kommissare bzw. Intendanten also nur in Maßen.5
Auch die Finanzverfassung des Staates war verwickelt, weder von Effizienz noch von Rationalität bestimmt. Zwar überwogen die Einkünfte des Königs von Frankreich die seiner jeweiligen Nachbarn und Gegner deutlich. 20 Millionen Franzosen (oder auch nur 17 …) produzierten mehr Güter, zahlten mehr Steuern und Abgaben als 8 Millionen Spanier oder 6 Millionen Engländer. Auch waren die Steuern hier leichter auszuschreiben als unter anderen Kronen. Nur in den Provinzen mit eigener Ständeversammlung bedurfte es dafür Verhandlungen, in den übrigen konnte der Souverän seine Forderungen ohne weitere Abstimmung erheben, ganz und gar aus eigenem Recht. Allerdings machte das das Eintreiben nicht leichter, denn Steuern, die in einem ständischen Verhandlungsprozess bewilligt waren, besaßen eine höhere Legitimität als jene, die ein solches Verfahren nicht durchlaufen hatten. Die „Steuerfreudigkeit“ der Bürger hing durchaus davon ab. Natürlich gab es auch unterschiedliche Steuerregime für die Provinzen – direkte Kopfsteuern und indirekte Abgaben. Natürlich gab es unendliche Ausnahmen – namentlich, wenn auch nur in begrenztem Maße, für Adel und Kirche. Und dass das eigentliche Eintreiben bzw. Abliefern des Geldes ineffektiv, unzuverlässig und zeitraubend verlief, versteht sich gleichfalls von selbst.6 Damit „Staat zu machen“, den frühneuzeitlichen Kriegs- und Machtstaat aufzubauen, war nicht einfach.7 Und doch boten sich hier dem König von Frankreich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts andere Möglichkeiten als etwa dem König von Schweden oder dem römisch-deutschen Kaiser, deren Mittel weitaus bescheidener waren. Der König von Spanien war nach 1659 kein Konkurrent mehr, der König von England war noch keiner – er hatte ja überhaupt erst 1660 seinen Thron wiedererlangt. Allerdings gab es natürlich noch die Niederländische Republik, mochte deren Bevölkerung auch nur ein Zehntel der französischen ausmachen. Die wirtschaftliche und finanzielle Basis dieses Konkurrenten sollte sich bald als beachtlich erweisen.8