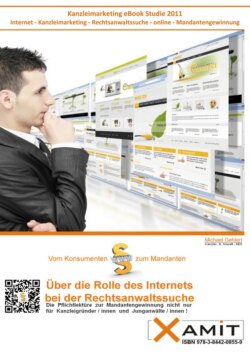Читать книгу Vom Konsumenten zum Mandanten - Michael Gehlert - Страница 7
3.1 Markthintergrund: Was nun, Herr Anwalt?
ОглавлениеEine politische Fernsehsendung, in der Politiker befragt werden, mit welchen Konzepten sie auf neue politische oder wirtschaftliche Situationen oder Krisen reagieren wollen, leiten die Journalisten stets mit der plakativ-kurzen Frage „Was nun, …?“ ein.
Auf ähnliche Krisen müssen heutzutage viele Anwälte eine Antwort finden, denn ihre berufliche Situation hat sich in den letzten 15 Jahren dramatisch gewandelt. Allein im kurzen Zeitraum zwischen 1996 und 2011 stieg die Zahl der in Deutschland zugelassenen Anwälte um fast das Doppelte von ca. 79.000 auf rund 156.000.
Abbildung 1: Rasanter Anstieg der zugelassenen Rechtsanwälte in Deutschland. Quelle: www.handelsblatt.de
Enthalten sind darin auch die Zulassungen von Anwälten, die ihre Qualifikation in einem anderen EU-Land erworben haben, aber auf dem deutschen Markt tätig sind. Seit dem Jahre 2000 ist ihre Zahl kontinuierlich von 127 auf 351 angewachsen.
Seit dem Sommer 2007 können Rechtsanwälte vor allen deutschen Landgerichten und Oberlandesgerichten auftreten. Oasen der Alleinstellung z.B. durch die früher begrenzte Zulassung für ein bestimmtes OLG sind daher weggefallen. Auch dieser Faktor trägt zum Wettbewerbsdruck bei.
Die explosionsartig gestiegene Zahl von Wettbewerbern beeinflusste auch die Umsatz- und Einkommensentwicklung der Anwälte. Die Umsätze stagnieren seit Jahren und erreichten erst in 2008 wieder das Niveau von 1999.
Das Einkommen von Anwälten in Einzelkanzleien sinkt stetig. Nach einer Untersuchung des Nürnberger Instituts für freie Berufe betrug der Jahresgewinn eines Anwalts in den alten Bundesländern im Jahre 2004 durchschnittlich 45.000 Euro. Macht man sich deutlich, dass im Jahr 2004 in Deutschland noch rund 30.000 weniger Anwälte als in 2010 miteinander konkurrierten, kann man erahnen, wohin die Reise für Einzelkämpfer gehen mag.
Zwar ist das gesamte Volumen des Rechtsdienstleistungsmarkts in Deutschland in den 11 Jahren zwischen 1996 bis 2007 von rund 10 Mrd. auf rund 17 Mrd. Euro gestiegen, doch profitierten von dieser Entwicklung am meisten die Großkanzleien mit 100 und mehr Mitarbeitern. Für Kanzleien mit bis zu 9 Mitarbeitern wurden in diesem Zeitraum dagegen leicht sinkende Umsatzanteile ermittelt. Viel spricht dafür, dass die Gewinne der Anwälte in kleinen Kanzleien in der Zwischenzeit weiter geschrumpft sind.
Während sich die Klienten der großen Sozietäten überwiegend aus Firmenkunden rekrutieren, haben es die kleineren Kanzleien überwiegend mit Normalbürgern zu tun. Sie müssen sich mit den rechtlichen Alltagsproblemen aus dem Bau-, Familien-, Erb-, Kauf-, Miet- und Verkehrsrecht auseinandersetzen. Dies kann man auch an der überproportionalen Zunahme der Fachanwälte im Bereich Arbeits- und Sozialrecht ablesen.
Auf dem umkämpften Markt der rechtlichen Dienstleistungen sind die Anwälte - ökonomisch gesehen - nur „normale Wirtschaftssubjekte“. Als solche müssen sie sich den Regeln des wirtschaftlichen Wettbewerbes anpassen. Dieser ist geprägt durch dynamisch ablaufende Prozesse: Neue Produktionsmethoden werden entwickelt, neue Dienstleistungen auf den Markt gebracht, neue Absatzwege erkundet und neue Werbemaßnahmen lanciert. Für Phlegmatiker ist dort kein Platz. Sie scheiden sang- und klanglos aus dem Wettbewerb aus.
Auf den Dienstleistungsmärkten nehmen rechtliche Leistungen eine Sonderstellung ein: Sie hängen von den existierenden Gesetzen ab. Diese können zur Erhöhung der Nachfrage nicht ständig variiert oder neue geschaffen werden. Eine Nachfrage entsteht vielmehr erst dann, wenn bei einem potentiellen Mandanten ein rechtliches Risiko bereits eingetreten ist oder erwartet wird. Der Anwalt kann darauf im Regelfall nur reagieren. Will er, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, seine Handlungsparameter verändern, bleibt ihm – anders als dem Anbieter eines Produkts oder einer anderen „normalen“ Dienstleistung – nur eine sehr geringe Auswahl an Möglichkeiten. Um seine Leistungen zu präsentieren, muss er für seine potentiellen Klienten eine Art von „öffentlicher Dauerpräsenz“ erzeugen.
Dafür gilt es, die besten Wege und Medien zu suchen und zu nutzen. Das können z.B. Vorträge auf Seminarveranstaltungen oder Veröffentlichungen in Fachzeitschriften oder Zeitungen sein. Diese Möglichkeiten nutzen jedoch nur verhältnismäßig wenige Anwälte. Die Mehrzahl von ihnen greift zu anderen Mitteln. Nach neuesten Untersuchungen platzieren 70 Prozent von ihnen Anzeigen in den „Gelben Seiten“. Früher waren diese neben der Mund-zu-Mund Propaganda sicherlich ein probates Mittel, um Kunden zu gewinnen. Inzwischen hat aber die Strahlkraft der „Gelben Seiten“ stark nachgelassen. Bei der von den Anwälten selbst wahrgenommenen Werbewirksamkeit landen sie nur abgeschlagen auf Platz 15 von insgesamt 24 Werbemaßnahmen. Die Einschätzung der Werbewirksamkeit des Internets kommt immerhin auf Platz 5, nach verschiedenen Fachseminaren, Vorträgen und Pressemitteilungen.
Wollen Anwälte mit ihren Leistungen wirksam werben, müssen sie die rasante Entwicklung der Kommunikationstechnologien für sich nutzen. Im Jahre 2009 besaßen bereits 73% aller privaten Haushalte in Deutschland einen PC mit Internetanschluss. In diesem Jahr hat sich der Prozentsatz der PC-Besitzer wahrscheinlich noch erhöht. Aber schon die Zahlen aus 2009 belegen, dass das Internet für die meisten Deutschen eine ständige und bequem erreichbare Quelle für Informationen und – durch E-Mail-Korrespondenz und Beteiligung an Foren – auch für Interaktionen geworden ist.
Da der Wettbewerbsprozess bekanntlich innovative Handlungen belohnt, wäre es dann wegen der überragenden Verbreitung des Internets nicht ratsam, mit der Zeit zu gehen und einigen angelsächsischen Vorbildern folgend, die „mouth-to-mouth“-Propaganda durch eine „mouse-to-mouse“-Propaganda zu ergänzen?