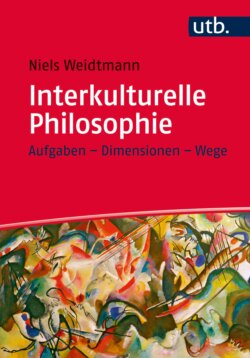Читать книгу Interkulturelle Philosophie - Niels Weidtmann - Страница 22
2.1.3 Polylog
ОглавлениеDen Begriff des Polylog hat WimmerWimmer, Franz M. in die interkulturelle Philosophie eingebracht.1 Polylog bedeutet im Griechischen Vielstimmigkeit, womit freilich das wirre Durcheinander des bloßen Geredes gemeint ist. Dagegen setzten die Griechen die Einheit des Logos (der Vernunft), der die verschiedenen Stimmen auf ihre gemeinsame Grundlage verpflichtet. Wimmer hat den Begriff des Polylog aufgegriffen und auf die interkulturelle Situation bezogen. Er will die interkulturelle Vielstimmigkeit nun aber gerade nicht auf eine ihr zugrunde liegende Einheit reduzieren, sondern versteht den Polylog als einen offenen Austausch, in dem um den gemeinsamen Logos erst gerungen werden muss. So versteht er seinen polylogischen Ansatz denn als einen Schritt über bloß komparative Philosophie und die Aufklärung »mit dem Mittel einer voraussetzungslosen Wissenschaft« hinaus.2 Wenn er in seiner »Minimalregel« fordert, »keine philosophische These für gut begründet [zu halten], an deren Zustandekommen nur Menschen einer einzigen kulturellen Tradition beteiligt waren«,3 dann deshalb, weil er die Pluralität der Logoi ernst nimmt. Ein gemeinsamer Logos ist in erster Linie das Ergebnis des Austausches und erschöpft sich nicht darin, Voraussetzung für die Teilnahme am Polylog zu sein. Und doch gilt, dass sich am Polylog sinnvollerweise nur derjenige beteiligen kann, der zum gemeinsamen Logos auch etwas beizutragen hat. Der Polylog, so wie Wimmer ihn versteht, setzt deshalb neben der Pluralität der Logoi deren Fähigkeit voraus, zu einem gemeinsamen Logos beizutragen. Damit rückt er in deutliche Nähe zu HabermasHabermas, Jürgen’ Diskurstheorie. Der Polylog lässt sich geradezu als eine Anwendung der Diskurstheorie auf die interkulturelle Situation verstehen. Schon Habermas beschränkt den Diskurs nicht auf die europäisch-westliche Gesellschaft, sondern bindet grundsätzlich alle Menschen ein. Wimmer formuliert mit dem Polylog nun gleichsam den besonderen Fall eines interkulturellen Diskurses und fordert, jeden Geltungsanspruch kulturübergreifend zur Prüfung zu stellen. Es geht ihm nicht nur darum, grundsätzlich alle Menschen in den Diskurs einzubinden, sondern er betont die Notwendigkeit, endlich auch die Stimmen jener Völker zu hören, die in Zeiten von Kolonialismus und Eurozentrismus lange unterdrückt waren. Damit rückt das Ideal der Herrschaftsfreiheit der Sprechsituation in den Mittelpunkt. Wimmer spricht ausdrücklich von einem »gewaltfreien, entkolonialisierten Diskurs«.4 Auch legt er entscheidenden Wert darauf, nicht allein den »zwanglosen Zwang des besseren Arguments« (s.o.) gelten zu lassen, sondern tatsächlich verschiedene Traditionen zu Wort kommen zu lassen. In einem späteren Text stellt Wimmer der negativen Formulierung der Minimalregel deshalb eine positive zur Seite: »Suche wo immer möglich nach transkulturellen Überlappungen von philosophischen Begriffen, da es wahrscheinlich ist, dass gut begründete Thesen in mehr als nur einer kulturellen Tradition entwickelt worden sind.«5 Darin spricht sich die Motivation, ehemals kolonialisierte und marginalisierte Völker und deren Traditionen als gleichberechtigte Gesprächspartner anzuerkennen, deutlich aus.
Ebenso wie HabermasHabermas, Jürgen das für die Diskurstheorie tut, setzt freilich auch WimmerWimmer, Franz M. voraus, dass der Polylog von allen Beteiligten vernünftig geführt wird. Dabei wäre doch die Vernünftigkeit des Polylog – und nicht nur die Vernünftigkeit der Thesen – im Polylog selbst erst zu finden, ja möglicherweise gar zu erstellen. Es scheint mir diesbezüglich entlarvend zu sein, wenn Wimmer schreibt, dass »Schulbildungen und -auseinandersetzungen aus der […] Geschichte der europäischen Philosophie […] interkulturellen Dialogen analog sind«.6 Wimmer versteht Polyloge als Auseinandersetzungen, die innerhalb eines Rahmens stattfinden, der alle am Polylog Beteiligten umfasst. Wer aus dem Rahmen fällt, sprich wer sich der dem Polylog eigenen Vernünftigkeit verweigert, der kann auch nicht verlangen, Gehör zu finden. Und tatsächlich: Polyloge machen nur unter der Voraussetzung eines solchen Rahmens Sinn. Schließlich werden Polyloge von Subjekten geführt, nicht von Kulturen, darauf weist Wimmer ausdrücklich hin.7 Subjekte aber begegnen sich immer in irgendwelchen Situationen; die jeweilige Situation stellt dann den gemeinsamen Rahmen dar, innerhalb dessen ein Polylog sinnvoll stattfinden kann. Konkret: Wimmer nennt das von Herra stammende Beispiel eines guatemaltekischen Indio, der einen Zauberer umbringt, weil dieser versucht, ihn und seine Kinder durch Verwünschungen zu töten.8 Er wird von der »europäisierten Justiz« zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, obwohl es sich den Regeln seiner indigenen Gemeinschaft nach um Notwehr gehandelt hat. Wimmer sagt nun nicht, der Mann hätte nicht verurteilt werden dürfen; vielmehr legt er nahe, die verschiedenen Positionen und in diesem Fall eben auch die verschiedenen Rechtssysteme anzuhören. Weder kann im heutigen Guatemala ohne weiteres indigenes Recht angewandt werden noch sollte die moderne Rechtssprechung das indigene Recht einfach ignorieren. Wie aber dann entscheiden? Am ehesten so, dass dem spezifisch indigenen Kontext so weit Rechnung getragen wird, wie es die moderne Gesellschaft und ihr Rechtswesen verkraften. Das bedeutet nichts anderes, als dass die gesellschaftliche Situation, in der sich Guatemala heute befindet, entscheidend beeinflusst, wie die verschiedenen Positionen gegeneinander abzuwägen sind. Die verschiedenen Rechtspositionen fließen in die gemeinsame Situation mit ein und müssen dort verhandelt werden. Ähnlich läuft der Polylog ab: Die am Polylog beteiligten Subjekte bringen die aus ihren jeweiligen kulturellen Traditionen stammenden Einsichten ein und beurteilen sie dann wechselseitig in dem von der gemeinsamen Situation vorgegebenen Rahmen.
Damit ist auch klar, in welcher Dimension ein Polylog gelingen kann: Dort, wo Menschen verschiedener kultureller Traditionen aufeinander treffen und sich über ihr Zusammenleben verständigen müssen. Entscheidend ist, dass dabei nicht die kulturellen Traditionen selber auf dem Spiel stehen bzw. einander begegnen. Die kulturellen Traditionen tauchen lediglich in Gestalt einzelner Überzeugungen, Einsichten und Gewohnheiten auf, die von den am Polylog beteiligten Subjekten in die gemeinsame Situation eingebracht werden. Tragend ist letztlich die gemeinsame Situation. Die aber steht im Polylog nicht zur Diskussion. Auch die interkulturelle Situation nicht.
Letztlich arbeitet der polylogische Ansatz deshalb wie alle anderen einheitstheoretischen Ansätze auch mit jenem verdinglichenden Kulturverständnis, das wir schon bei der Diskussion der Multi- und der Transkulturalität in Kapitel 1 kennen gelernt haben. Kultur ist demnach etwas, das Menschen prägt und das sie in ihre jeweilige Lebenssituation mit einbringen, das aber auf dem Boden der Vernunft grundsätzlich austausch- und verhandelbar bleibt. Der vernünftige Mensch kann sich – jedenfalls prinzipiell – frei zu seiner Kultur verhalten; er ist, um es zugespitzt zu sagen, wesenhaft ein vernünftiges und nur historisch bedingt ein kulturelles Lebewesen. Folglich ist auch die Vernunft grundsätzlich unabhängig von historischen und kulturellen Besonderheiten; sie ist universal. Darin kommt das Primat der Einheit stiftenden Vernunft deutlich zum Ausdruck.
Zum Schluss sei noch eine ganz anders gelagerte Kritik am Polylog angedeutet. Man könnte nämlich versuchen, statt der Minimalregel eine Maximalregel vorzuschlagen. Diese lautet nun nicht, in den Polylog immer alle Kulturen einzubinden; darin läge keine grundsätzliche Korrektur, sondern nur eine graduelle Erweiterung. Vielmehr müsste eine solche Maximalregel die verschiedenen Logoi, die in den Polylog einfließen, ernster nehmen.9 Solange man sich auf einer bloß formalen Ebene bewegt oder Logos gar auf Logik reduziert, lässt sich die Pluralität der Logoi nicht losgelöst von der Annahme eines einzigen Logos denken. Versteht man Logos nun aber als die spezifische Ordnung einer kulturellen Lebenswelt, sozusagen als die Vernunft, die sich im jeweiligen Selbstverständnis der Menschen und ihrem Umgang mit der Welt ausdrückt, verbietet es sich eigentlich, den einzelnen Logos als bloßen Teil eines zugrunde liegenden oder auch erst zu gewinnenden universalen Logos zu fassen. Im jeweiligen Logos einer Kultur drückt sich die gelebte Vernünftigkeit sowohl der einzelnen Personen als auch der von ihnen geteilten Lebenswelt aus. In ihm drückt sich aus, was Mensch und Welt in einer Kultur sind. Das Menschsein und die Welt können aber nicht unvollständig sein – und das heißt eben auch, sie können in einer kulturellen Lebenswelt nicht lediglich ›auf eine bestimmte Weise‹ verwirklicht sein. Die Menschen einer Kultur sind nicht nur auf eine bestimmte Weise Mensch; ihre Welt ist nicht nur auf eine bestimmte Weise Welt. Sie brauchen den Austausch mit anderen Kulturen nicht, um ganz Mensch und ganz Welt zu werden. Sie brauchen den Austausch mit anderen Kulturen aber sehr wohl dafür, um auf diese ihre eigene Unbedingtheit aufmerksam zu werden und zu erkennen, dass in jeder einzelnen Kultur das Menschsein und die Welt im Ganzen und die Vielzahl der Logoi im Gesamt auf dem Spiel stehen.