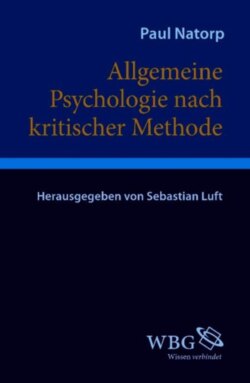Читать книгу Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode - Пауль Наторп - Страница 8
2. Die Philosophie der Marburger Schule: die transzendentale Methode
ОглавлениеDie Marburger Neukantianer Cohen und Natorp fassten die von ihnen vertretene Anknüpfung an Kant – eine Anknüpfung, die immer in erster Linie dem Geiste, nicht dem Buchstaben Kants folgen sollte – stets in zwei eng zueinander gehörenden Aspekten auf: erstens im Sinne der Methode und zweitens als besondere Form des von Kant inaugurierten transzendentalen Idealismus. Um was für eine Methode handelt es sich und wie hängen beide Aspekte, Methode und Idealismus, systematisch zusammen?
Das am deutlichsten identifizierbare Kernelement der Marburger Schule ist die Methode, welche Cohen und Natorp in Anlehnung an Kant die „transzendentale Methode“ nennen. Auch wenn Kants Philosophie zweifellos transzendental zu nennen ist und er seine Vernunftkritik auch als „Traktat über die Methode“ bezeichnet, findet sich die Formulierung „transzendentale Methode“ nicht bei Kant, und in der Tat meinen die Marburger hiermit etwas Spezifischeres als das, was bei Kant selbst eine transzendentale Methode zu nennen wäre. Fassen wir zuerst in aller Knappheit Kants Grundidee zusammen und wenden uns dann der Marburger Interpretation derselben zu.
Kants Vernunftkritik kann als die Überwindung der gegensätzlichen Grundpositionen des Empirismus und des Rationalismus angesehen werden. Kant erkennt im Prinzip die Vorzüge beider an, wenn er darauf besteht, dass alle Erkenntnis mit der Erfahrung anfängt, dass sie aber nicht mit ihr endet. Trotz unseres Zugangs zur Welt durch Erfahrung ist es uns dennoch möglich, Erkenntnis a priori von ihr zu haben. Daher rührt Kants Leitfrage, „wie ist synthetische Erkenntnis a priori möglich?“; es geht demnach nicht um die Frage, ob sie prinzipiell möglich ist, sondern darum, was sie ermöglicht. Solche Art von Erkenntnis ist nur möglich durch den mit der Kopernikanischen Wendung eingeführten transzendentalen Idealismus, der besagt, dass wir nur das von der Welt a priori erkennen, was wir selbst in sie legen. Dinge sind uns in der Erfahrung gegeben, aber sie sind uns immer gegeben durch unsere sinnlichen Anschauungsformen Raum und Zeit und gedacht mithilfe der auf sie als Erscheinungen bezogenen Kategorien der reinen Vernunft. Die synthetische Spontaneität des Verstandes verbindet das in der Sinnlichkeit Gegebene mit von Kategorien abgeleiteten Begriffen im Urteil. Das bedeutet also, Wahrheitsaussagen a priori sind – abgesehen von apriorischer Erkenntnis in der reinen Mathematik – möglich auch in Bezug auf Dinge, die uns in unserer Erfahrung gegeben sind. Damit durchschlägt Kant den Gordischen Knoten von Empirismus und Rationalismus: Dass wir von der Welt nur durch Erfahrung wissen, ist unzweifelhaft; aber damit dürfen wir unsere Erkenntnisweise von der Welt nicht auf empirische Erkenntnis reduzieren. Was wir von der Welt a priori wissen können, wissen wir kraft unserer Verstandesleistungen, die in uns als Vernunftwesen liegen und mit denen wir die Welt erkennen; aber solche Vernunfterkenntnis ist bezogen auf das in der Sinnlichkeit Gegebene, darüber hinaus ist keine Erfahrung und entsprechend auch keine Erkenntnis von über die Sinnlichkeit hinausgehenden Dingen möglich. In summa, der Dualismus von Sinnlichkeit und Verstand ermöglicht uns eine rationale Erkenntnis dessen, was uns in der Erfahrung gegeben ist.
Cohen setzt genau an dieser Stelle an: Was meint Kant mit „Erfahrung“? Doch sicher nicht die vorwissenschaftlich-lebensweltliche Erfahrung! In der Tat ist Cohens erstes bedeutende Werk betitelt Kants Theorie der Erfahrung (1871), das die These vertritt, dass Kant in seiner Vernunftkritik einen neuen Begriff von Erfahrung begründet hat. Die Erfahrung, von der Kant spricht, ist laut Cohen die Erfahrung des Naturwissenschaftlers, der im Sinne der von Newton kanonisierten modernen exakten Naturwissenschaft Mathematik auf das in der Natur Erfahrene anwendet. Entsprechend sind die Erfahrungsgegenstände des Naturwissenschaftlers nicht die Naturdinge (also Pflanzen, Lebewesen und sonstige Naturvorkommnisse), sondern die „Zahlen und Figuren“, die sie bestimmen und denen sie unterstehen. Diese „Gegenstände“ der Wissenschaft sind die wahren Dinge. Es gibt also keine rein sinnlich gegebenen Dinge, die später mit Begrifflichkeiten versehen würden, wenn sich der Wissenschaftler ans Werk macht. Die Erfahrung des Naturwissenschaftlers ist nie naiv und ohne Absichten, sondern sein Blick ist von vornherein geleitet von Hypothesen, Begrifflichkeiten, theoretischen Vorhaben. Damit ist für die Marburger jener missliche Dualismus von Sinnlichkeit und Verstand, sinnlicher Rezeptivität und begrifflicher Spontaneität, überwunden, sofern es „Dinge“ für den Wissenschaftler nur insoweit überhaupt erst „gibt“, sofern sie begrifflich gefasst werden. Das begriffliche Fassen ist das, was Kant mit der Wendung, „was wir in die Dinge legen“, gemeint hat. Erfahrung im Vollsinne des Begriffs ist begrifflich, und das in der Erfahrung gegebene Ding ist das vom Wissenschaftler mithilfe von Begriffen konstruierte wissenschaftliche Faktum12.
Diese Interpretation des Kantischen Begriffs der Erfahrung und die Konsequenzen für die Bedeutung der Vernunftkritik, gegen die später vor allem die Vertreter der Phänomenologie Sturm gelaufen sind, sind weitreichend. Diese Kritik muss sogleich genannt werden, denn man versteht dadurch die Stoßrichtung der Marburger Erkenntniskritik13. Der Hauptvorwurf dieser Interpretation der Kantischen Vernunftkritik war der einer Einengung der Kritik der Vernunft im Allgemeinen auf die in der modernen Naturwissenschaft zur Anwendung kommende Vernunft im Besonderen. In der Tat ist diese kritische Einschätzung insofern richtig, als die Rolle und das Schicksal der Philosophie von den Marburgern eng mit dem Fortschritt der modernen Wissenschaft verbunden angesehen werden. Diese Identifizierung von Vernunft- mit Wissenschaftskritik trug den Marburgern den Ruf ein, einen allzu eng an die Wissenschaften orientierten Vernunftbegriff zu haben, sowie überhaupt ein allzu restriktives Verständnis von Kritik. Von Kants weit reichender Vernunftkritik und der Neubegründung einer Metaphysik in den Grenzen der reinen Vernunft blieb damit nicht mehr viel übrig.
Dieser Vorwurf war den Marburgern natürlich bekannt, und ihre Replik darauf war, dass dies der einzige Weg für die Philosophie war, den übermächtigen Naturwissenschaften beizukommen, auch wenn dies die Preisgabe einer Region oder einer Aufgabe sui generis für die Philosophie bedeutete. Es war eine Tatsache, mit dem man sich im Zeitalter des szientistischen Positivismus nolens volens zu arrangieren hatte, dass die Naturwissenschaften zum alles dominierenden Kulturfaktum geworden waren. Auch wenn man sich freilich eines naturwissenschaftlichen Reduktionismus zu wehren hatte – bzw. diese Abwehr zu einer Hauptaufgabe der Philosophie wurde –, war es dennoch die vornehmliche Aufgabe der Philosophie, sich mit der Tätigkeit der modernen Wissenschaft auseinanderzusetzen. Es war eine Rolle, die sich die Philosophie nicht ausgesucht hatte, sondern in die sie gezwungen wurde, wenn man nicht wissenschaftliche Philosophie zugunsten von Mystizismus oder Weltanschauungsphilosophie aufgeben wollte oder, noch schlimmer, in den Klagegesang des „Untergangs des Abendlandes“ miteinstimmen wollte. Nur eine direkte Auseinandersetzung mit den Wissenschaften konnte die Philosophie vor ihrem vollkommenen Überflüssigwerden und einer vollständigen Nichtbeachtung seitens der Wissenschaft bewahren. So ist die Bindung der Marburger Schule an die Naturwissenschaften zu erklären, und obwohl Natorp ein getreuer Marburger war, ist es doch die Reduktion von Philosophie im weiten Verständnis auf Wissenschaftskritik und Wissenschaftstheorie, gegen die er mit seiner Psychologie in subtiler Weise angeht, ohne aus den Grenzen des Marburger Neukantianismus ausbrechen zu wollen.
Die Aufgabe der Philosophie war für die Marburger also vor allem die Kritik der in der Wissenschaft – konkret, der exakten modernen Naturwissenschaft – zur Anwendung kommenden Vernunft. Sofern sich diese Position grundsätzlich im Rahmen des transzendentalen Idealismus hält, da ein direkter Zugang zu einem wie immer existierenden „Ding an sich“ abgelehnt wird, bevorzugen Cohen und Natorp den Titel „kritischer Idealismus“ (oder einfach nur „Kritizismus“), der die Rolle der Philosophie als Kritik der Wissenschaften betonen soll14. Entsprechend ist das „Faktum der Vernunft“ in der Marburger Schule das „Faktum der Wissenschaft“. Damit ist die Aufgabe der Philosophie als transzendentaler Idealismus im Sinne des kritischen Idealismus neu definiert: Die Erfahrung, von der auszugehen ist, ist ausschließlich die Erfahrung des Wissenschaftlers in der Weise, wie er oder sie die Natur „sieht“ z.B. in Experimenten und durch besondere Messinstrumente, etwa das Mikroskop oder das Fernrohr. Es ist dies das schroffe Gegenteil einer romantischen Naturerfahrung, – es ist die Natur, wie sie durch das Experiment in den „Zeugenstand“ gerufen und gezwungen wird, ihre Geheimnisse preiszugeben, wie bereits Kant das Geschäft der modernen Naturwissenschaften charakterisiert hatte. Was bei Kant aber nur ein Aspekt der Vernunftkritik war, wird in Marburg zu ihrer fast ausschließlichen Aufgabe.
Die Frage, wie die die Philosophie aber nun in diesem Geschäft verfährt, führt schließlich zur transzendentalen Methode der Marburger Schule. Hier zeigt sich, dass der Unterschied zwischen der Tätigkeit des Wissenschaftlers und der des Philosophen nicht grundsätzlich verschieden ist. Während das „tägliche Brot“ des Wissenschaftlers die Sammlung von neuen Daten und Beobachtungen ist, also – wie man sagen könnte – die empirische Feldforschung, so findet der eigentliche Fortschritt der Wissenschaft im Denken statt, d.h. im Ausdenken von Gedankenexperimenten und den daraus folgenden logischen Schlüssen, im Falle der Falsifikation die Konstruktion neuer Versuchsanordnungen, im Falle der Verifikation der weitere Fortschritt zu neuen Hypothesen. So konnten die Marburger bekanntlich sagen, dass jede Gabe – also das in der Erfahrung Gegebene im Sinne ihres Verständnisses von Erfahrung – gleichzeitig Auf-Gabe ist für weitere Forschung. Oder – in den Worten Natorps – jedes factum ist ein fieri, ein Werden, so dass das Faktum der stets fortschreitenden Wissenschaft eigentlich ein „Werdefaktum“ ist (vgl. unten, S. 262). Gegenüber den psychischen Akten des Erdenkens neuer Hypothesen und des Ziehens neuer Schlüsse seitens kreativer Wissenschaftler besteht der eigentliche Fortschritt der Wissenschaft jedoch in ihrem „logischen“ Aufbau und dem „logischen“ Fortschritt im Sinne neuer aus diesen Vernunftschlüssen folgenden objektiven Erkenntnisse und der Weiterführung des „Logischen“ selbst im Wortsinne: der Bildung neuer Begriffe und des Aufsuchens neuer Theorien und Kategorien für das neu Entdeckte. So ist, um ein Beispiel zu nennen, das Modell des Atoms in der neueren Physik ein Beispiel für eine neue Kategorie im Rahmen der neuen Teilchenphysik, ein Modell mithin, zu dem es in der Wirklichkeit nichts Entsprechendes gibt: Das Atom ist ein hilfreiches Denkmodell, mehr nicht; ein solches noch dazu, welches seit Bohr tiefgreifende Umwandlungen erfahren hat, sich also, trotzdem es ein logisches Modell ist, im Fluss befindet. Das fixierte logische Konstrukt wird also im Zuge des Fortschritts der Wissenschaft wieder in den lebendigen Gedanken verflüssigt, wieder neu fixiert, um dann wieder erneut verflüssigt zu werden, usw. Dies ist der logische Fortschritt der Wissenschaft.
Die eigentliche Arbeit in den Wissenschaften ist somit das Logische in diesem Sinne, und dieser logische Aufbau der Welt wird nicht in der Welt gefunden, sondern – im Sinne des transzendentalen Idealismus – in sie gelegt: er wird konstruiert. Erfahrung und das in ihr Gegebene sind konstruiert von der menschlichen Vernunft, und dies ist die Tätigkeit, die in der Wissenschaft immer schon im Gange ist und nicht erst motiviert werden muss vom Philosophen. Sofern die moderne Naturwissenschaft in diesem Sinne Begriffe und Theorien in die Natur legt, um sie „nach Begriffen zu buchstabieren“, praktiziert sie schon den transzendentalen Idealismus, ohne ihn jedoch als solchen zu durchschauen: Naturwissenschaftler sind keine Philosophen, und müssen es auch nicht sein, um ihre Arbeit zu tun. Das eigentliche Wesen ihres Tuns wird aber vom hierüber reflektierenden Philosophen aufgedeckt: Wissenschaftler sind zwar ihres Tuns unbewusst, doch in Wahrheit Transzendentalphilosophen; das ist die provokante These des Marburger Neukantianismus.
Hier findet sich nun der arbeitsteilig der Philosophie angestammte Platz. Der Philosoph unterscheidet sich vom tätigen und seiner Sache hingegebenen Wissenschaftler darin, dass er die Tätigkeit des letzteren reflektiert und auf den Begriff bringt: Kants Vernunftkritik ist die erste, ihrer Aufgabe vollbewusste philosophische Artikulation und Rechtfertigung der modernen Naturwissenschaft. Der Philosoph rechtfertigt die Naturwissenschaft, sofern diese in ihrer Funktionsweise und in ihrem philosophischen Charakter erklärt wird, aber auch, insofern sie in ihre rechtmäßigen Grenzen gewiesen wird: ihr Anwendungsgebiet ist das in der Erfahrung Gegebene, darüber hinaus (über Gott, Freiheit oder Unsterblichkeit) darf sie nichts aussagen. Dies entspricht der von Kant so konzipierten – positiven wie negativen – Vernunftkritik, jedoch bei Cohen limitiert auf die in den Wissenschaften zur Anwendung kommende Vernunft. Während Gott, Freiheit und Unsterblichkeit bei Kant zu regulativen Ideen umgewandelt werden – also z.B. die Idee der Freiheit in der Begründung der Moralphilosophie unerlässlich ist –, beschränkt die Marburger Schule das Tätigkeitsgebiet der Wissenschaft auf das in der Erfahrung Gegebene, auch wenn zugestanden wird, dass die Erfahrung in der Naturwissenschaft nicht die einzige Art von Erfahrung ist, wohl aber die, worin die menschliche Vernunft das Höchste leistet, was sie zu leisten imstande ist.
Ist Wissenschaft Konstruktion von Wissen, dann ist Philosophie die Nach-Konstruktion der Funktionsweise und der Logik dieser Konstruktion. Der Philosoph erklärt, nachkommend, die Logik der Forschung in der Weise, wie sie das Wissen von der Natur konstruiert. Der Philosoph arbeitet demnach im Tandem mit dem Wissenschaftler, sofern der Philosoph das in der Wissenschaft erarbeitete Faktum in seiner Entstehung und seinem logischen Aufbau erklärt und rechtfertigt. Transzendentalphilosophie muss immer vom als wahr akzeptierten Faktum der Wissenschaft den Ausgang nehmen, und dieses Faktum muss in seiner inneren Logik erklärt und gerechtfertigt werden. Der Philosoph geht in den vom Wissenschaftler zuerst gemachten Fußstapfen und rechtfertigt im erläuterten Sinn die Entstehung von Objektivität, die aus dem dynamischen Fluss des Bewusstseinsprozesses, dem eigentlichen Denken als Bewusstseinstätigkeit, geschaffen wird.
Objektivität im Sinne von wissenschaftlich erarbeiteter Wahrheit ist somit der stillgestellte, im Begriff bzw. der Theorie kristallisierte Bewusstseinsstrom. Das Denken selbst ist im lebendigen Fluss des Theoretisierens, Schließens, Bildens von Hypothesen usw. begriffen und terminiert in Theorien und Termen – und verflüssigt sich darauf hin wieder, da der Erkenntnisprozess nie abgeschlossen ist. Jeder Fund ist Anstoß zu neuer Forschung15. Diesen Prozess des Terminierens in Begriffen und Theorien darzustellen, ist nun die Aufgabe der transzendentalen Methode. Sie hat keinen ihr ureigenen Sachbereich, sondern ist an die Fakten und Ergebnisse gebunden, die die Wissenschaften liefern. Sie ist also keine „kreative“, „vorausspringende“ Logik, die ein neues Wissenschaftsgebiet erst erschließen würde16.
Schließlich ist der Vollständigkeit halber zu ergänzen, dass sich Cohen zwar in erster Linie am Faktum der Wissenschaften im Rahmen der theoretischen Philosophie orientierte, er aber anerkannte, dass die menschliche Vernunft nicht nur aus reiner Vernunft besteht, sondern dass die Vernunft theoretische, praktische und ästhetische Applikation hat, anknüpfend an die kanonische Dreiteilung Kants. Dennoch aber ist in all diesen „Seinsweisen“ des Menschen der Ausgang von einem wissenschaftlichen Faktum zu nehmen, um den rationalen Kern dieser Tätigkeiten zu ermitteln. Das Faktum, wovon z.B. in der praktischen Vernunft der Ausgang zu nehmen ist, ist die Jurisprudenz; auf diese richtet sich sodann in analoger Weise die transzendentale Methode. Cohens Hauptorientierung ist die Wissenschaft – d.h. die logische Form und der logische Aufbau, die in jeder Kulturform anzutreffen ist –, so dass der Vorwurf des extremen „Logizismus“ der Marburger Schule berechtigt ist. Natorp bezog gegen Cohen keine offene Gegenstellung, doch dieser extreme Logizismus war ihm unangenehm. Die Psychologie nach kritischer Methode ist ein indirekter, aber beredter Beleg für diesem Befund.
Wie passt nun Natorps Psychologie in die Marburger Schule; genauer, wie nimmt sich das Natorp’sche Projekt einer „allgemeinen Psychologie nach kritischer Methode“ im Rahmen der Marburger Schule aus?