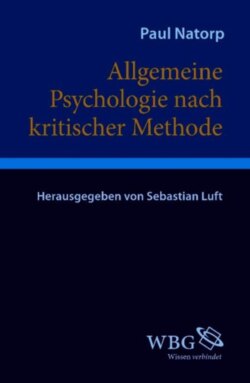Читать книгу Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode - Пауль Наторп - Страница 9
3. Das philosophische Projekt einer „allgemeinen Psychologie nach kritischer Methode“ im Rahmen der Marburger Schule
ОглавлениеDie Methode der Marburger Schule ist – kann man zusammenfassend sagen – eine Methode der Rechtfertigung der in den Wissenschaften vor sich gehenden Objektivierung in der Art, wie sich aus „fliehenden Gedanken“ Theorien bilden, d.h. – um es mit Natorps Worten zu sagen – wie sich aus Subjektivem Objektives bildet. Wie steht es aber nun mit diesem Subjektiven, aus dem Objektivität hervorgeht? Wie steht es mit einer Wissenschaft von diesem Subjektiven selbst, dem, was traditionell Psychologie heißt? Hierbei ist Cohens, von Kant herrührende, Haltung gegenüber einer Psychologie einseitig kritisch. Anders gesagt, war für Cohen – wie für andere Philosophen der Zeit, so auch Husserl – das große Schreckgespenst der Psychologismus, der sich durch eine szientistische Weltauffassung nahelegte, die es denkbar machte, das Denken lediglich als Gehirnfunktion anzusehen. Diese von den Naturwissenschaften geformte Weltsicht war aufgrund ihrer empirischen, durch Experimente bestätigten Evidenz so überzeugend, dass sie auch von vielen Philosophen wie Psychologen vertreten wurde. So bedeutete Cohens Interesse an der „logischen Form“ der in den Wissenschaften vor sich gehenden Objektivierungen negativ eine Ablehnung einer psychologistischen Erklärung dieser Logik. Psychologismus – als einer besonderen Form von Anthropologismus – ist die Auffassung, dass Logik nichts anderes als ein Denkvorgang in der menschlichen Psyche ist, bzw. jene sich auf diese reduzieren lässt. Die Konsequenzen hiervon sind Skeptizismus und Relativismus; Relativismus, weil logische Gesetzmäßigkeiten auf Vorgänge im menschlichen Gehirn reduziert werden und damit relativ zur menschlichen Spezies sind. Dies führt zum Skeptizismus, da objektive Wahrheiten nur wahr sind, insofern wir sie, als menschliche Spezies in der jetzigen Entwicklungsstufe, als wahr empfinden. Die Notwendigkeit, die wir empfinden, wenn wir apodiktische Wahrheiten einsehen, ist eben nicht mehr als ein menschliches Empfinden. Damit ist es nicht ausgeschlossen, dass in der Zukunft (Vernunft-)Wesen entstehen, für die 2+2 nicht mehr vier, sondern fünf ist. Damit ist aller universale Wahrheitsanspruch von Wahrheiten a priori prinzipiell bestritten17.
Nun war es schon Kants Bemühung, den Skeptizismus zu überwinden, und zwar, indem er bekanntlich seine Vernunftkritik zwischen Dogmatismus und Skeptizismus ansiedelte und damit den radikalen Skeptizismus eindämmte. Ein Psychologismus, wie er im 19. Jahrhundert aufgrund der neuen Ergebnisse der Naturwissenschaften und der damit einhergehenden Wissenschaftsgläubigkeit aufkam, wäre für Kant zwar undenkbar gewesen. Dennoch aber sieht er sich genötigt, die sog. „subjektive Deduktion“ der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft in der zweiten Auflage dahin zu verändern, dass der Schwerpunkt nicht auf den subjektiven Leistungen der menschlichen Vernunft liegt, sondern deren Vermögen, objektive Erkenntnis hervorzubringen (entsprechend wird die Version der zweiten Auflage auch „objektive Deduktion“ genannt). Also finden sich schon bei Kant Hinweise auf einen „Subjektivismus“, der die Vernunft auf die menschliche Subjektivität zu reduzieren droht. Das Szenario des Psychologismus war hingegen in Cohens Zeit, der aller über die Natur hinausgehender „Geist“ suspekt war, höchst lebendig. So ist Cohens Insistenz auf die logische Form des „reinen Denkens“ ein impliziter Kampf gegen den Psychologismus, indem das im wissenschaftlichen Denken sich vollziehende Erkennen von allem Subjektiven purgiert wird. Die Konsequenz für Cohen war, dass er die Psychologie als eine eigene Disziplin innerhalb der Philosophie, richtig verstanden als Transzendentalphilosophie, rundheraus ablehnte.
Hier setzt nun Natorp ein: Schon der Titel „Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode“ ist Programm, sofern er sich zur Aufgabe setzt, eine Psychologie trotz aller Warnungen Cohens im Rahmen der „kritischen Methode“ – vulgo: der transzendentalen Methode – durchzuführen. Was motivierte Natorp dazu und weshalb sah er sich zu einem solchen Unternehmen genötigt? Zunächst ist werkbiographisch daran zu erinnern, dass Natorps Interesse an der Psychologie in die Anfänge seines Werkes zurückreicht: Sein erster Versuch, die kurze Einleitung in die Psychologie nach kritischer Methode von 1888 und der im Jahr zuvor erschienene programmatische Aufsatz, „Ueber objective und subjective Begründung der Erkenntniss“, also die Idee einer der „objektiven Begründung“ der Erkenntnis parallele (oder inverse) „subjektive Begründung“ stammen bereits aus dieser Zeit, auch wenn sich Natorp damals noch nicht der Tragweite dieser Ausweitung der Begründungsproblematik bewusst war.
Doch woher stammte sein Interesse an der Psychologie? Natorp sah sich als Philosoph geradezu berufen, eine entscheidend wichtige, aber irregelaufene Disziplin zu retten; denn seine Wahrnehmung der psychologischen Forschung seiner Zeit war ernüchternd. Natorp gelangt zu dem Schluss, dass alle empirischen Forschungen zum Bewusstsein ihrem Gegenstand grobes Unrecht antun. Im Zuge ihrer Forschung töten diese Psychologien das lebendige Bewusstseinsleben ab; sie behandeln es – wie Natorp drastisch sagt – wie eine Leiche „in Seziersälen“ anstatt als lebendiges Wesen (vgl. unten, S. 176). Weshalb tun sie das? Um die Metapher einzulösen, im Versuch, das Bewusstseinsleben zu untersuchen, stellen sie das, was wesentlich lebendig, also dynamisch und fließend ist, still. Im Versuch, das Bewusstseinsleben, das Subjektive, zu fassen, verobjektivieren sie es in genau der Weise, wie jede andere Wissenschaft objektivierend vorgeht. Diese Methode ist für das Bewusstsein unangemessen, da es intrinsisch dynamisch und immer-beweglich ist. Psychologen sezieren statt dessen den starren Leichnam des Psychischen. Wenn Wissenschaft – im Sinne des Marburger Modells – Objektivierungen vornimmt, tut sie genau damit dem Subjektiven Gewalt an, indem sie es objektiviert. Der wissenschaftliche Ansatz ist der Sache wesentlich unangemessen, sofern das Subjektive in das verwandelt wird, was es gerade nicht und niemals ist. Entgegen aller anderen, objektiv gerichteten Wissenschaften leidet die Psychologie an dem „Midas-Problem“, dass sie, was sie anfasst, zu kaltem Gold verwandelt.
So stellt sich also das Schicksal der Psychologie als Wissenschaft vor ein prekäres Dilemma gestellt: (1) Entweder man stellt das Projekt einer „Wissenschaft von der Seele“ von vornherein unter das Verdikt des Psychologismus und kehrt sich – als Philosoph – davon im Ganzen ab. Oder (2) man akzeptiert, dass eine Wissenschaft vom Subjektiven zwar prinzipiell möglich sein mag, dass ein solches Projekt aber, als Objektivierung eines wesentlich Subjektiven, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, weil es letzterem notwendigerweise Gewalt antut und damit den Psychologen – im Bilde zu reden – a priori zum Leichenfledderer macht. Beide Szenarien sind höchst unbefriedigend. Ersteres ist nicht akzeptabel, weil damit die Erforschung einer anscheinend wichtigen Dimension der menschlichen Existenz – was immerhin auch traditionell in der westlichen Philosophie als Disziplin mit dem Namen Psychologie, so schon bei Aristoteles und sogar den Vorsokratikern, behandelt wurde – rundheraus abgelehnt wird. Die zweite Alternative ist nicht befriedigend, weil der Vorwurf nicht von der Hand zu weisen ist: Psychologie ist eine Wissenschaft, und gleichgültig, ob sie eine Natur- oder Geisteswissenschaft ist, ist sie als Wissenschaft interessiert an objektiven Ergebnissen, also Gesetzmäßigkeiten, seien diese Naturgesetze oder auch nur Regelmäßigkeiten des menschlichen Geistes, und so fallen sie unter die allgemeine Tendenz von Wissenschaft an sich, objektivierend zu sein. Und Objektivierung des Subjektiven ist eine radikale Verfälschung des Untersuchungsgegenstandes. Vor dieses Problem sieht sich jegliche Wissenschaft vom Subjektiven gestellt; keine hat, laut Natorp, diesen prinzipiellen Fehler auch nur gesehen, geschweige denn theoretisch reflektiert und schließlich korrigiert. Man muss verstehen, dass diese Kritik auf den Naturalismusvorwurf hinausläuft, sofern das Bewusstsein nicht in seiner Eigenart, in seiner ontologischen Differenz zum Naturhaften gesehen wird und dass daher die Methode gangbar scheint, das Bewusstsein wie jede andere Naturtatsache auch zu objektivieren. Es ist dieses Bestehen auf der ontologischen Differenz zwischen Natur und Bewusstsein, das Natorps ganzes Unternehmen antreibt. In dieser Insistenz auf der Eigenart des Bewusstseins sind Natorps Bemühungen mit denen von Husserl, Dilthey und auch dem frühen Heidegger vergleichbar, wenn auch seine Lösung durchaus anders lautet.
Vor diesem unbequemen Dilemma steht also Natorp, wenn er unternimmt, eine Psychologie nach kritischer Methode durchzuführen, die weder, als nach kritischer Methode vorgehend, die Seele als etwas Naturhaftes behandeln darf, noch die Tendenz mitmachen darf, welche die Wissenschaft tout court auszeichnet: nämlich objektive Ergebnisse zu erbringen, d.h. das wesentlich Subjektive zu verobjektivieren. Vor diesem Hintergrund nun schreitet Natorp zur Tat.