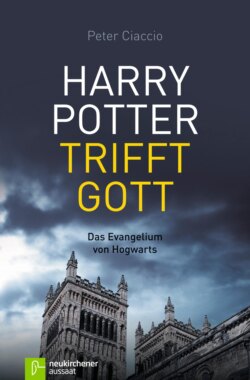Читать книгу Harry Potter trifft Gott - Peter Ciaccio - Страница 7
Vorwort zur italienischen Ausgabe
ОглавлениеZu den Büchern und Filmen von Harry Potter wurde bereits eine unendliche Reihe von Aufsätzen geschrieben. Zweifellos lässt sich auch das Sachbuch von Peter Ciaccio in diese Bibliographie einreihen, wenngleich es in ihr einen ganz eigenen Platz einnimmt, da es alle Kategorien durchkreuzt. Das vorliegende Buch bewegt sich nicht nur auf der Ebene der Intertextualität, sondern stellt sich einer weiteren Herausforderung, indem es den Versuch einer hermeneutischen Auslegung unternimmt: Auf den jeweiligen Böden der Antipoden, d.h. der Heiligen Schrift einerseits und der profanen Kulturindustrie andererseits, errichtet Peter Ciaccio ein übergreifendes semantisches Gebäude.
Der kleine Zauberer Harry Potter hat seit seiner Geburt 1997 dem Fantasy-Roman eine zuvor unvorstellbare Bekanntheit beschert (abgesehen vielleicht von Tollkiens Herr-der-Ringe-Trilogie), denn in der Potter-Heptalogie wurden die erzählerischen und kommunikativen Absichten und Strategien in großem Maße erweitert und neu codiert. Zudem ist es dem jungen Zauberer gelungen, die kollektive Vorstellungswelt der Massen zu durchdringen. Eine wahre Armee von Gelehrten (Soziologen, Medienwissenschaftler, Kinderpsychologen, Literaturkritiker und Kulturwissenschaftler) fühlten sich dazu veranlasst, Harry Potter eine gewisse wissenschaftliche Würde zuzuerkennen, indem sie ihn zum Gegenstand interdisziplinärer Forschung machten.
Die Neuartigkeit innerhalb der Potter-Bände besteht darin, dass es nicht länger nur darum geht, verschiedene Episoden um einen Titelhelden herum anzuordnen und auch nicht, eine Geschichte in den verschiedenen Phasen ihres Handlungsfortgangs auszuformen. Auch der Seriencharakter, den wir aus dem Fernsehen kennen, stellt keinen angemessenen Bezugspunkt dar, anhand dessen man das Harry-Potter-Phänomen verstehen könnte. Die Erzählung von dem jungen Zauberer erzählt vielmehr eine in sich geschlossene Geschichte mit einem Beginn und einem Ende, die – trotz der Tatsache, dass es in ihr um Zauberei geht – in den natürlichen zeitlichen Horizont der menschlichen Existenz eingebettet ist.
Es ist nicht nur so, dass die Protagonisten von Buch zu Buch im gleichen Maße gewachsen und älter geworden sind wie die Leser selbst. Auch die Themen, die von Mal zu Mal berührt werden, sind in dem Maße komplexer geworden, in dem auch diejenigen, die diese Herausforderungen zu bewältigen haben, erwachsener geworden und gereift sind.
Die Harry-Potter-Erzählung ist eine gelungene Metapher für die psychische und existenzielle Entwicklung von der Kindheit hin bis zum Erwachsenenalter. Dies zeigt sich nicht nur daran, dass in den späteren Romanen gegenüber den ersten ein Fortschreiten des „Dunklen“ auszumachen ist – Szenen, in denen es zu Gewalt kommt, nehmen zu, die Atmosphäre wird stellenweise ungleich bedrückender; politische, rassistische und soziale Klassen, sowie das Hineinwirken des Bösen in die Welt werden in einer immer drängenderen Weise thematisiert. Selbst der Schreibstil der Autorin verändert sich und wird komplexer. All dies setzt einen intellektuellen „Reifezuwachs“ in der Zielgruppe voraus und entspricht dem mit Harry Potter synchronisierten Lebensalter der Leser.
Unter dem Gesichtspunkt des Seriencharakters stellen sich die Harry-Potter-Romane als ein offenes Projekt dar, bei dem die Fans nicht nur am Ausgang der Geschichte interessiert, sondern durch eine Korrespondenz mit der Autorin vielleicht sogar daran beteiligt waren. Genau diese Offenheit und Formbarkeit hat es den Lesern ermöglicht, sich mit der Geschichte zu identifizieren. Dass sich die existenziellen Lebenslinien und -entwicklungen der literarischen Figuren an die des Publikums annähern und umgekehrt, ist ein gewisses Novum und ermöglicht eine Leseerfahrung, die man andernorts im Kulturbetrieb unserer Zeit nur schwerlich machen kann.
Mit ungetrübter Intuition hat Ciaccio in dem vorliegenden Buch christlicher Exegese über den Romanzyklus Harry Potter punktgenau die ganz besondere schöpferische Eigenart des Werkes aufgespürt, die darin besteht, dass es einerseits vom Leser inspiriert, aber auch seinerseits für den Leser zur Inspiration wird. Ungeachtet der bildhaften Bezüge, der behandelten Themen und der Analogien besteht der Berührungspunkt zum Evangelium in eben dieser Durchlässigkeit vom Text hin zum Kontext und umgekehrt. Somit haben wir es mit einer Erzählung zu tun, die gleichzeitig auch existenzieller Wegweiser ist und finden in ihr eine literarische Figur, die zuallererst Mensch und dann auch Vorbild ist.
Ciaccios Anliegen ist es dabei nicht so sehr, aus dem Text eine Christologie abzuleiten. Vielmehr entdeckt er im Texttypus des biblischen Gleichnisses das der Erzählung zugrundeliegende versteckte Muster. Die eigentliche Frage, auf die das Buch unterschwellig hinausläuft, geht über die Harry-Potter-Erzählung hinaus. Es geht um die Möglichkeit, in einem unserer Kulturindustrie entsprungenen Produkt eine filigrane Verschlüsselung des Evangeliums auszumachen. Eine solche Absicht stellt die traditionelle Bibelwissenschaft vor nicht geringe Probleme, auch im Hinblick auf Fragen der semiotischen Übertragbarkeit. Ciaccio folgt einer Vielzahl von Blickrichtungen und bedient sich ganz unterschiedlicher Verfahren, um die heidnische, sowie auch die christologische Tradition, die offensichtlich in Rowlings Werk hineingeflossen ist, aufzuzeigen.
Ob dieser Weg letztlich begangen werden kann, ist zumindest noch ungewiss: Aber genau das ist, in der Substanz, die Frage – und die Möglichkeit – die dieses Buch aufwirft.
Dario E. Viganò
Vorsitzender der italienischen Filmstiftung „Fondazione Ente dello Spettacolo“