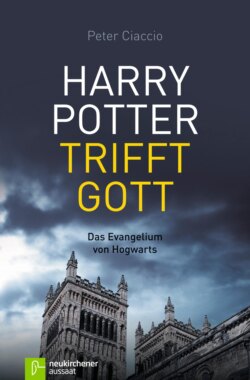Читать книгу Harry Potter trifft Gott - Peter Ciaccio - Страница 8
1. Magie und Theologie
ОглавлениеMr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nr. 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein, sehr stolz sogar.
(Stein der Weisen, 1)
Ihr sollt nicht Wahrsagerei noch Zauberei treiben.
(3. Mose 19,26b)
Der Titel der italienischen Originalausgabe Das Evangelium nach Harry Potter könnte in den Augen vieler als ein recht gewagter, wenn nicht blasphemischer Titel anmuten, scheinen doch Zauberei und Theologie zwei unvereinbare, einander befeindende Gegenpositionen zu beschreiben. In der christlichen Tradition wurde diese Sichtweise über die Jahrhunderte hindurch, mitunter auch in obsessiver und sogar blutiger Weise, (aus-)gelebt und überliefert. Die Hexenjagd war in der christlichen Welt eine derart verbreitete Praxis, dass sie sogar sprichwörtlich geworden ist. Nun ist es aber nicht unsere Absicht, diejenigen zu verurteilen, die nicht zu den Befürwortern des jungen Zauberers zählen – vielmehr wollen wir, angetrieben von der Leidenschaft für das Evangelium und für gute Literatur, erhellen, wie sich die Autorin Joanne K. Rowling bei der Inspiration zu ihren Büchern in mehr oder weniger expliziter Weise von der Bibel und vom christlichen Weltbild leiten ließ und welche geistliche Erbauung die Leser und Leserinnen aus ihren Büchern ziehen können.
Harry Potter ist zum bekanntesten Zauberer der Gegenwartsliteratur geworden und inzwischen auch Hauptfigur verschiedener Filme und Gegenstand intensiven Merchandisings und hat sich auf diese Weise einen festen Platz in der Vorstellungswelt der Massen erobert. Als literarische Figur eines Zauberers befindet er sich dabei in guter Gesellschaft mit Gandalf, der Blauen Fee, Merlin, Mandrake oder Gundel Gaukeley. Trotzdem unterscheidet sich Harry von seinen „Kollegen“ durch die Tiefgründigkeit, mit der diese Figur ausgearbeitet wird, ferner durch den Detailreichtum der Erzählung und die Vielzahl der in ihr angerührten Themen sowie nicht zuletzt durch den Anspruch des Werkes, die Heranreifung eines Jungen von elf Jahren bis hin zum Erwachsenenalter zu illustrieren. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich Rowling von den großen in der Kinderliteratur der westlichen Tradition behandelten Themen inspirieren lassen, nämlich von der Klassik, den nordischen und keltischen Sagen sowie auch von der christlichen Verkündigung.
In der Erzählung hat die literarische Figur des Harry Potter nur einen unbeugsamen Feind: Lord Voldemort. Im wirklichen Leben sind der Kritiker jedoch viel mehr – ins Auge stechen unter diesen insbesondere erbitterte Kritiker aus den Reihen einiger christlicher Gruppierungen oder einzelne Christen. Um sich davon zu überzeugen, wie viel Groll und wie viel Feindseligkeit dem sympathischen jungen Zauberer, mehr noch dessen Erfolg, entgegengebracht wird, genügt es, sich einmal im Internet umzuschauen. Als ein Beispiel aus den Reihen der Katholiken sei hier die deutsche Literaturkritikerin Gabriele Kuby genannt, die in den Jahren 2002 und 2003 eine Reihe polemischer Aufsätze über die Potter-Saga schrieb und dafür prompt Applaus von Joseph Ratzinger erntete, der seinerzeit noch als Kardinal amtierte und der katholischen Glaubenskongregation vorstand. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass es sich bei dem Amt, das der heutige Papst damals bekleidete, um die Nachfolgeinstitution der Heiligen Inquisition handelt, welche jahrhundertelang vermeintliche Hexen verfolgt hatte. Nichtsdestoweniger muss man zugeben, dass die weitaus meisten Kritiken dieser Art aus der evangelischen Welt zu verzeichnen sind, auch wenn sich dies vielleicht darauf zurückführen lässt, dass Bücher in protestantischen Ländern traditionell einen größeren Einfluss ausüben. Bereits 2002 veröffentlichte der evangelikale Verlag Chick Publications einen Comic-Strip, in welchem die christlichen Eltern dazu aufgefordert wurden, den „okkulten Dreck“ in Gestalt der Harry-Potter-Bücher zu zerstören, um die Kinder vor der Hölle zu retten. Im Jahre 2009 erklärte einer der Ghostwriter von George W. Bush, Matt Latimer, dass er während seiner Amtszeit verhindern konnte, dass Joanne K. Rowling die vom Präsidenten zu verleihende Auszeichnung für Freiheit erhielte, da sie seiner Ansicht nach mit ihren Büchern zur Ausübung der Hexerei anstifte.
Solche Befürchtungen mögen denjenigen unter uns, die die Harry-Potter-Bände gelesen haben, ganz und gar unglaublich erscheinen und zudem den Zweifel aufkommen lassen, ob derartige Kritiken sich nicht lediglich auf die Tatsache gründen, dass Rowling von Zauberei schreibt, dabei jedoch unberücksichtigt lassen, wie die Autorin das tut. Außerdem wirft es die Frage auf, ob es sich somit überhaupt um echte Kritiken handelt und nicht vielmehr um ideologisch motivierte interpretatorische Verrenkungen. Die Rolle, die der Zauberei in der Geschichte von Harry Potter zukommt, ist in der Tat sehr speziell erdacht und zeichnet sich durch eine besonders originelle Eigenschaft aus, denn Zauberei ist hier eines der Elemente der Natur (oder, theologisch gesprochen, ein Teil der Schöpfung) und kein Blendwerk des Satans. So schwer ist es, die Zauberei zu beherrschen, dass man dies sogar eigens in der Schule erlernen muss, genauso wie dies für uns Muggel1 (das heißt, für uns als nicht-magische Menschen) bei Fächern wie Latein, den Naturwissenschaften oder Deutsch der Fall ist. Außerdem ist es so, dass die Zauberer und Hexen in der Erzählung von Natur aus Zauberkräfte haben, so wie wir Muggle von Natur aus keine magischen Fähigkeiten besitzen. Bei der Lektüre von Harry Potter kommt man zudem nicht umhin festzustellen, dass die menschliche Wissenschaft in manchen Fällen sehr viel wirkmächtiger ist als die Zauberei oder doch zumindest viel praktischer. Mithilfe der Zauberei kann Harry beispielsweise eine Brille wieder reparieren, nicht aber die Kurzsichtigkeit korrigieren, was doch im Gegensatz dazu mithilfe eines chirurgischen Eingriffs, der heute zur Routine geworden ist, geschehen kann. Wenn also feststeht, dass eine Operation im Krankenhaus sicherlich ein weniger angenehmes Unterfangen ist als das Schwenken des Zauberstabs, leuchtet es aber auch andererseits ein, dass das Telefon oder Internet doch sehr viel praktischer sind als das von den Zauberern verwendete Flohpulver. Es gestattet ihnen zwar, durch Schornsteine hindurchzusprechen, diese sind jedoch weitaus umständlicher zu transportieren als Mobiltelefone. Gar nicht erst zu reden von dem Zauber, welcher im vierten Band den Feuerkelch vor unberechtigtem Zugriff schützt: Hier hätte die Installation einiger Webcams die Rückkehr von Voldemort vielleicht besser zu verhindern gewusst!
Wie dem auch sei – es ist beeindruckend zu sehen, wie sehr Rowling mit diesen ideologischen Kritiken im Vorhinein gerechnet und sie vorweggenommen hat. Denn, ja, auch diese Befürchtungen haben in der von ihr geschaffenen Welt einen Platz. Dort wird er von den Dursleys aus dem Ligusterweg, d. h. von Harrys unerträglichem Onkel Vernon und der ebenso unerträglichen Tante Petunia eingenommen. Sie verkörpern die ideologisch motivierten Kritiker von Harry Potter und greifen ihnen voraus. Mit den wunderlichen Eigenschaften, die der kleine Harry von seiner Mutter Lily, der Schwester Petunias, geerbt hat, wollen sie nichts zu tun haben. Deshalb führen sie ein tristes Leben, das vielleicht noch trauriger ist als das, welches sie dem armen Harry zugedacht haben, der jahrelang bei ihnen in der Rumpelkammer unter der Treppe wohnen musste. Vernon und Petunia verkörpern den Mann und die Frau von der Straße, für die nur der äußere Schein zählt und die ansonsten lediglich für den Fernseher leben. Tante Petunia ist mager und nervös, während Onkel Vernon und Cousin Dudley fettleibig und gewalttätig sind. Dies ist eine Folge der Wahl, die sie für ihr Leben getroffen haben und in welchem für die Fantasie nicht der geringste Platz bleibt.
Unsere Welt braucht die Fantasie, um weiterleben und Hoffnung kultivieren zu können: Dies scheint die Botschaft des SOS-Rufes zu sein, den Joanne K. Rowling und mit ihr die bedeutendsten Schriftsteller der fantastischen sowie der Kinder- und Jugendliteratur ausgesendet haben, angefangen von Jules Verne über C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien bis hin zu Michael Ende und dem italienischen Kindergeschichten-Erzähler Gianni Rodari. Auch der Glaube, so erlauben wir uns hinzuzufügen, bedarf der Fantasie, um zu begreifen, dass diese Welt voller Gewalt und Ungerechtigkeit nicht diejenige ist, die sich Gott einst erträumte. So ist es in der Tat auch kein Zufall, dass beispielsweise in Italien militante Atheisten wie die Astrophysikerin Margherita Hack und der Mathematiker Pier Giorgio Odifreddi zu den „Feinden“ von Harry Potter zählen.
Der zu Beginn des Kapitels zitierte Text aus dem dritten Buch Mose verbietet uns nicht etwa, die Harry-Potter-Bücher zu lesen oder mit den Schulkameraden auf Muttis Küchenbesen reitend Harry Potter zu spielen, sondern er ruft uns dazu auf, unser Vertrauen nicht in diejenigen Menschen zu setzen, die uns ein besseres Leben versprechen, indem sie sich etwas zunutze machen, dass sie uns als „Magie“ verkaufen. Mit anderen Worten: Diese Zeilen richten sich eher gegen eine Kultur, die dem Lotto und der Glücksspirale verfallen ist, als gegen die Hexe Madam Mim aus Entenhausen. Hinzu kommt, dass dem biblischen Vers die Worte „Ihr sollt nichts essen, in dem noch Blut ist“, vorangestellt sind. Das ist eine Weisung, die viele von uns nicht beachten, obwohl wir doch nicht auf die Idee kämen, uns deswegen nicht als Christen zu bezeichnen. Das bedeutet nun nicht, dass wir die Bibel nicht ernst nehmen sollen – es ist vielmehr so, dass wir, gerade weil wir sie ernst nehmen, nicht beim Buchstaben stehen bleiben können, sondern in die Tiefe gehen müssen, und dies mit der Hilfe des Heiligen Geistes und der Fantasie.
1 Anmerkung der Übersetzerin: Als Muggel werden in den Potterbänden alle nichtmagischen Menschen bezeichnet, die in der realen Welt leben, deshalb bezeichnet sich der Autor auch gern selbst als Muggel.