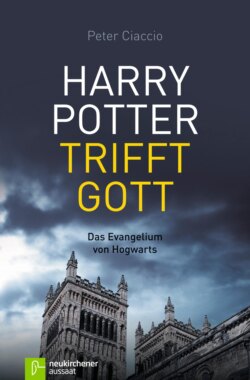Читать книгу Harry Potter trifft Gott - Peter Ciaccio - Страница 9
2. Das Herz eines Kindes
Оглавление„Trotz aller Versuchung, der du standgehalten hast, trotz all deiner Leiden bist du nach wie vor reinen Herzens, genauso rein, wie du im Alter von elf Jahren warst …“
(Halbblutprinz, 23)
Wahrlich, ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.
(Lukas 18, 17)
Anlässlich des Erscheinens des ersten Films und des vierten Buches im Jahre 2001 wurde das „Phänomen Harry Potter“ zum Gegenstand verschiedener TV-Programme. So widmete auch das meistgesehene Klatschmagazin des italienischen Fernsehens Porta a porta den vermeintlichen Gefahren für unsere Kinder, die von den Geschichten des kleinen Zauberers ausgehen, eine Sendung, in der gemutmaßt wurde, ob die Erzählung nicht ein Transportmedium für satanisches Gedankengut sei. Wie immer bei solchen Diskussionsrunden, verliert sich das eigentliche Thema in dem Aufheben, das die Teilnehmer um ihre eigene Person machen. Konkret lässt sich das im Falle von Pater Gabriele Amorth festmachen, der vielleicht der bekannteste Exorzist der römisch-katholischen Kirche ist und auch an dem Okkultisten und im italienischen Fernsehen allseits präsenten Fernsehmagier Marco Belelli, auch unter dem Pseudonym Divino Otelma bekannt, der sich selbst als eine Reinkarnation Gottes bezeichnet. Auch ohne die Sendung selbst gesehen zu haben, kann man sich leicht ausmalen, wie die Diskussion abgelaufen ist und wie jeder der beiden Gesprächsteilnehmer in dem jeweils anderen sein erklärtes Feindbild gefunden hat. Und doch verhielt es sich so, wie es Umberto Eco in einem seiner Streichholzbriefe befand, dass nämlich diese beiden erwachsenen Männer, die sich als Gegner sahen, die Gemeinsamkeit hatten, dass sie beide an die Existenz von Zauberern und Hexenwerk glaubten.
In diesem Aufsatz, in dem er die Gegner von Rowling kritisierte, war es Umberto Eco ferner ein Leichtes, in dem Werk der Autorin die drei bedeutenden roten Fäden der Kinder- und Jugendliteratur aufzuspüren: Erstens das hässliche Entlein, also das Kind, das sich in einer schrecklichen Situation befindet, jedoch von edler Abstammung ist und eine strahlende Zukunft vor sich hat; zweitens die Schule in ihrer vom literarischem Standpunkt aus gesehenen klassischen Internats-Gestalt, das heißt als College oder als englisches „Internat“, in der die Schüler nicht nur die Fächer des Lehrplans erlernen (wenn sie das denn schaffen!), sondern in der sie zusammen leben und aufwachsen und drittens in der Magie. Im Hinblick auf die vermutete Gefahr für die Kinder, die von den Harry-Potter-Werken ausgehen soll, spricht der Semiotiker Umberto Eco die gesunde Angst an, die Kinder vor menschenfressenden Ungeheuern haben und die sie darauf vorbereitet, sich als Erwachsene um das Fortschreiten des Ozonlochs zu ängstigen. Er stellt diese Furcht der Ignoranz derjenigen entgegen, die als Erwachsene noch an selbsternannte Magier glauben und sich vor dem bösen Blick etc. fürchten.
Es ist offenkundig, wie deplaziert die Befürchtungen des Exorzisten Amorth schon allein aus zwei Gründen sind: Erstens resultiert die Kritik an Harry Potter aus einer ideologisch verbrämten Haltung und zweitens werden diese Geschichten nicht als das wahrgenommen, was sie sind, nämlich Bücher für Kinder, die im Heranwachsen begriffen sind. Wie Eco sagt, unterstützen diese Bücher die Kinder in ihrer Entwicklung, und er bemerkt treffend, wie auffällig es ist, dass viele, wenn sie erst einmal erwachsen geworden sind, vergessen, dass der Literatur in der Kindheit eine solch grundlegende Rolle bei der Entwicklung zukommt. Im unbestritten kinderlieben Italien zeichnet sich in den Nachrichtensendungen des Fernsehens und in den Sonderberichterstattungen häufig eine fassungslose Ungläubigkeit angesichts der in ihnen vermeldeten grässlichen Verbrechen ab und es wird die Frage aufgeworfen, wie man denn Kindern überhaupt begreiflich machen könne, dass solche Dinge auf der Welt geschehen. (M. E. sollten sich die Medienmacher lieber die Frage stellen, wie man Erwachsenen von derartigen Ereignissen berichten kann und ob man das überhaupt tun sollte, aber dies ist ein anderes Thema.) Die Frage lässt sich verallgemeinern, denn wie, so muss man sich fragen, soll man Kindern die Existenz des abgrundtief Bösen erklären, das auch die Erwachsenen selbst nicht begreifen können? Die Kinderliteratur hat hierfür eine Antwort gefunden und erzählt uns vom Däumling, dem es gelingt, den Menschenfresser zu besiegen, von Pinocchio, der den Kinderhändlern entkommt, und von Rotkäppchen und seiner Großmutter, die zuerst vom bösen Wolf verspeist, dann aber vom Jäger gerettet werden.
In diesem Buch, geschrieben vom Standpunkt eines Theologen aus, soll nun aber das Verhältnis zwischen Literatur und Theologie untersucht werden; daher werden wir uns mit der Frage der Kinderliteratur nicht im Detail beschäftigen. Gleichwohl sollte man berücksichtigen, dass der Ausdruck „Kinderliteratur“ nicht universell akzeptiert wird und dass namhafte Schriftsteller wie J. R. R. Tolkien diese Bezeichnung grundsätzlich beanstandet haben. Interessierte, die diesen Aspekt vertiefen möchten, verweise ich auf Tolkiens Essay Über Märchen aus der Sammlung Baum und Blatt (Frankfurt/M; Berlin; Wien; Klett Cotta im Ullstein Taschenbuch, 1982), aus dem ich hier nur einen interessanten Gedanken wiedergeben möchte: Kinder brauchen keine eigene Literatur, denn Kinder sind nicht etwa eine „eigene, aus sich selbst heraus existierende Spezies, gar eine eigene Gattung“ – vielmehr sollten wir sie als „normale, wenngleich noch unreife, Mitglieder einer speziellen Familie und der Familie der Menschheit im Allgemeinen“ ansehen. Bei Erwachsenen, die sich angewöhnt haben, selbst auch Kinderbücher zu lesen (nicht nur zum Vorlesen für ihre Kinder, sondern zu ihrem eigenen Vergnügen), dauert es nicht lange, bis sie zu der Überzeugung gelangen, dass Kinder- und Jugendliteratur sich eigentlich nicht vom Inhalt her als solche definieren lässt. Kategorisiert als solche wird sie eher dadurch, dass der Herausgeber sie mit meist kartonierten Buchdeckeln in besonders grellen Farben auf einem minderwertigeren, mit größerer Schrift bedrucktem Papier und in illustrierter Form veröffentlicht. Interessant ist, dass das britische Verlagshaus Bloomsbury, das die Originalausgabe von Harry Potter herausgibt, auch eine Ausgabe der Saga „für Erwachsene“ in Druck gegeben hat, die eine nüchternere Gestaltung des Buchdeckels und eine kleinere Schrift aufweist – vereinfacht gesprochen handelt es sich um eine Ausgabe, bei deren Lektüre der kultivierte Leser nicht befürchten muss, den Eindruck zu erwecken, dass er ein großes Kind geblieben sei. Trotzdem werde ich mich in diesem Buch weiterhin an den gängigen Gepflogenheiten orientieren und den Begriff „Kinder- und Jugendliteratur“ bzw. „Kinderliteratur“ verwenden.
Harry Potter ist ein Junge, den wir beim Übergang zum Jugendalter bis hin zum Erreichen des Erwachsenenalters begleiten. Aber was für eine Art Junge ist Harry eigentlich? Er ist eine „Brillenschlange“, kleiner als die anderen Kinder, nicht besonders gutaussehend und seine Stirn ist von einer Narbe gezeichnet, die ihn bei jedem Blick in den Spiegel daran erinnert, dass er seine Eltern viel zu früh verloren hat. Harry ist also ein Junge, der innerlich leidet und der alle Voraussetzungen erfüllt, um in der Schule das perfekte Ziel für die Hänseleien und Drangsalierungen der Mitschüler abzugeben. In der Tat idealisiert Rowling, im Gegensatz zu anderen bekannten Kinderbuchautoren, die Kindheit keineswegs. Kinder sind ein Teil derselben Spezies wie die Erwachsenen (würde Tolkien sagen) und reproduzieren im Kleinen die mehr oder weniger bösartigen, mehr oder weniger niederträchtigen und mehr oder weniger irrationalen Verhaltensweisen der Erwachsenen. In Hogwarts trifft Harry Potter die Freunde, die ihn ein Leben lang begleiten werden, er verliebt sich dort sogar (mehr als einmal) und zeigt sich dabei genauso verwirrt wie jeder andere Junge, wenn das Hormongewitter zum ersten Mal über ihn hereinbricht. Aber Hogwarts ist auch der Ort, an welchem er schrecklichen Gestalten wie beispielsweise Draco Malfoy oder Crabbe und Goyle begegnen muss, die für die drei Freunde Harry, Ron und Hermine zu Erzfeinden werden.
Harry ist ein gewöhnlicher Junge, in dem sich viele Menschen wiederfinden können, auch Erwachsene. Dies ist sicherlich einer der Bausteine, die den Erfolg der Saga ausmachen, aber hieraus ergeben sich auch interessante und wertvolle Betrachtungsmöglichkeiten. Kinder sind nicht vor dem Bösen geschützt, aber sie reifen dadurch, dass sie Entscheidungen treffen müssen, die sie vor eine Wahl stellen. Eine Wahl trifft man nicht erst als Erwachsener, sondern schon von Kindesbeinen an.
Diese Sichtweise der britischen Schriftstellerin ist nicht nur eine Anfrage an das komplette Bildungssystem, sondern, was für uns von besonderem Interesse ist, auch an die Religions- und Glaubensvermittlung, die in unseren Kirchen praktiziert wird. Denken wir nur einmal daran, wie Jesus den Kindern oft vorgestellt wird, nämlich als ein gefälliger Gutmensch, der Kinder liebt und ebenso deren Mütter und Väter. Die kontroversen Aspekte der Person Jesu werden einfach weggelassen. Als Folge davon formt sich somit das Bild eines fernen Jesus, der sich mit dem alltäglichen Leben nicht oder nur schwer in Verbindung bringen lässt. Es ist ein „Jesus für Kinder“, von dem man spätestens dann Abstand nimmt, wenn im Laufe des Heranreifens der Ernst und die Härte des Lebens spürbar werden, genauso wie man dann auch die Bücher von Pinocchio oder Alice im Wunderland nicht mehr zur Hand nimmt.
In den Evangelien lesen wir davon, dass Jesus die Kinder in besonderer Weise annimmt und sich darin oft von den Aposteln unterscheidet. Denken wir an die Szene, in der er die Jünger dafür tadelt, dass sie versucht haben, die Kinder, die zu ihm kommen wollten, abzuhalten: „Lasst die Kinder zu mir kommen. Haltet sie nicht zurück! Denn das Himmelreich gehört ihnen.“ (Matthäus 19,14; NLB)
Oder erinnern wir uns an die Begebenheit, bei der Jesus, nachdem die Jünger ihn gefragt hatten, wer denn der Größte unter ihnen sei, ein Kind zu sich ruft und sagt: „Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.“ (Matthäus 18,3-5).
Zudem folgt auf diesen Vers eine der härtesten und unerbittlichsten Ermahnungen, die Christus je ausgesprochen hat: „Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist.“ Kinder stehen auch im Mittelpunkt dessen, was sich nach Jesu triumphalen Einzug in Jerusalem ereignete (Matthäus 21), als die jubelnde Menge angesichts der Vertreibung der Händler aus dem Tempel verstummte. Die Einzigen, die weiterhin „Hosianna dem Sohn Davids!“ riefen und Palmzweige schwenkten, waren die Kinder. Die Hohenpriester und Schriftgelehrten sind vom Verhalten der Kinder entrüstet und es hat den Anschein, als verlangten sie von Jesus eine Erklärung dafür. Jesus antwortet ihnen, indem er Psalm 8,3 zitiert: „Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen.“
Zusätzlich zu diesen Texten aus der synoptischen Tradition gibt es im Evangelium des Johannes noch einen weitern wichtigen Absatz, der nicht direkt von Kindern spricht, der jedoch im Lichte unserer Überlegungen sehr interessant ist:
Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den oberen Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: „Meister, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist.“
Jesus erwiderte: „Ich versichere dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.“
(Johannes 3,1-3)
Diese Zeilen sind insoweit für uns interessant, als die neue Geburt die Assoziation einer neuen Kindheit wachruft und weil Jesus hier, genauso wie in Matthäus 19, erklärt, wie man in das Reich Gottes gelangen kann.
Es ist klar, dass das Thema der neuen Geburt sehr viel umfangreicher ist und nicht bloß mit einer Reflexion über die Kindheit erfasst werden kann. Aber es ist auch klar, dass die Bibel vom Gläubigen erwartet, dass er sich Kindern gegenüber in einer Weise verhält, die sich sehr von der Einstellung unterscheidet, mit der Kinder in der „Welt“ behandelt werden. In der Welt werden Kinder oftmals misshandelt, denn im Allgemeinen ist ihre Lebenssituation nicht so, wie wir es in unseren Breiten gewohnt sind. Manche werden zum Arbeiten gezwungen und ausgebeutet, wenn nicht sogar sexuell missbraucht. Die internationale Konvention zum Schutz der Kinderrechte ist erst wenig älter als 20 Jahre (sie wurde im Jahre 1989 durch die Generalversammlung der UNO bewilligt) und die Welt von heute tut sich noch immer schwer dabei, auch die Menschenrechte zu „globalisieren“.
Für die Bibel haben Kinder eine Rolle, die Erwachsene ihnen normalerweise absprechen wollen, und als Gott Fleisch wurde, tat er das nicht in Gestalt eines erwachsenen, sozusagen „gebrauchsfertigen“ Menschen, sondern in einem Neugeborenen. Um wie ein Mensch zu sein, ist es unverzichtbar, zuvor ein Kind gewesen zu sein. Auch in der Art und Weise, in der man die Menschwerdung Christi zu Weihnachten interpretiert, blitzt die Sündhaftigkeit des Menschen auf: Häufig wird das Jesuskind dargestellt wie ein gezähmter und verweichlichter Gott, der bestimmt nicht weinte und den Eltern sicherlich immer gehorchte – ein Vorbild für unartige, widerspenstige Kinder. Die aktuelle Ausgabe des von den Mitgliedsgemeinden des Bundes evangelischer Kirchen in Italien verwendeten Gesangbuches ist gegen diese verzerrte Darstellung zum Glück einigermaßen immun. Aber bereits in der dritten Strophe des herrlichen englischen Chorus Once in Royal David’s City von Cecil Frances Alexander (1848), mit dem traditionell der Heiligabendgottesdienst eröffnet wird, heißt es:
And through all His wondrous childhood
He would honour and obey,
Love and watch the lowly Maiden,
In whose gentle arms He lay:
Christian children all must be
Mild, obedient, good as He.2
Die Harry-Potter-Saga stellt Kinder nicht nur in den Mittelpunkt der Erzählung, sondern thematisiert das Recht der Kinder auf ein beschütztes Leben. Leider ist ein solches Leben nicht möglich, da das Böse alle Menschen heimsucht, Erwachsene wie Kinder, ohne Unterschied. Der interessante Aspekt hierbei besteht gleichwohl darin, dass die jungen Protagonisten der Saga sich nahezu im gleichen Maße für ihre Taten verantwortlich zeigen müssen wie die Erwachsenen, und dass die Erwachsenen in den Fällen, in denen sie den Kindern keine Verantwortung einräumen, erkennen, dass dies ein folgenschwerer Fehler ist.
Ein Beispiel hierfür finden wir am Ende des fünften Bandes nach dem Tod von Sirius Black, für den Harry doch zumindest einen Teil der Verantwortung trägt und nicht umhinkommt, sich diese einzugestehen. Der Schulleiter Albus Dumbledore verblüfft Harry (und den Leser), als er die ganze Verantwortung für den Vorfall auf sich selbst nimmt:
„Wenn ich offen zu dir gewesen wäre, Harry, wie ich es hät,te sein sollen, hättest du schon vor langer Zeit erfahren, dass Voldemort womöglich versuchen würde, dich in die Mysteriumsabteilung zu locken, und man hätte dich nie überlisten können, heute Nacht dort hinzugehen. Und Sirius hätte dir nicht folgen müssen. Diese Schuld liegt bei mir, und bei mir allein. […] Harry, ich schulde dir eine Erklärung […] Eine Erklärung zu den Fehlern eines alten Mannes. Denn ich sehe jetzt, dass das, was ich im Hinblick auf dich getan und nicht getan habe, alle Merkmale der Schwächen des Alters trägt. Die Jugend kann nicht wissen, wie das Alter denkt und fühlt. Aber alte Menschen machen sich schuldig, wenn sie vergessen, was es hieß, jung zu sein … und wie es scheint, habe ich es in jüngster Zeit vergessen…“
(Orden des Phönix, 37)
Diese Worte von Dumbledore muten an wie ein echtes Sündenbekenntnis in protestantischem Stil, denn obwohl es offensichtlich ist, dass Harry in dieser Angelegenheit eine gewisse Schuld trifft, analysiert der Schulleiter den Vorfall in der Tat dahingehend, dass er den Fehler nicht beim anderen, sondern bei sich selbst sucht. Außerdem erzählt er dem Jungen von seinem eigenen Schwachpunkt, den Harry gegenwärtig noch nicht sieht, den er aber mit den Jahren noch kennenlernen wird: im siebten Band der Saga nämlich beschwert er sich darüber, dass Dumbledore ihn über so viele Dinge im Unklaren gelassen habe.
Der Tod von Sirius, so wie auch der anderer Vaterfiguren für Harry, ist notwendig für das Fortschreiten der Handlung auf dem Weg hin zu dem endgültigen Duell, in das die Saga gipfelt und bei dem der Held ganz allein dem Feind gegenübergestellt sein wird.
Dass sich Dumbledore seines eigenen Fehlers bewusst ist, ergibt sich daraus, dass der Schulleiter Harrys Herz und seine vortreffliche Wesensart kennt. Dies ist bereits seit dem ersten Buch offenkundig, als sich zeigte, dass sich die List, mithilfe derer Voldemort daran gehindert werden sollte, sich den Stein der Weisen anzueignen, auf das Vertrauen gründete, dass der Schulleiter in den Jungen gesetzt hatte: „Sieh mal, nur jemand, der den Stein finden wollte – finden, nicht benutzen – sollte ihn bekommen können …“ (Stein der Weisen, 17)
Harry ist ein Junge, dem das Leben bereits als kleines Kind grausam mitgespielt hat, und trotzdem ist er fähig, das wenige Gute, das er erhält, wertzuschätzen. Er ist aus tiefem Herzen uneigennützig. Nicht alle Kinderherzen sind so beschaffen, aber das Herz dieses speziellen Jungen und die Herzen seiner Freunde Ron, Hermine, Ginny, Neville, Luna und der anderen, sind es.
Natürlich entsteht Herzensgüte nicht aus dem Nichts heraus, sondern schöpft aus der Liebe, die das Kind selbst erhalten hat. Sogar Draco Malfoy beweist im Laufe der Saga mehr Verstand als die Erwachsenen, da er von der Mutter Narzissa geliebt und von Dumbledore und Snape umsichtig beschützt wird. Tom Riddle hingegen wird im Laufe der Zeit zu dem mächtigen, bösen Zauberer Lord Voldemort, weil er ohne Liebe aufgewachsen ist; er hat ein böses Herz, das die Fähigkeit zur Reue nicht besitzt und welches er sogar selbst verabscheut. Die Liebe, die der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Saga ist und auf die ich später noch zurückkommen werde, erweist sich auch dort von grundlegender Bedeutung, wo es darum geht, die Reinheit eines Kinderherzens zu schützen und zu bewahren.
2 Und während seiner wunderschönen Kinderzeit / ehrte er die demütige Jungfrau an jedem Tag / und war zum Gehorsam ihr gern bereit / in deren liebevollen Armen er sich barg: / Christliche Kinder haben eine Pflicht / sollen artig, brav, gehorsam sein wie er es ist.