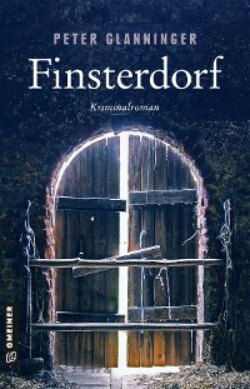Читать книгу Finsterdorf - Peter Glanninger - Страница 9
5.
ОглавлениеDer Akt gab nicht viel her. Da war die Vermisstenmeldung, in der die Mutter, Anette Lindner, am 7. September, einem Samstag, gegen 18 Uhr in der Polizeiinspektion Gresten eine Anzeige erstattet hatte, weil ihre 17-jährige Tochter Bernadette nicht nach Hause gekommen war. Bernadette war am Vorabend weggegangen und sollte eigentlich am Samstag arbeiten. Sie war als Friseurlehrling im Salon Doleschal in Schandau beschäftigt. Nachdem sie am Samstagmorgen weder zu Hause noch bei der Arbeit aufgetaucht war, hatten sich die Eltern Sorgen gemacht und sie gesucht. Vergeblich allerdings, daher hatte die Mutter am Samstagabend die Anzeige erstattet.
Auch der Erhebungsbericht war erwartungsgemäß mager. Die Kollegin, die den Fall zuerst bearbeitet hatte, hatte herausgefunden, dass Bernadette am Freitagabend mit einer Freundin bis gegen 23 Uhr im Gasthaus »Falk« in Schandau gewesen war. Danach hatte sich Bernadette verabschiedet und wollte nach Hause gehen. Ihre Freundin war noch geblieben. Aber Bernadette war nie zu Hause angekommen.
Die Kollegin hatte den Akt übers Bezirkskommando ans LKA geschickt, das für diesen Fall zuständig war. Hier hatten zwei weitere Kollegen von Radek an der Sache gearbeitet, Andrea Bosch und Josef Hammer. Nicht sehr eifrig, wie Radek unschwer anhand der Unterlagen feststellen konnte. Sie hatten eine Suchaktion veranlasst und die Eltern, den Arbeitgeber sowie einige andere Leute im Ort, Freunde und Bekannte, befragt. Einhelliges Ergebnis: Niemand hatte gewusst, wo Bernadette Lindner war.
Daraufhin hatten sie die Sache auf sich beruhen lassen. Sie hatten den Akt zwar nicht abgeschlossen, ihn aber mangels brauchbarer Ermittlungsansätze auch nicht weiterverfolgt. Außer dass Bernadette Lindner in die Vermisstendatei im Polizeicomputer aufgenommen worden war, war nichts Bemerkenswertes mehr passiert. Es schien ihnen egal gewesen zu sein.
Mehr als eine Woche später, am Morgen des 15. September, einem Sonntag, war Bernadette plötzlich wieder daheim aufgetaucht. Die Eltern hatten telefonisch die Polizei verständigt und einer der Kollegen hatte die Vermisstenmeldung widerrufen.
Als die zuständige Beamtin der Polizeiinspektion Gresten am Tag darauf zu Bernadette gefahren war, um sie wegen ihres Verschwindens einzuvernehmen, hatte das Mädchen verwirrt, geistesabwesend, verstört und verängstigt gewirkt. Auf die Frage, wo sie gewesen sei, hatte sie keine zufriedenstellende Auskunft gegeben, sondern erklärt, dass der Teufel sie geholt habe und sie bei ihm gewesen sei. Sie hatte sich aber geweigert, weitere Details zu erzählen. Der erbärmliche Zustand des Mädchens und ihr Beharren auf der Teufelsversion waren für die Kollegin ausschlaggebend gewesen, um einen satanistischen Hintergrund zu vermuten, und sie hatte das Landesamt für Verfassungsschutz eingeschaltet.
Die Leute vom LV fühlten sich zu Recht verarscht. Mit der süffisanten Bemerkung, dass sie nach Auflösung des Sektenreferats nicht mehr über die nötige Fachkenntnis verfügten, um den Sachverhalt qualifiziert beurteilen zu können, übermittelten sie den gesamten Akt zur weiteren Veranlassung ans LKA. Aus dem Anschreiben triefte der blanke Hohn.
Radek stöhnte. Das alles war purer Schwachsinn. Eine Jugendliche reißt von Zuhause aus, macht irgendwo Party, hängt mit irgendwelchen Typen ab, und als ihr die Kohle ausgeht, kommt sie zurück und faselt eine blöde Entschuldigung, damit ihr die Eltern vor Zorn nicht den Hals umdrehen. Und alle fallen auf dieses Gerede herein. Jetzt kommt das Landeskriminalamt und beginnt zu erheben. Das ist, als würde man einen Zeitungsdieb am Sonntag mit einem Einsatzkommando der »Cobra« festnehmen.
Was sollte Radek dort machen? Sich die Geschichte noch einmal anhören und dann feststellen, ob im Ort Satanisten am Werk waren? Mit dem, was er in der Hand hatte, würde er sich dabei nur lächerlich machen, sonst nichts. Jetzt war ihm auch klar, warum ihm Gierling diesen Job gegeben hatte. Kein alteingesessener Kriminalbeamter im LKA hätte sich freiwillig auf diese Scheiße eingelassen. Aber so war es. Auftrag ist Auftrag – wahrscheinlich würde er keine zwei Tage dafür brauchen.
Radek machte sich nichts vor. Seine Tätigkeit hier war nur ein Alibijob, um ihn ruhigzustellen. Den ganzen Sommer über saß er schon in seinem Büro und machte den Papierkram, vor dem sich die anderen drückten. Hätten sie keine Espressomaschine mit Kapseln gehabt, sondern eine Filtermaschine wie in früheren Tagen, hätten sie ihn wahrscheinlich auch zum Kaffeekochen eingeteilt, vermutete er. Eigentlich hätten sie eine Sekretärin gebraucht, keinen Kriminalbeamten.
Jedenfalls fühlte sich Radek hier wie lebendig begraben. »The pit and the pendulum« von Edgar Allan Poe fiel ihm häufig ein, wenn er am Schreibtisch saß – in seinem Fall in einer leichten Abwandlung: das Büro und das Pendel. Die immer niedriger werdende Decke der Gefängniszelle aus der Erzählung traf seine realen Empfindungen ziemlich genau.
Er brauchte etwas Sinnvolles zu tun.
Er hatte viel Zeit zum Nachdenken, deshalb war in ihm in den letzten Wochen der Entschluss gereift, neben dem Job noch etwas ganz anderes zu machen und ein Studium zu beginnen. Es war zuerst nur ein kleiner Gedanke gewesen, der sich aber hartnäckig festgesetzt hatte, ein Samenkorn, das zu keimen begann, aus dem ein Pflänzchen wuchs. Früher, nach dem Gymnasium, war das für ihn nie eine Option gewesen, doch je mehr er darüber nachdachte, desto reizvoller erschien ihm dieser Gedanke.
Geschichte hatte ihn immer schon interessiert. Warum sollte er es nicht studieren? Er hatte sich informiert und schließlich war ihm klar geworden: Er würde es tun. Er hatte keine Ahnung, ob er das mit Studium und Job auf die Reihe kriegen würde. Aber er wollte es versuchen. Er könnte sich seinen Dienst so einteilen, dass es ihm möglich war, zweimal pro Woche nach Wien an die Uni zu fahren. Mit dem Zug war das keine große Sache. Eine halbe Stunde Fahrt. Er war schneller in Wien als zu Hause.
Vor einer Woche hatte er sich einen Tag freigenommen, war nach Wien gefahren und hatte inskribiert, bevor er es sich anders überlegte. Er war bereits aufgeregt, wenn er nur daran dachte.
Doch jetzt würde er hinausgehen und erheben. Der Anlass war ein wenig enttäuschend. Auch wenn er diesen Job nur deshalb bekommen hatte, weil ihn kein anderer haben wollte, war er froh, hier mal rauszukommen – wenn auch nur für ein paar Tage.
Es brauchte mehrere Versuche, bis er die zuständige Kollegin, Revierinspektorin Susanne Steiger, auf der Polizeiinspektion in Gresten telefonisch erreichte. Zunächst zeigte sie sich verwundert, dass das LKA sich wieder für die Angelegenheit der Bernadette Lindner interessierte. Nachdem Radek ihr aber erklärt hatte, warum, konnte sie sich eine bissige Bemerkung zum Zuständigkeitswirrwarr in der Landespolizeidirektion nicht verkneifen. Radek ging nicht näher darauf ein, sondern kam schnell zum eigentlichen Grund seines Anrufs: Er wollte wissen, warum sie der Meinung war, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden des Mädchens und Satanismus gebe.
»Es war nur so eine Vermutung«, antwortete Susanne Steiger, »weil Bernadette immer nur vom Teufel gesprochen hat. Sie wollte mir nicht sagen, wo sie in der Zeit ihrer Abgängigkeit gewesen ist und was sie getan hat. Aber sie machte einen ziemlich verwirrten Eindruck, war verstört und verängstigt und sprach eben ständig vom Teufel.«
»Haben Sie Hinweise gefunden, die auf Satanismus deuten?«
»Welche Hinweise meinen Sie?«
»Symbole, Zeichen, Tätowierungen, so etwas in der Art.«
»Nein … keine Ahnung … Ich weiß nicht, welche Symbole für Satanismus typisch sind.«
Radek verdrehte die Augen. Das hatte er vermutet, sonst hätte sie entweder keine Meldung weitergeschickt oder ihren Verdacht näher begründet. Er versuchte, noch mehr über die näheren Umstände zu erfahren, die die Kollegin in Gresten dazu veranlasst hatten, diesen Satanismusverdacht zu formulieren, aber außer dem bereits Genannten gab es keine Anzeichen. Schließlich teilte er ihr mit, dass er den Auftrag habe, sich die Angelegenheit näher anzusehen, und am Montag nach Gresten komme.
Sie sei im Dienst, antwortete sie.
Vielleicht könne sie es sich so einteilen, dass sie am Montag für ihn verfügbar sei. Dienstlich natürlich, fügte er hinzu, als er die Doppeldeutigkeit seines Verlangens bemerkte.
Sie lachte. Ja, das lasse sich einrichten, antwortete sie, dienstlich natürlich.
Dann beendeten sie das Gespräch. Zumindest hat sie Humor, dachte Radek.
Radek begann zu recherchieren. Auf der Homepage des Landeskriminalamts gab es eine 15 Jahre alte Broschüre zum Thema Satanismus. Das war alles, sonst nichts.
Aber er fand den Verfasser der Broschüre im internen Telefonbuch, ein Kollege vom Landesamt für Verfassungsschutz.
Radek rief ihn an und erwischte ihn sofort.
»Ja, früher haben wir uns auch mit Sekten und Satanisten beschäftigt«, erklärte der LV-Mann auf Radeks Frage. »In den letzten Jahren hat das niemanden mehr interessiert. Zu viel Aufwand.« Der Kollege schwieg. Vielleicht wartete er auf weitere Fragen. Doch nachdem Radek keine stellte, er wusste nicht, welche, fuhr er fort: »Außerdem glaube ich, dass es in Österreich keine Satanisten gibt. In diesem Bereich ist in den letzten Jahren nichts Nennenswertes passiert, keine spektakuläre Amtshandlung oder so. Möglicherweise laufen ein paar Jugendliche herum und machen sich einen Spaß daraus, die Erwachsenen mit ein bisschen Hokuspokus zu schockieren. Aber sonst? Eventuell einige Goths, die, statt Party zu machen, Schwarze Messe feiern – oder beides miteinander verbinden. Von einer kriminellen Satanistengruppe habe ich jedoch noch nie gehört. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir in den letzten Jahren etwas hereinbekommen hätten. Friedhofsschändungen oder etwas in der Art.« Er dachte einige Augenblicke nach und bekräftigte dann: »Nein, nichts, überhaupt nichts.«
Das hatte Radek bereits vermutet. Auch er konnte sich nicht entsinnen, irgendwann in den letzten Jahren etwas über Satanisten gehört zu haben. Während seiner Gymnasiumzeit ging einige Monate lang das Gerücht herum, dass es in der Nähe von Krems einen Satanistenzirkel gebe, aber das wurde nie bestätigt. Darüber hinaus hatte er von diesem Thema nie wieder etwas gehört.
Nach dem Telefonat begann Radek im Internet zu suchen. Er hatte sehr schnell einige grundsätzliche Informationen zum Thema beisammen, druckte vieles davon aus und legte es in einem Aktenordner ab. Wirklich Brauchbares kam dabei nicht zutage. Und dieses Wenige war noch dazu widersprüchlich. Er fand Meinungen, dass alles übertrieben sei und es keine erwähnenswerten satanistischen Aktivitäten gebe, aber auch Expertenaussagen über extrem gefährliche satanistische Gruppen, die sogar vor sexuellem Missbrauch oder Ritualmorden nicht zurückschreckten. Das meiste bezog sich allerdings auf Deutschland. In Österreich war das letzte relevante satanistische Verbrechen im Jahr 2015 in den Medien aufgetaucht. Außerdem gab es einige Berichte von satanistischen Umtrieben im nördlichen Burgenland drei Jahre zuvor.
Also nicht gerade ein Gegenstand, der jede Woche mit mehreren Anlassfällen glänzte.
Als Nächstes suchte Radek im Netz nach Informationen zu Schandau. Aber auch das war nicht sehr aufschlussreich. Ein stinknormales Nest an der Ybbs im südwestlichsten Zipfel von Niederösterreich. Erreichbar über die B31, die Ybbstalstraße, zwischen Göstling und Hollenstein, wenn man aus Scheibbs anreiste. Die Gemeinde hatte 563 Einwohner. Nicht gerade eine Weltstadt, dachte Radek. Interessant erschien ihm lediglich, dass der Bürgermeister von der Bürgerliste »Die Schandauer« gestellt wurde. Und das mit einer überwältigenden Mehrheit. »Die Schandauer« verfügten über zehn von vierzehn Sitzen im Gemeinderat. Der Rest verteilte sich auf die Sozialistische Union, die Christlich-Konservativen und die Nationale Partei.
Die Gemeinde wurde am Ende des 12. Jahrhunderts gegründet und 1208 das erste Mal urkundlich erwähnt. Das Gebiet gehörte damals zum Lehen der Peilsteiner, einem der mächtigsten Adelshäuser des Landes Salzburg. Die Peilsteiner verfügten auch über Besitzungen in Niederösterreich und Südtirol. Da der Ort im Ybbstal an einem Übergang von Niederösterreich in die Steiermark lag, wurde die Burg Rotenstein erbaut. Als das Geschlecht der Peilsteiner Ende des 14. Jahrhunderts ausstarb, fiel das niederösterreichische Lehen an die Familie der Lenksteins. Die machten Burg Rotenstein zu ihrer Stammburg. Sie befand sich bis zum heutigen Tag durchgehend im Besitz der Familie und war daher auch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Schandau verlor ab dem 16. Jahrhundert zunehmend an Bedeutung, als andere Orte an neuen, strategisch wichtigeren Verkehrsverbindungen entstanden. Vom vergangenen mittelalterlichen Glanz zeugten, neben der Burg, die gotische Kirche aus dem 15. Jahrhundert, ein mittelalterlicher Pranger und ein steinerner Metzen, der auf das Jahr 1340 datierte. Neuzeitliche Sehenswürdigkeiten gab es keine. Heute teilte der Ort das Schicksal vieler ländlicher Gemeinden: zum Leben zu klein, zum Sterben zu groß.
Auf der dürftig ausgestatteten Webseite der Gemeinde fand Radek auch einige Fotos vom Ort. Ein idyllischer Flecken, so machte es den Eindruck. Während er an diesem Freitagnachmittag die Fotos betrachtete, reifte in ihm ein schneller Entschluss. Wenn er schon einen Job umgehängt bekam, bei dem nicht viel zu gewinnen war, warum sollte er nicht die Arbeit mit dem Vergnügen verbinden? Die Uni begann erst in zwei Wochen und bis dahin hatte er nichts vor. Weshalb sollte er sich nicht zwei Ferientage gönnen und einen Kurzurlaub in Schandau machen? Ein Buch, Laufschuhe, Wanderschuhe möglicherweise und zwei erholsame Tage am Ende der Welt würden ihm sicher guttun.
Er reservierte telefonisch im Gasthaus »Falk« ein Zimmer. Nun war er mit Gierling und der Situation, die er ihm mit dieser Satanismusgeschichte eingebrockt hatte, wieder versöhnt. Wenn schon keine vernünftige Amtshandlung, dann sollte wenigstens der Erholungswert stimmen, dachte er.