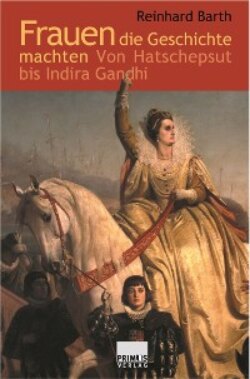Читать книгу Frauen die Geschichte machten - Reinhard Barth - Страница 10
Kleopatra
ОглавлениеDie ägyptische Traumfrau
Schon wenige Jahrhunderte nach der Entstehung der letzten Inschriften mit altägyptischen Hieroglyphen (griechisch »heilige Zeichen«) war in Vergessenheit geraten, wie sie zu lesen sind. Man deutete sie als Bilderschrift und entwarf die abenteuerlichsten »Übersetzungen«. Erst der Franzose Jean François Champollion (1790–1832) fand den Schlüssel zum Verständnis. Es war seine Idee, nicht die Bilder zu deuten, sondern den Zeichen Laute einer altorientalischen Sprache zuzuordnen. Und den letzten Beweis dafür, dass er richtig lag, lieferte ihm der Name der Frau, um die es hier geht und die damals schon 1850 Jahre tot war: Kleopatra.
Champollion hatte auf dem von napoleonischen Truppen aus Ägypten mitgebrachten Dreisprachenstein von Rosette im Text einige Wörter entdeckt, die offenbar zur Hervorhebung oval umrandet waren, also in einer so genannten Kartusche standen. Darin den Namen des Königs zu vermuten, lag nahe, und der lautete Ptolemaios, ausweislich der griechischen Übersetzung auf dem Stein. Doch die Basis von nur einem Namen war zu schmal für eine durchgängige Entzifferung des in Hieroglyphen abgefassten Textes. Erst als im Jahr 1815 der Obelisk von Philae gefunden und 1821 nach Europa gebracht worden war, fand Champollion weitere Hinweise für diese Theorie: Die Inschrift darauf zeigte ebenfalls den Namen Ptolemaios in einer Kartusche, dazu aber einen zweiten gerahmten, den die griechische Übersetzung mit Kleopatra wiedergab.
Jetzt waren Vergleiche möglich, jetzt begannen auch die anderen Wörter zu klingen, und die Steine fingen an zu reden. Viel Neues berichteten sie allerdings nicht. Immerhin ließen sich nun einige Inschriften und Dokumente übersetzen, die das von der römischen »Feindpropaganda« verfälschte Bild der Königin etwas korrigierten.
»Unsere« Kleopatra – es gab bereits sechs Vorgängerinnen gleichen Namens – kam gegen Ende des Jahres 69 v. Chr. als Tochter des ägyptischen Königs Ptolemaios XII. zur Welt. Er trug den Beinamen »Auletes« (Flötenspieler), weil er es sich nicht nehmen ließ, oft und gern selbst musikalisch zur Unterhaltung beizutragen. Vielleicht hatte die musische Vorliebe die Aufmerksamkeit des Königs für politische Entwicklungen etwas getrübt. Er wurde jedenfalls um das Jahr 60 v. Chr. durch Unruhen zum Verlassen seiner Residenz in Alexandria gezwungen und musste in Rom Hilfe suchen. Da er nicht unbeträchtliche Mittel beiseite geschafft hatte, fiel ihm das nicht schwer. Nachdem er die wichtigsten Entscheidungsträger, darunter Cäsar und den Feldherrn Pompeius, hinreichend bestochen hatte, konnte er im Jahr 55 v. Chr. mit römischem Militärbeistand wieder den ägyptischen Thron besteigen.
Wir wissen nicht genau, ob ihn seine kleine Tochter ins römische Exil begleitet hatte, doch spricht einiges dafür. Sie beherrschte jedenfalls neben vielen orientalischen Sprachen und neben dem Griechischen – der Vater entstammte ja einer griechischen Dynastie – auch das Lateinische fließend. Überhaupt wird ihre Bildung und charmante Weltläufigkeit in den Quellen hervorgehoben. Bemerkenswert vor allem auch, dass sie Ägyptisch verstand, für eine Ptolemäerin keineswegs selbstverständlich. Hier vermutet die Forschung den Einfluss der Mutter, über die leider nichts bekannt ist, die womöglich aber aus einer der vornehmsten ägyptischen Familien stammte.
Diese Verwurzelung im Staatsvolk hatte wohl auch dazu geführt, dass Kleopatras ältere Schwester Berenike nach Vertreibung des Vaters regiert hatte, die demnach ja ebenso eine Halbägypterin gewesen sein musste. Gegen den römischen Druck aber konnte sie sich nicht halten, wurde verhaftet und auf Befehl des Vaters umgebracht, ein Schicksal, das die damals 14-jährige Kleopatra eventuell hätte teilen müssen, wäre sie in Ägypten geblieben. Nichts beobachteten die Nil-Despoten aufmerksamer als das Verhalten möglicher Thronprätendenten in der eigenen Familie, wie am Schicksal aller Auletes-Kinder (mindestens sechs) zu sehen ist: Keines starb eines natürlichen Todes. Den ungewöhnlichsten allerdings erlitt Kleopatra selbst, und wie es dazu kam, das ist die Geschichte, die Dichter und Historiker seit ihrer Zeit nicht ruhen lässt.
Und sie können den Faden gar nicht früh genug aufnehmen. Schon beim griechischen Geschichtsschreiber Appian, der gut anderthalb Jahrhunderte nach Kleopatra in Ägypten lebte, finden wir die Behauptung, Auletes sei von den Römern wieder eingesetzt worden. Außerdem sei ein 27 Jahre junger Offizier namens Antonius dabei gewesen, der später als Mark Anton die halbe Welt regieren und die ganze beanspruchen sollte. Er sei damals der 14-jährigen Prinzessin Kleopatra begegnet und sofort von ihrem Liebreiz hingerissen gewesen. Gut ein Dutzend Jahre später sollte die Frau ihm zum Schicksal werden. Belege für die frühe Liebe auf den ersten Blick gibt es freilich nicht.
Bis zur ersten belegten Begegnung der beiden passierte aber noch viel. Kleopatra folgte dem Testament des Vaters. Im Jahr 51 v. Chr. heiratete sie als Königin der Tradition entsprechend ihren erst zehnjährigen Bruder Ptolemaios XIII. Kleopatra nahm den Beinamen »Philopator« (Vater-Liebende) an zum Zeichen, dass sie die Politik des Auletes fortzusetzen gedachte, was als Beruhigung der römischen Schutzmacht gedacht war. Rom wachte argwöhnisch darüber, dass die Regierenden in den formal selbstständigen Ländern keine Alleingänge unternahmen, und einer Frau gegenüber war man doppelt vorsichtig, insbesondere, wenn sie das reiche Nilland regierte.
Zunächst dominierte Kleopatra den jüngeren Bruder, doch dessen Berater wussten die Vorbehalte gegen weibliche Herrscher zu schüren. Bereits im dritten Regierungsjahr tauchten erste Inschriften mit beiden Herrschernamen auf, und wenig später sogar solche ohne Nennung Kleopatras, die von den Ratgebern des Bruders aus dem Machtzentrum Alexandria verdrängt worden und in den Süden des Landes nach Theben gegangen war. Auch Rom ließ sie nun fallen, denn in der Hauptstadt der Welt standen die Zeichen auf Sturm: Der Machtkampf zwischen Cäsar und Pompeius, von denen schon die Rede war, spitzte sich zu und entlud sich im ersten römischen Bürgerkrieg (49–46 v. Chr.).
Für Ägypten hieß das, äußerst vorsichtig und mit Zurückhaltung zu lavieren. Im Jahr 48 v. Chr. war klar, dass Cäsar die Oberhand behalten würde, denn er hatte den Truppen des Pompeius bei Pharsalos (Thessalien) eine vernichtende Niederlage beigebracht. Peinlich nur, dass sich der Geschlagene nun ausgerechnet nach Ägypten wandte. Dort aber war Kleopatra gerade dabei, ihre Position zurückzuerobern, sodass Pompeius zwischen die ägyptischen Fronten geriet. Ptolemaios und seine Ratgeber witterten nun doppelten Gewinn: Würde man Pompeius ausschalten, könnte man sich dem Sieger Cäsar nachhaltig empfehlen und diesen dann gegen Kleopatra benutzen. Pompeius wurde daher am 28. September des Jahres 48 v. Chr. auf Geheiß der Hofgesellschaft umgebracht. Drei Tage später traf Cäsar in Alexandria ein.
Für ägyptische Palastintrigen mochte die Gerissenheit der Räte des Ptolemaios ausreichen, ein Cäsar aber ließ sich so nicht ködern. Er trat als Schiedsrichter auf, der die Thronstreitigkeiten im Sinn des Testaments des Auletes schlichten wollte. Daher forderte er beide Seiten auf, ihre Truppen zu entlassen und sich seinem Spruch zu beugen. Kleopatra erkannte, dass es auf Sicht unsinnig wäre, sich zu widersetzen. Sie trennte sich von ihren Soldaten und machte sich nach Alexandria auf, wo Cäsar sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Die Gegenseite aber weigerte sich und zettelte sogar einen Aufstand gegen den ungeliebten Römer in der Stadt an. Militärisch hatte Cäsar mit nur 2200 Mann Infanterie und 800 Reitern kaum ein Machtmittel. Fliehen konnte er auch nicht, denn die Hafenausfahrten und Straßen kontrollierten die ägyptische Flotte und das ägyptische Heer, die beide treu zu Ptolemaios XIII. hielten.
Ein anderer hätte in dieser Lage vielleicht aufgegeben. Nicht so Cäsar. Er ließ seinen Palast massiv befestigen, sicherte seine Wasserversorgung und lieferte den Belagerern verlustreiche Gefechte. Einem römischen Kommando gelang es sogar, die ägyptische Flotte in Brand zu setzen. So harrte der siegverwöhnte Feldherr aus und wartete auf Entsatz. Dass ihm die Zeit nicht lang wurde, dafür sorgte ein allerhöchster Gast: Kleopatra. Die »berückende« Frau »in der Blüte ihrer Jugend« war auf abenteuerlichen Wegen, laut Plutarch versteckt in einem Sack mit Bettwäsche, durch das von Anhängern ihres Bruders kontrollierte Gebiet in die Stadt und in Cäsars Hauptquartier gelangt. Sie teilte nun seinen »Hausarrest« und bald wohl auch das Bett des nach zeitgenössischen Quellen »höchst erotischen Mannes«.
Die Lage war angespannt. Offensichtlich verband sie die gemeinsam durchgestandene Gefahr, denn binnen Kürze war jedenfalls klar, dass Cäsar sich für Kleopatra und gegen den Bruder Ptolemaios XIII. entscheiden würde, sobald er Handlungsfreiheit gewonnen hätte. Und das konnten die Ägypter trotz zahlenmäßiger Überlegenheit schließlich nicht verhindern, denn von Syrien rückte eine römische Legion heran, und auch der König des kleinasiatischen Pergamon sandte Hilfstruppen. Ende März 47 v. Chr. konnte Cäsar den Ausbruch wagen und sich mit dem vor der Stadt eingetroffenen Entsatzheer vereinigen. Aus der nachfolgenden Schlacht ging er als Triumphator hervor. Ptolemaios XIII. und seine Berater fielen, seine zur Mitkönigin ausgerufene Schwester Arsinoë geriet in Gefangenschaft.
Nur noch wenige gemeinsame Tage waren Cäsar und Kleopatra vergönnt. Die Staatsgeschäfte duldeten keinen Aufschub mehr. Cäsar übergab Kleopatra die Herrschaft über Ägypten nach der formalen Vermählung mit ihrem jüngsten Bruder Ptolemaios XIV., der zum Mitregenten ernannt wurde. Die römische Herrschaft am Nil war damit gesichert, und Cäsar konnte nach Italien zurückkehren. Unterwegs schlug er bei Zela (Kleinasien) den König des Bosporanischen Reiches im Eiltempo: »Veni, vidi, vici – ich kam, sah, siegte«, berichtete er seinem Freund Amintius in Rom. Langwierige Konflikte wie den ägyptischen konnte er sich nicht mehr leisten, wollte er die gewonnene Alleinherrschaft sichern, und das ging nur von der Hauptstadt aus.
Dort aber empfand er schmerzlich die Trennung von Kleopatra und lud sie deshalb nach Italien ein. Ihr Kommen im Jahr 46 v. Chr. war eine doppelte Freude, denn sie brachte den im September 47 v. Chr. geborenen gemeinsamen Sohn Ptolemaios XV., Kaisar oder Kaisarion, mit. Die Römer jedoch begegneten der morgenländischen Königin mit Skepsis, woran auch die üppige Gastlichkeit wenig änderte, mit der Kleopatra die vornehme Gesellschaft für sich zu gewinnen suchte. Die reservierte Reaktion etwa des berühmten Redners und Publizisten Cicero dürfte typisch für so manchen eingefleischten Republikaner in der Metropole gewesen sein.
Das hatte aber auch noch einen anderen Grund: Cäsar, so fürchteten viele Römer, könne die Republik, die ohnedies nur noch auf tönernen Füßen stand, endgültig liquidieren und durch eine Monarchie orientalischer Prägung ersetzen. Das wäre das Aus für die Senatsaristokratie gewesen und hätte manche lieb gewordenen Privilegien bedroht. So blieb wenigstens formal alles beim Alten, wenn auch der Diktator faktisch allmächtig war. Dass er Kleopatra mit Ehren überhäufte, hielt jedoch den Argwohn wach, der sich schließlich entlud, als die Verschwörer um Brutus und Cassius Cäsar am 15. März 44 v. Chr. erdolchten.
Danach kehrte Kleopatra fluchtartig nach Alexandria zurück. In Rom aber schlug die Stunde des bereits erwähnten Marcus Antonius oder Mark Anton, wie er hier zu Lande genannt wird. Er war zuletzt unter Cäsar Konsul, also oberster Amtsträger gewesen und arrangierte sich nun mit Oktavian (Octavianus), dem Adoptivsohn und testamentarisch eingesetzten Erben Cäsars. Gemeinsam nahmen sie die Verfolgung der Cäsar-Mörder auf, vernichteten deren Heer im Jahr 42 v. Chr. bei Philippi (Thrakien) und teilten sich das Weltreich: Mark Anton erhielt den reichen Osten, Oktavian den Westen mit dem Kernland Italien. Die erste Phase des zweiten römischen Bürgerkriegs war damit abgeschlossen, beendet aber war er noch lange nicht, wie sich bald zeigen sollte.
Ägypten gehörte nun also zum Machtbereich des Antonius, und Kleopatra beeilte sich, dem in Tarsos (Kleinasien) Hof haltenden Römer ihre Aufwartung zu machen. Das Zusammentreffen der Macht und der Schönheit, von Ares (Kriegsgott) und Aphrodite (Göttin der Liebe), überliefern die Quellen in fantasievoller Ausprägung. Kleopatra soll schmuckbehängt, aber sonst bis auf eine Art Tanga aus Perlen nackt vor Mark Anton erschienen sein in Begleitung ebenfalls aufreizend knapp bekleideter »Jungfrauen«, wohl Mädchen aus Alexandria, die sich auf die Liebeskunst verstanden. Wenn nur ein Bruchteil davon zutrifft, was über das Zusammentreffen fabuliert worden ist, dann müssen Antonius und Kleopatra in einem Rausch der Sinne förmlich versunken sein.
Dass sie sich ihm nicht gänzlich hingeben konnten, lag an Oktavian, der nur darauf gelauert hatte, den Ostrivalen zu demontieren. Das Kleopatra-Abenteuer kam ihm gerade recht, konnte er doch damit Stimmung gegen Mark Anton machen, dessen Ehefrau in Rom hatte zurückbleiben müssen, während sich der hohe Herr mit einer »orientalischen Hure« vergnügte!
Antonius kümmerte das Gerede wenig. Er brachte seinerseits Gerüchte über homosexuelle Neigungen des Gegners in Umlauf und schrieb ihm höhnisch: »Was hat dich denn so verändert? Dass ich mit der Königin schlafe?« Ja, auf den hohen Rang seiner Geliebten war er mächtig stolz und begleitete sie im Winter 41/40 v. Chr. nach Alexandria, wo er sich allerdings über alle Vorgänge in Rom genau unterrichten ließ.
Schließlich schien es ihm doch geraten, sich wieder in der Welthauptstadt blicken zu lassen, um seine dortige Anhängerschaft zu stärken. Noch einmal gelang zwischen den Kontrahenten ein Arrangement: Im Vertrag von Brindisi wurde im Herbst 40 v. Chr. die Eheschließung des Antonius mit Octavia, der Schwester Oktavians, beschlossen, denn Mark Antons erste Frau war kurz zuvor gestorben. Ende 39 v. Chr. verließ Antonius Rom wieder und zog mit seiner neuen Frau nach Athen, im Herzen aber die unstillbare Sehnsucht nach Kleopatra, die ihm inzwischen Zwillinge geboren hatte.
Auch Octavia bekam in den nächsten Jahren drei Kinder von ihm, was ihn im Jahr 37 v. Chr. aber nicht hinderte, nach Ägypten zu reisen. Gewiss, es ging vordergründig um die Vorbereitung eines Krieges gegen die erstarkten Parther in Syrien und Palästina. Unlieb aber war es dem inzwischen 45-Jährigen sicher nicht, Kleopatra wiederzusehen. Solcherart abgelenkt, ging der geplante Feldzug ziemlich schief, vor allem aber weil der brüskierte Oktavian, dessen Schwester Antonius nach Rom zurückgeschickt hatte, nicht die versprochenen Hilfen gewährte. Mark Anton reagierte mit der Übereignung von römischen Provinzen an Kleopatra, und vor allem mit der Anerkennung von Kaisarion als leiblichem Sohn Cäsars. Das sollte Oktavian zusätzlich treffen, da er ja nur von Cäsar adoptiert war und sich nun einem legitimen Erben des großen Diktators gegenübersah.
Natürlich bestritt er dessen Rechtmäßigkeit, erkannte nun aber auch, dass offenbar nur die Waffen den Konflikt mit Mark Anton würden lösen können. Das hatte dieser natürlich auch begriffen, und so begannen beide um das Jahr 35 v. Chr. aufzurüsten, ließen sich aber Zeit mit dem Krieg: Mark Anton, weil ihn die alexandrinischen Annehmlichkeiten in Gestalt von Kleopatra und das luxuriöse Hofleben fesselten, Oktavian, weil sich Octavia vorerst weigerte, die Scheidung von Antonius zu betreiben. Außerdem verfügte der Ostherrscher in Rom immer noch über viele höchst einflussreiche Freunde. Oktavian musste noch Überzeugungsarbeit leisten, ehe er würde losschlagen können.
Inzwischen sank Mark Antons Ansehen in Rom. Gerüchte wurden verbreitet über tatsächliche oder angebliche Ausschweifungen am Hof seiner Geliebten. Außerdem wurden seine Landschenkungen an Kleopatra und die gemeinsamen Kinder als Vergeudung römischen Erbes aufgefasst. Und es wurde wütend registriert, dass Mark Anton seinen Sieg in Armenien im Jahr 34 v. Chr. nicht in Rom, sondern in Alexandria mit einem Triumphzug von ägyptischem Gepränge feierte. Bald wagten es Antonius-Anhänger in der Hauptstadt kaum noch, sich öffentlich zu zeigen, denn Oktavian ging nun zu einer Politik offener Drohungen gegen sie über. Einige setzten sich daraufhin zu Mark Anton ab.
Der zog seit dem Frühjahr 32 v. Chr. eine Flotte vor Ephesos an der kleinasiatischen Küste zusammen und befahl alle von ihm abhängigen Fürsten und Könige des Ostens dorthin mit möglichst großen Truppenkontingenten. Auch Kleopatra zog zu ihm ins Feldlager und bot alle Mittel ihres Landes auf für seinen »Marsch auf Rom«. Sie erhoffte sich vom Sieg des Geliebten den Aufstieg ihres Sohnes Kaisarion zum Herrscher des gesamten Reiches als legitimer Erbe des großen Cäsar. Der inzwischen 15-jährige Junge war ein wichtiger Trumpf für Mark Anton, denn selbst in Rom dachten viele inzwischen dynastisch und verklärten Cäsar zum Vollender der römischen Weltmacht; eine Art Kaisertum nahm in den Köpfen der Menschen bereits Kontur an.
Im Sommer 32 v. Chr. verlegte Antonius seine Streitmacht nach Ostgriechenland, von wo er zum Sprung nach Italien ansetzen wollte. Mit einer logistischen Leistung, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte, gelang das Übersetzen von 100 000 Infanteristen und 12 000 Kavalleristen sowie die Verlegung von 500 Kriegsschiffen. Dazu kam der Transport von Verpflegung für Mensch und Tier sowie die Verladung des gesamten Hofstaats, der schon wegen der Anwesenheit von Kleopatra erheblichen Umfang angenommen hatte.
Oktavian hatte unterdessen die Propagandaschlacht noch immer nicht gewonnen. Dazu verhalf ihm erst das Testament Mark Antons, das dieser mit einem Boten nach Rom geschickt hatte, damit es dort hinterlegt würde. Ob nun Oktavian das Original bekannt machte oder eine manipulierte Fassung oder gar eine Fälschung, lässt sich nicht mehr zweifelsfrei feststellen. War es das Original, dann zeugt es von bemerkenswertem Ungeschick des Antonius. Er hatte darin nämlich verfügt, dass er in Alexandria beigesetzt werden wolle. Ein unverständlicher Affront gegen die römischen Patrioten, die bisher noch zu ihm gehalten hatten. Hatte ihn Kleopatra derart um den Verstand gebracht? Den antiken Historikern schien das so, sie nannten es »Zauberei«. Heute spricht man in solchen Fällen eher von Hörigkeit. Am besten trifft es wohl der Dichter. Bei Shakespeare heißt es darüber im Stück »Antonius und Kleopatra« (Prosaübersetzung des Autors): »Alter macht sie nicht welken, täglicher Genuss lässt ihre ständig neuen Reize nicht zur Gewohnheit werden. Andere Frauen stillen den Liebeshunger durch Hingabe; sie facht nur heftiger noch die Glut an, je reichlicher sie sich schenkt. Durch sie wird das Verworfenste geadelt, sodass die Priester sie noch segnen, während sie sündigt (genauer: hurt).«
Besser lässt sich die verzehrende Leidenschaft, die Antonius mit magischen Fesseln an die Königin band, nicht ausdrücken. Darunter litt wohl auch sein Scharfsinn: Mark Anton legte seine Flotte in den sicheren Golf von Ambrakia an der griechischen Westküste südlich von Korfu. Doch ehe sie sich gesammelt hatte, war ihm Oktavian zuvorgekommen und hatte seinerseits den Sprung über die Straße von Otranto nach Griechenland gewagt. Von Norden rückte er mit einem Landheer gegen die Stellung des Antonius bei Actium vor, während sein Admiral Agrippa die Ausfahrten aus dem genannten Golf blockierte. Antonius saß in der Falle.
Sein Nachschub musste über Land herangebracht werden und Desertionen schwächten sein Heer bis ins Offizierskorps. Die Landschlacht, mit der er sich zu befreien gesucht hatte, war von Oktavian nicht angenommen worden, denn die Zeit arbeitete nun für ihn. Im Kriegsrat des Gegners drängte daher Kleopatra auf einen Ausbruch zur See, auch wenn die Schlacht verloren ginge. Setzte man sich über Land ab, wäre die Flotte komplett verloren, also sollte man wenigstens versuchen, auf dem offenen Meer einen Teil zu retten. Widrige Stürme vereitelten jedoch den Plan, der Durchbruch gelang nur einem Viertel der Flotte, darunter auch Kleopatra und Mark Anton, die sogar die Kriegskasse retten konnten.
Das aber nützte nun auch nichts mehr. Die Niederlage von Actium am 2. September 31 v. Chr. sprach sich in Windeseile herum. Die Vasallen des Antonius fielen reihenweise von ihm ab, Kommandeure verweigerten ihm den Gehorsam, und Oktavian rückte Ägypten immer näher. Am 1. August 30 v. Chr., elf Monate nach seinem großen Sieg, nahm er Alexandria ein. Mark Anton beging Selbstmord. Den gefährlichen Cäsar-Sohn Kaisarion ließ Oktavian sofort umbringen. Kleopatra, die vergebens versucht hatte, den ägyptischen Thron für ihre Kinder zu retten, folgte Antonius zehn Tage später. Großzügig hatte ihr Oktavian einen Besuch am Grab des Geliebten gewährt. Dort gab sie sich den Tod, nachdem sie laut Plutarch noch die Klage gen Himmel gesandt hatte: »Von all meinen tausend Seufzern ist keiner so bitter und so groß wie die kurze Zeit, die ich ohne dich auf Erden leben musste.«
Über die Art des Selbstmords der Frau, an der fast ein Weltreich zerbrochen wäre, ist viel fantasiert worden. Durchgesetzt hat sich die Version, nach der sie sich von Schlangen beißen ließ, den heiligen Tieren der Pharaonen, die sie mit dem Sonnengott Amun-Re verbanden. Zunächst berichteten die Zeugen, darunter ihr Arzt Olympos, von Bissen in den Armen, später hieß es dann, Kleopatra habe die Kobras an ihren Brüsten angesetzt. Das machte sich besser für bildliche Darstellungen und passte zudem zum Image der Femme fatale und der heiligen Hure.
Ungezählt sind denn auch die literarischen und künstlerischen Verarbeitungen ihres Lebens und Sterbens bis hin zu monumentalen Hollywood-Streifen wie dem mit Elizabeth Taylor (1963). Ihre düster-strahlende Erscheinung hat das Kleopatra-Bild der Gegenwart nachhaltig geprägt, es aber sicherlich nicht weniger verfälscht, als es die antiken Autoren taten, die im Sold der Propaganda des Oktavian standen oder doch im Dienst um das Bild dieses ersten Kaisers der klassischen Antike. Als Augustus, der Erhabene, überstrahlte er schließlich alle Nachfolger und wurde noch lange Jahrhunderte als der Friedensfürst und Bringer einer neuen Zeit verehrt. Dass er obendrein Kleopatra bezwungen hatte, ließ ihn auch als Sieger über Magie und dunkle Mächte erscheinen.