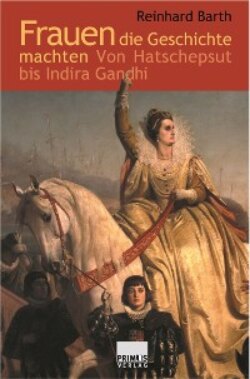Читать книгу Frauen die Geschichte machten - Reinhard Barth - Страница 14
Galla Placidia
ОглавлениеDie umgetriebene Kaisertochter
Wahrlich ein bewegtes Leben: Als Tochter des Kaisers Theodosius I. des Großen geboren; verlobt mit dem Sohn des Heermeisters Stilicho; beim Sturm der Westgoten auf Rom als Geisel verschleppt und in Gallien zur Frau eines Gotenkönigs gemacht; nach kurzer Zeit Witwe, nach Ravenna übergesiedelt und einem General zur Frau gegeben; nach einigen Jahren wieder Witwe; wegen Intrigen am Kaiserhof nach Konstantinopel ausgewichen; am Ende graue Eminenz in der Führung des Weströmischen Reiches. Der Historiker Ferdinand Gregorovius (1821–1891) hatte da wohl Recht mit der Einschätzung, die er in seiner »Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter« über die römische Kaisertochter Galla Placidia traf: »Es gibt unter den Lebensgeschichten berühmter Frauen wenige, die durch die Menge wechselnder und abenteuerlicher Ereignisse, durch den Reiz der Szenen oder der Lokale erstaunlicher gewesen wäre.«
Am politischen Wirken der Galla Placidia lässt Gregorovius dann allerdings kein gutes Haar, er nennt sie »herrschsüchtig« und »bigott« und eine echte Verkörperung des »sinkenden Roms« in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Überhaupt will er eine gewisse Gesetzmäßigkeit der Geschichte erkennen, »dass in Epochen des Verfalls Gestalten von Frauen auftauchen, deren Einfluss auf die Zeiten groß, und deren Schicksal zugleich ihr Sittengemälde ist«. Immerhin geht er nicht so weit zu behaupten, dass Galla Placidia Schuld am Untergang des Weströmischen Reiches trage. Es ging vielmehr – das arbeitet auch der Historiker des 19. Jahrhunderts deutlich genug heraus – an seinen eigenen Widersprüchen und äußeren Einwirkungen zugrunde, und die Hauptakteure dabei waren Männer.
Überhaupt war das Römische Reich durch und durch eine Veranstaltung von Männern. Die Frauen besaßen keinerlei politische Rechte. Sie konnten weder staatliche noch andere öffentliche Ämter bekleiden, sie durften nicht als Richter tätig sein, ja nicht einmal als Vormund ihrer Kinder auftreten. Erben konnten sie nur, wenn keine männlichen Geschwister da waren. Lediglich im religiösen Bereich gab es für sie Möglichkeiten, einen gehobenen sozialen Status zu erlangen. Priesterinnen genossen bedeutendes Prestige, bestimmte Priesterämter waren Frauen vorbehalten, beispielsweise der Dienst für die Göttin Vesta, der allerdings die Jungfräulichkeit voraussetzte. Das Christentum brachte den Frauen kaum Vorteile, auch unter der Herrschaft des Kreuzes wurden Frauen weiter unterdrückt und in Unmündigkeit gehalten. Dass das Weib schweige in der Gemeinde, wie es im 1. Korintherbrief heißt, galt auch den Kirchenlehrern des 4. und 5. Jahrhunderts als Maxime.
Wenn die Frauen etwas bewirken wollten, mussten sie sich an ihre Männer, Brüder oder Söhne halten. Selbst der Titel »Augusta«, den die Frau erhielt, die mit dem Kaiser verheiratet war, machte sie noch nicht zur Herrscherin, die auch Befehle erteilen konnte. Immer musste ein Mann vorgeschoben werden, in dessen Namen angeblich alles geschah. Dies war der Rahmen, in dem sich auch Galla Placidia zu bewegen hatte.
Sie wurde im Jahr 389 als Tochter des Kaisers Theodosius I. des Großen und seiner zweiten Frau Galla geboren. Nach dem frühen Tod der Eltern – die Mutter starb 394, der Vater ein Jahr später – übernahm Serena, eine Nichte des Theodosius, die Erziehung der kleinen Galla Placidia. Serena war mit dem Wandalen Stilicho verheiratet, dem kommenden starken Mann am Kaiserhof, der bald das Amt des Heermeisters einnehmen sollte – das höchste militärische Amt, das es im römischen Kaiserreich zu verteilen gab. Da sich die Reichsverteidigung schon seit längerem hauptsächlich auf ausländische Hilfsvölker stützte, war es kein Wunder, dass ein Germane auch als Generalissimus auftrat. Stilicho seinerseits tat alles, um seine Stellung zu festigen. Er betrieb u. a. eine weitsichtige Heiratspolitik. Auch Galla Placidia spielte eine Rolle darin, er gedachte sie später einmal mit seinem zwei Jahre älteren Sohn Eucherius zu verheiraten. Für Galla Placidias Bruder Honorius, den künftigen Kaiser, hatte er ebenso eine passende Partnerin aus der eigenen Familie parat: seine Tochter Maria. Als diese früh starb, rückte die nächstjüngere Schwester an ihre Stelle, Thermantia mit Namen. Beide Ehen blieben kinderlos, Honorius soll impotent gewesen sein.
Theodosius war der letzte Kaiser gewesen, der noch über ein gesamtrömisches Imperium regiert hatte. Seit seinem Tod drifteten Ost- und Westteil zunehmend auseinander. Der Osten erwies sich dabei als besser organisiert, römisches Recht und Verwaltung, griechische Traditionen und das Christentum gingen dort eine dauerhafte Synthese ein. Das Reich von Byzanz, wie man es auch nannte, mit Konstantinopel als Zentrum, hielt noch ein Jahrtausend stand. Im Westen dagegen trieb das Reich unter schwächlichen Kaisern seinem Untergang entgegen. Germanische Stämme übten unaufhörlich Druck aus. Als sie die Grenzen schließlich durchbrachen, nahmen sie das Land auf eigene Faust in Besitz oder siedelten sich als »Bundesgenossen« an.
Die Hauptbedrohung für das Weströmische Reich ging Anfang des 5. Jahrhunderts von den Westgoten aus. Unter ihrem König Alarich drangen sie 397 bis Griechenland vor. Heermeister Stilicho gelang es, sie zurückzuschlagen. 401 waren sie wieder da, diesmal in Norditalien. Stilicho hatte in Gallien mit der Abwehr anderer Germanenstämme zu tun, erst im folgenden Jahr konnte er die Westgoten zur Schlacht stellen. Kaiser Honorius war inzwischen die Residenz in Mailand zu unsicher geworden, er verzog sich nach Ravenna, das in schwer zugänglichen Sümpfen lag und Verbindung zur See hatte. Im Januar 404 feierte man in Rom mit einem Triumphzug den Sieg über die Goten. Galla Placidia war als 15-Jährige mit dabei. Schon im Jahr darauf wurde es wieder ernst, die Germanen drangen erneut nach Italien hinein. Die militärische Schwäche des Reiches war bereits so weit fortgeschritten, dass man Sklaven in das römische Heer aufnehmen musste. Auch mit diesen »Barbaren«, geführt von einem König namens Radagaisus, wurden Stilicho und seine Helferschaft noch fertig. Dann aber stand eine innerrömische Fronde gegen ihn auf, eine Gruppierung, der sozusagen die ganze Richtung nicht passte und die mit den Germanen auch als Bundesgenossen und Söldner nichts zu tun haben wollte. Sie steckte sich hinter Kaiser Honorius, und bei Gelegenheit einer Truppenmusterung in Pavia im August 408 kam die Palastrevolte zum Ausbruch. Stilicho wurde ermordet, und mit ihm seine Freunde und Leibwächter. Sein Sohn Eucherius war nach Rom geflohen, aber auch dort gab es Männer, die bereit waren, Mordbefehle auszuführen. Eucherius wurde getötet; damit verlor Galla Placidia ihren Verlobten. Das überwiegend von Germanen gestellte Heer löste sich auf, die germanenfeindliche Fraktion am Kaiserhof triumphierte – und holte sich stattdessen hunnische Söldner.
Für den Westgotenkönig Alarich war das Ende seines großen Widersachers Stilicho das Signal, es abermals mit einem Einmarsch in Italien zu versuchen. Im Dezember 408 stand er vor Rom. Der Senat, kopflos und in heller Aufregung, glaubte an Verrat und beschuldigte Stilichos Witwe, die Eindringlinge herbeigerufen zu haben. Man verurteilte sie zum Tod, und Galla Placidia, in Vertretung ihres Bruders, der sich in Ravenna verschanzt hielt, wurde die zweifelhafte Ehre zuteil, dem Beschluss des Senats zustimmen zu dürfen. Warum sie nichts zur Rettung ihrer Ziehmutter unternahm, ist im Dunkeln geblieben.
Gleichfalls unbekannt sind die Motive, die sie veranlassten, in Rom auszuharren, während die meisten adligen Familien aus der Stadt flohen, um aus der Ferne, von ihren Landgütern aus, die Auseinandersetzungen mit Alarich zu beobachten. Dieser ließ sich schließlich gegen eine bedeutende Summe zum Abzug bewegen. Aber er kehrte zurück, als die Verhandlungen über einen Friedensvertrag ins Stocken gerieten. Im August 410 schlug er richtig zu. Sein Heer drang in Rom ein und plünderte drei Tage lang. Wie wenig Anteil Kaiser Honorius im sicheren Ravenna am Schicksal des ewigen Rom nahm, überliefert eine Anekdote: Der Kaiser, so heißt es, als passionierter Hühnerzüchter, habe bei der Meldung, Rom sei gefallen, nur an seine Henne gleichen Namens gedacht.
Schwer mit Beute beladen zog das gotische Heer nach Süden ab. Geplant war ein Übersetzen nach Afrika, in die Kornkammer des Römischen Reiches, wo Alarich seinem Volk eine Heimstatt schaffen wollte. Mit zur Beute gehörten auch Personen höheren Ranges, die man nach der Sitte der Zeit als Sicherheit gegen etwaige Angriffe bei sich behielt und die in allen Ehren behandelt wurden und eine durchaus ihrem Rang entsprechende Behandlung erfuhren. Die prominenteste von ihnen war die Kaisertochter Galla Placidia.
Wie den Lesern von August von Platens Ballade »Das Grab im Busento« (1820) geläufig, machte der Tod Alarichs, den seine Goten »allzu früh und fern der Heimat« begraben mussten, alle Pläne zunichte. Die Übersiedlung nach Afrika fand nicht statt. Alarichs Schwager Athaulf übernahm die Führung des Westgotenvolkes. Dieser erwies sich als ein Mann mit Visionen; er wollte das Römische Reich erhalten und es mit der frischen, unverbrauchten Kraft der Goten von innen her erneuern, keineswegs aber ein gotisches Reich an seine Stelle setzen. Bestärkt wurde er darin durch Galla Placidia. Die »Geisel« betrachtete sich schon längst nicht mehr als Häftling, sie zog bereitwillig mit den Westgoten nach Gallien, wo Athaulf sich im Gebiet um Narbonne vorerst niederließ. Dort heiratete sie den König im Januar 414 in einer Zeremonie nach römischem Brauch. Athaulfs Hochzeitsgeschenk bestand aus 50 Sklaven in seidenen Gewändern. Jeder trug zwei Schüsseln mit Gold und Edelsteinen. Die Preziosen stammten, wie jeder sehen konnte, von Alarichs römischem Beutezug – woher hätte sie der Gote auch sonst haben können.
Noch im selben Jahr 414 brachte Galla Placidia ein Kind zur Welt. Der Knabe erhielt den Namen Theodosius. Dahinter stand ein deutliches politisches Programm. Es zielte auf das Gesamt-Rom, über das Galla Placidias Vater Theodosius der Große einst geboten hatte. Doch nichts davon ließ sich verwirklichen. Athaulf konnte sich in Gallien nicht gegen eine römische Armee halten, die von einem Heermeister namens Constantius geführt wurde. Die Westgoten wichen nach Spanien aus. Der kleine Theodosius starb 415 in Barcelona, sein Vater Athaulf gleichfalls, als Opfer eines privaten Racheaktes unter Goten. Der Tod des Königs brachte eine neue Gruppierung an die Macht, der am römischen Imperium nichts gelegen war. Das gotische Wandervolk wählte Segerich zum König. Er hatte nur eine Woche Frist, dann wurde er ebenfalls umgebracht. In dieser Zeit musste Galla Placidia Schlimmes durchmachen. Sie wurde in Ketten gelegt und musste zu Fuß vor seinem Pferd herlaufen. Segerichs Nachfolger Vallia (Walja) lieferte sie schließlich an den Kaiserhof in Ravenna aus. Er erhielt dafür 600 000 Scheffel Getreide. Etwa 15 000 Krieger samt ihrem Anhang konnten davon ein Jahr leben. Kaiser Honorius, nun wieder ihr Vormund, der er bereits vor der Ehe mit Athaulf gewesen war, gab seine Schwester dem erfolgreichen General Constantius zur Frau. Mit der Heirat war Galla Placidia nicht einverstanden, aber das spielte keine Rolle. Am 1. Januar 417 fand ihre zweite Eheschließung statt. Zwei Kinder entsprossen der Verbindung, Valentinian und Honoria. Im Februar 421 wurde Constantius zum Mitkaiser des Weströmischen Reiches erhoben, Galla Placidia erhielt den Titel »Augusta«.
Constantius starb im September 421 an einer Rippenfellentzündung. Selbst erst 32 Jahre alt, war Galla Placidia nun zum zweiten Mal Witwe. Ihre Stellung am Kaiserhof von Ravenna wurde rasch unhaltbar, vor den Kabalen, die seitens des Kaisers und seiner Umgebung gegen sie getrieben wurden, wich sie nach Konstantinopel aus. Dort regierte ihr Neffe, der auch den signifikanten Namen Theodosius trug. Theodosius II. war Galla Placidia allerdings wenig gewogen. Das änderte sich aber schlagartig, als der weströmische Kaiser Honorius im August 423 an der Wassersucht starb und ein Usurpator namens Johannes sich zum Nachfolger aufschwang. Schon stand Galla Placidia mit ihrem Sohn Valentinian im Brennpunkt weitreichender politischer Überlegungen. Denn der oströmische Kaiser Theodosius sah jetzt einen Anlass, sich im Westen einzumischen. Er verlobte seine zweijährige Tochter mit dem fünfjährigen Valentinian. Und er sandte eine Armee von Dalmatien aus nach Italien, die mit Johannes und seiner Staatsstreich-Partei aufräumte.
Galla Placidia kehrte im Triumph heim nach Ravenna. Jetzt konnte sie regieren, im Namen ihres Sohnes, der als Sechsjähriger im Oktober 425 auf den Kaiserthron des Weströmischen Reiches gesetzt wurde. Zwar stand sie selbst unter Vormundschaft, diesmal ihres Neffen Theodosius II., aber der war bald mit Problemen seines eigenen Reiches überaus beschäftigt, sodass er die Regentin in Italien gewähren ließ.
Im desolaten Weströmischen Reich war es eigentlich nur noch die Armee, die leidlich funktionierte, und wer hier die Führung hatte, konnte auch in anderen Bereichen Einfluss nehmen. Um den Posten des Heermeisters gab es darum die größten Auseinandersetzungen. Sie spielten sich in diesen Jahren zwischen drei Männern ab, Felix, Bonifatius und Aetius. Leider traf Galla Placidia unter ihnen nicht die beste Wahl. Sie ließ Aetius, den fähigsten, links liegen und begünstigte stattdessen Bonifatius. Dieser war für Afrika zuständig. Sein Konkurrent Felix schwärzte ihn als Donatisten bei Hofe an. Die Donatisten, eine christliche Sekte, benannt nach Donatus, einem Bischof von Karthago im 4. Jahrhundert, wurden auf Veranlassung des Papstes staatlich verfolgt. Felix mobilisierte schließlich sein Heer gehen ihn, um seine Absetzung zu erzwingen. Bonifatius rief daraufhin die Wandalen aus Spanien zu Hilfe. Die stachen im Mai 429 unter ihrem König Geiserich in See und nahmen Roms afrikanische Provinzen sogleich für sich in Besitz. Felix versuchte anschließend Aetius auszubooten, der in Gallien zu Hause war. Aber Aetius war schneller. Er schickte Agenten aus, die Felix‘ Armee gegen ihren General aufbrachten. Im Mai 430 kam dieser bei einer Truppenmeuterei in Ravenna ums Leben. Galla Placidia blieb nun nichts anderes übrig, als Aetius zum obersten Heerführer Westroms zu ernennen. Doch schon 432 rief sie ihren früheren Günstling Bonifatius wieder nach Italien und gab ihm den Posten des Heermeisters. Das konnte sich Aetius nicht bieten lassen. Es kam zur Entscheidungsschlacht, ausgetragen bei Rimini im Frühjahr 432. Bonifatius siegte zwar, wurde aber selbst so schwer verwundet, dass er drei Monate später starb. Galla Placidia ernannte einen Nachfolger für ihn namens Sebastianus, der jedoch gegen ein hunnisches Heer, das Aetius zu Hilfe kam, nichts auszurichten vermochte und nach Konstantinopel flüchtete. Für Aetius war nun endgültig die Bahn frei, bis zu seiner Ermordung im Jahr 454 stand er an der Spitze des weströmischen Heerwesens.
435 schloss Galla Placidia einen Friedensvertrag mit den Wandalen. Afrika, der wichtigste Nahrungslieferant, war für das Römische Reich verloren. Blieben Spanien und Gallien, in denen Aetius mit fester Hand vorerst noch die Auflösung aufhalten konnte. Dabei machte man ihm vom Kaiserhof her Schwierigkeiten, wo es nur ging. Das änderte sich auch nicht, als Galla Placidias Sohn 437, nun volljährig, die lange geplante Heirat mit Licinia Eudoxia, der Tochter des oströmischen Kaisers Theodosius II., feierte und als Valentinian III. die Regierung übernahm. Galla Placidia mischte weiter mit. Ein Zeugnis dafür ist die »Chronica Gallica«, eine zeitgenössische Quelle, die Valentinians Regierungszeit erst mit dem Jahr 450, dem Todesjahr seiner Mutter, beginnen lässt.
Galla Placidia nahm Anteil an kirchlichen Fragen, mit Papst Leo I. dem Großen, der 440 auf den Stuhl Petri gelangte, pflegte sie vertraulichen Umgang und unterstützte ihn in seinem Kampf gegen die Sekten der Manichäer, der Pelagianer und anderer. Ebenso lag ihr der Bau neuer Gotteshäuser, vor allem in Ravenna, am Herzen. »In diesen Gründungen der Pietät spricht sich der tiefreligiöse Sinn der merkwürdigen Frau aus und auch die Schwermut ihrer Seele«, sagt Ferdinand Gregorovius. Daneben machte sich die Herrscherin um die Gesetzgebung verdient. Es gab bis zu dieser Zeit keine aktuellen Zusammenstellungen, seit den Sammlungen Diokletians war mehr als ein Jahrhundert vergangen. Die Kaiser behandelten die Fälle, die ihnen vorgetragen wurden, mit Antwortbriefen, den so genannten Reskripten, die dann schlecht und recht als Grundlage weiterer Entscheidungen herangezogen wurden. Galla Placidia veranlasste nun im Jahr 426 das so genannte Zitiergesetz, das eine erste systematische Rechtssprechung ermöglichte. Galla Placidias Reform legte fest, welche Rechtsgelehrten mit ihren Schriften künftig heranzuziehen seien und welche nicht. Höchste Priorität bei Zweifelsfällen sollten die Werke des Papinian (um 150–212) haben. Das System war noch rudimentär, aber darauf konnten die Sammlungen aufbauen, die die Kaiser später in Konstantinopel herausgaben: der »Codex Theodosianus« von 438 und das berühmte »Corpus Juris Civilis« Justinians von 534.
Mochte Kaiser Valentinian unter der Fuchtel seiner Mutter stehen, dem Einfluss seiner Schwester Honoria aber wusste er sich zu entziehen, dazu reichte seine Kraft aus. Die junge Frau, die gleich ihrer Mutter aktiv am politischen Leben teilhaben wollte, fand keine Gelegenheit dazu. Eine Ehe wurde ihr nicht gestattet, etwaige Nachkommen hätten die Nachfolgeplanungen ihres Bruders gestört. Man stellte ihr einen Palast in Ravenna mit einem eigenen Haushalt zur Verfügung. Schließlich wurde Honoria doch verheiratet, mit einem einfachen Mann, von dem bekannt war, dass er nicht die geringsten politischen Ambitionen hegte. Um der widrigen Ehe zu entgehen, kam Honoria auf den irrwitzigen Gedanken, den Hunnenkönig Attila als Retter in der Not anzurufen. Sie schickte ihren Vertrauten, den Eunuchen Hyacinthus, mit einem Ring als Zeichen für die Ernsthaftigkeit ihrer Botschaft zu Attila. Die Mission wurde am Kaiserhof ruchbar. Bei seiner Rückkehr wurde der Bote gefasst und unter der Folter verhört. Kaiser Valentinian verlangte auf der Stelle das Todesurteil für seine Schwester. Da griff Galla Placidia noch einmal ein. Sie nahm Honoria in Schutz und setzte durch, dass nicht mehr als ein Hausarrest gegen sie verhängt wurde. Danach verschwindet sie aus den Quellen, möglicherweise hat ihr rachsüchtiger Bruder sie nach Galla Placidias Tod doch noch umbringen lassen.
Die Kaiserin starb, 61 Jahre alt, am 27. November 450 in Rom und wurde dort auch in St. Peter beigesetzt. Die Erinnerung an sie wird aber in Ravenna aufrechterhalten. Galla Placidia ließ sich dort eine Kapelle errichten, die zugleich ihr Mausoleum sein sollte. Im früheren Palastbezirk gelegen, Anbau an die Kirche Santa Croce, von der wie von den Palästen der Kaiserzeit fast nichts mehr übrig ist, blieb die Kapelle doch über die Zeiten erhalten. Drei mächtige Sarkophage stehen in ihrem Inneren. Angeblich sollen in den Steinbehältern die Überreste Galla Placidias, ihres zweiten Ehemannes Constantius und der Tochter Honoria liegen – das ist aber wohl ebenso erfunden wie auch die Geschichte, dass sich die Kaiserin als Mumie in dem größten der drei Sarkophage erhalten habe und erst im Jahr 1557, als spielende Kinder eine brennende Kerze durch eine Öffnung geschoben hätten, in Flammen aufgegangen sei.
Durch die Mosaiken an den Wänden und in der Kuppel der kleinen Kirche, ist die Welt, die die Kaiserin umgab, lebendig geblieben. Es ist die Welt der Spätantike, die christliche Vorstellungen harmonisch mit antiken Traditionen vereinigte, am eindrucksvollsten dokumentiert im Bild des Guten Hirten: Der Erlöser ist weder als Triumphator noch als Schmerzensmann dargestellt, sondern als junger, schöner Apoll. Auch heutigen Besuchern mag beim Betreten des Raumes aufgehen, was der bereits zitierte Ferdinand Gregorovius 1863 in seinem Aufsatz über Ravenna (später Teil des Sammelwerks »Wanderjahre in Italien«) festhielt: »So ist die Geschichte des Unterganges der Familie des Theodosius zugleich die vom Fall des Römischen Reiches und das Grabmal der Placidia, eines der merkwürdigsten Monumente der Welt, gleichsam das Mausoleum des Römischen Reiches der alten Imperatoren.«