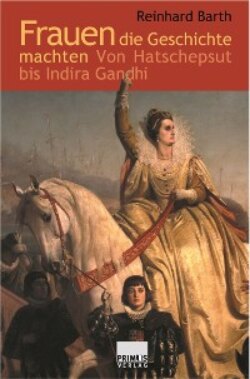Читать книгу Frauen die Geschichte machten - Reinhard Barth - Страница 12
Messalina und Agrippina d.J.
ОглавлениеDie römischen Luder
»… war von den Befehlen seiner Gemahlinnen abhängig … konnte ein eheloses Leben nicht ertragen …«, so lautet das nüchterne Urteil des römischen Geschichtsschreibers Tacitus (um 55 bis nach 115) in seinem Geschichtswerk »Annales« über Kaiser Claudius, der das Römische Reich von 41– 54 regierte. Der Chronist hat dabei zwei Frauen besonders im Auge, Claudius’ dritte Frau Messalina († 48) und deren Nachfolgerin Agrippina die Jüngere († 59). Von diesen beiden brachte es Messalina zu beträchtlichem Nachruhm, sie ging in die populäre Geschichte als Nymphomanin auf dem Kaiserthron ein. Trotz zahlreicher Verbrechen, zu denen sie andere anstiftete, blieben ihre Wirkungsmöglichkeiten jedoch begrenzt und kamen über Palastintrigen nicht hinaus. Agrippina dagegen fand Gelegenheit, Weltgeschichte zu machen.
Claudius oder wie sein vollständiger Name lautete: Tiberius Claudius Nero Germanicus, geboren am 1. August 10 v. Chr. in Lyon, war es bei seiner Geburt nicht bestimmt, dass er dereinst Imperator werden würde. Es traf ihn eher zufällig. Er war zwar weitläufig mit der Herrscherfamilie der Julier verwandt, aber eine körperliche Behinderung, wohl Folge einer schweren und verfrühten Geburt, stand einem Aufstieg in die höchsten Zirkel der Macht im Wege. Claudius hinkte auffällig, er konnte weder Kopf noch Hände ruhig halten, er stotterte und verlor bei Erregung jede Kontrolle über sich. Jahrzehntelang führte er ein Leben mehr oder weniger im Schatten von Augustus und Tiberius, mit größeren Aufgaben mochten sie ihn nicht betrauen. Erst unter Kaiser Caligula, seinem Neffen, wurde Claudius im Jahre 37 erstmals Konsul. In einem der folgenden Jahre heiratete er Valeria Messalina, eine Urenkelin Octavias, der Schwester des Kaisers Augustus. Sie war blutjung, nach den Schätzungen der Historiker zwischen 14 und 18 Jahre alt, während der Ehemann 30 oder mehr Jahre älter war. Zuvor war er schon zweimal verheiratet gewesen. Von diesen Ehen ist wenig bekannt, außer dass beide mit Scheidung endeten. Messalina brachte zwei Kinder zur Welt, zunächst eine Tochter, Octavia, die im Jahr 40 geboren wurde, dann ein Jahr später einen Sohn, Tiberius Claudius Germanicus, der gewöhnlich Britannicus genannt wurde.
Claudius hatte es am Hofe Caligulas nicht gerade leicht. Die Hofgesellschaft machte sich über den stotternden Konsul mit dem Wackelkopf und den zitternden Händen lustig, und vom Kaiser, bei dem zum ersten Mal die Züge des Cäsarenwahnsinns hervortraten, die auch anderen Herrschern in Rom noch zu schaffen machen sollten, war stets Schlimmstes zu befürchten. Aber auch Caligulas gewaltsamer Tod – er wurde im Januar 41 von Mitgliedern der Prätorianer, der kaiserlichen Garde, ermordet – brachte keine Erleichterung, im Gegenteil. Claudius befürchtete nun, möglicherweise mit gutem Grund, bei den Säuberungen, die sich anschlossen, mit beseitigt zu werden. Zum Herrschermord im alten Rom gehörte oft genug die Liquidierung tatsächlicher und vermeintlicher Freunde und Parteigänger des Getöteten. Im Fall Caligulas sollten auch Pläne existiert haben, die gesamte Kaiserfamilie auszurotten und die Republik wieder einzuführen. Claudius versuchte dem zu entgehen, indem er sich im Bereich des Kaiserpalastes versteckte. Ein Garde-Soldat stöberte ihn auf, aber erstaunlich, der Mann tat ihm nichts, schleppte ihn vielmehr zu seinen Kameraden, die ihn als Imperator begrüßten und ihn im Triumph in ihre Kaserne brachten. Claudius nutzte die Gunst der Stunde und übernahm die Regierungsgewalt. Es machte sie ihm zunächst auch niemand streitig.
Seine Regierungszeit war durchaus von innen- und außenpolitischen Erfolgen begleitet. Es gelang ihm, die Versorgungskrise zu meistern, in die Rom geraten war, die Verwaltung des Reiches in einige Ordnung zu bringen und das Verhältnis zum Senat zu verbessern, das unter Caligula stark gelitten hatte. Er führte den von seinem Vorgänger begonnenen Bau von Wasserleitungen fort, kümmerte sich um den Straßenbau und gründete nahe der Tibermündung einen neuen Seehafen, über den künftig die Anlieferung von Nahrungsmitteln für die Hauptstadt laufen sollte. Er machte Thrakien und das südliche Britannien zu Provinzen des Römischen Reiches.
Zuhause aber ging bei ihm alles drunter und drüber. Seine Gattin Messalina hielt sich Liebhaber, einen nach dem anderen, sie veranstaltete Orgien und heckte Komplotte aus, die hochgestellte Persönlichkeiten das Leben kosteten. Hauptsächlich geschah das, indem sie ihrem Mann Material über angebliche Verschwörungen und Umsturzpläne zuspielte, und dieser reagierte dann hastig und ohne weitere Nachprüfung mit drakonischen Bestrafungen oder gar Todesurteilen. Die antike Geschichtsschreibung erkannte darin nur das Walten eines grundbösen Frauencharakters. Es machte Messalina Spaß, Menschen ins Unglück zu stürzen, so die einhellige Meinung. Wenn es sich um Männer aus ihrem Bekanntenkreis handelte, dann waren es abgelegte Liebhaber, deren sie überdrüssig war, oder solche, die ihren Verführungskünsten widerstanden hatten und die sie dafür mit ihrem Hass verfolgte. Jüngere Historiker sehen die Dinge mittlerweile anders. Sie schreiben der Frau neben ihrem offenbar ungewöhnlichen sexuellen Verlangen eine hohe politische Intelligenz zu. Die Männer, die sie aus dem Weg räumen ließ, waren solche, die ihr und ihrem Mann, möglicherweise auch ihrem Sohn Britannicus gefährlich werden konnten. Für Claudius bedeutete es einen Gewinn, dass er Messalina hatte. Mochte sein Ansehen auch darunter leiden, dass seine kokette junge Frau nach jungen Männern Ausschau hielt und den Ehemann nach ihrer Pfeife tanzen ließ, so besaß er doch andererseits durch die Verbindung mit einer Angehörigen des Hochadels, noch dazu aus dem Hause des verehrten Augustus, eine Legitimation für seine Herrschaft, die er dringend benötigte.
Im Jahr 48 allerdings war es mit dem sonderbaren Bündnis zwischen dem in die Jahre gekommenen Kaiser und der lebenslustigen Frau zu Ende. Messalina hatte es sich mit Claudius wichtigsten Mitarbeitern, vor allem dem Leiter des kaiserlichen Sekretariats, Narcissus, verdorben. Er und andere mussten fürchten, wegen irgendwelcher erdichteten Geheimbündeleien angeschwärzt zu werden. Und die Kaiserin selbst wollte sich offenbar auch nicht länger auf ihren Ehemann verlassen und plante, ihn zu verlassen. Gaius Silius hieß der neue Mann an ihrer Seite, ein junger Senator, der sich bereit erklärte, Messalina zu heiraten und ihren Sohn Britannicus zu adoptieren. Und Claudius’ Nachfolge nicht nur im Bett, sondern auch als Imperator des Römischen Reiches anzutreten, hielt der Jüngling sich wahrscheinlich auch für befähigt.
»Ich bin mir wohl bewusst, dass es wie ein Märchen klingen wird«, mit diesen Worten beginnt Tacitus seinen Bericht über die letzten Tage Messalinas. In der Tat, die Hochzeit fand statt, und Claudius tat nichts dagegen. Angeblich hatte er sogar sein Einverständnis gegeben. Seine Mitarbeiter aber handelten.
Und so nimmt das Geschehen seinen Lauf: Narcissus und die anderen Vertrauten, Callistus und Pallas, öffnen Claudius die Augen über die Umtriebe seiner Gemahlin, und dieser erwacht endlich aus seiner Lethargie und Stumpfheit. Messalina feiert in ihrem Palast nichts ahnend ihre letzte Orgie. Es ist Herbst, da wird das Winzerfest begangen, ein wüstes Bacchanal, die Frauen toben in Felle gehüllt umher, und Messalina, mit flatternden Haaren, führt gemeinsam mit ihrem efeubekränzten Bräutigam den wilden Reigen an, als ein Gerücht aufkommt: Der Kaiser, den alle auf Dienstreise in Ostia wähnten, sei im Anmarsch. Darauf zerstreut sich die Festgesellschaft in Windeseile. Wer es nicht schafft, rechtzeitig zu verschwinden, den greifen die Häscher des Narcissus. Messalina aber zieht ihrem Gemahl entgegen, im Vertrauen darauf, dass es ihr gelingen werde, den Alten zu besänftigen. Zusätzlich gibt sie Order, auch die Kinder herzubringen und die oberste Vestalin zu bitten, ein gutes Wort für sie einzulegen. Mit kümmerlichem Gefolge, auf drei Begleiter ist es geschrumpft, durchquert Messalina zu Fuß die Stadt und fährt schließlich auf einem Karren, der sonst Gartenabfälle transportiert, dem Kaiser entgegen. Narcissus durchkreuzt ihren Plan: Er hat ein schriftliches Verzeichnis von Messalinas Fehltritten dabei und hält es Claudius unter die Nase, wann immer der schwach zu werden droht. Der Minister bringt es auch fertig, eine Begegnung mit den Kindern zu verhindern; mit der Priesterin, die unverschämt auftritt, wird der Kaiser selbst fertig. Die Villa des Silius wird besetzt. Man findet dort Beweise dafür, dass Messalina angefangen hat, Wertgegenstände aus dem ehelichen Haushalt zu entfernen. Claudius, nun richtig in Fahrt, ordnet die Hinrichtung der Festgenommenen an. Messalina irrt derweil in den Lukullischen Gärten herum, verfasst Bittschriften, tobt und wütet. Claudius, der sich betrunken hat, ist schon wieder bereit ihr zu verzeihen, aber der treue Narcissus greift erneut ein und schickt ein Hinrichtungskommando in den Park. Messalina müsste nun Selbstmord begehen und versucht es auch, scheitert aber. Während sie noch unschlüssig mit dem Dolch hantiert, wird sie von einem Soldaten mit dem Schwert durchbohrt. Claudius greift daraufhin zum Becher und setzt sein Gelage fort. »Auch in den folgenden Tagen ließ er kein Zeichen von Hass oder Freude, von Zorn oder Betrübnis, kurz von irgendeiner menschlichen Regung merken«, schreibt Tacitus.
Der Senat ordnete an, Namen und Bilder der Messalina von privaten und öffentlichen Plätzen zu entfernen: eine so genannte damnatio memoriae. Messalina fiel dennoch nicht der Vergessenheit anheim. Der Nachwelt wurde sie zum Inbegriff einer launischen Despotin mit geradezu sagenhaftem sexuellem Appetit. Die Tonart gab der Satirendichter Juvenal (um 58–138) vor: Er porträtiert die Gemahlin des Kaisers Claudius als meretrix Augusta, als Kaiserin-Hure, die sich nachts davonschleicht und im Bordell die Freier bedient und davon überhaupt nicht genug kriegen kann. Plinius der Ältere (23 oder 24 bis um 113) steuert die Geschichte bei, Messalina habe Roms beliebteste Prostituierte zu einem Wettbewerb herausgefordert, bei dem es darum ging, wer innerhalb einer festgelegten Zeit mehr Männer aufs Lager bekommt – und die Kaiserin habe gesiegt. Cassius Dio (3. Jahrhundert) unterstellt ihr, sie habe nicht bloß selbst »gesündigt«, sondern in ihren Kreisen den Ehebruch gesellschaftsfähig gemacht und so eine ganze Generation von Frauen verdorben.
Das Bild der Kaiserin-Hure wurde fleißig weiter tradiert. Ende des 19. Jahrhunderts baute der italienische Arzt und Anthropologe Cesare Lombroso darauf eine ganze Theorie der kriminellen Frau auf; an einer Porträtbüste, die Messalina zeigen soll (mittlerweile wird die Zuordnung bestritten), glaubte er die Züge der geborenen Verbrecherin erkennen zu können (»La donna delinquente, la prostituta e la donna normale«, 1893). Sein Landsmann und Dichter Pietro Cossa hatte die Gestalt der Intrigantin mit dem hohen Männerverschleiß bereits zwei Jahrzehnte früher auf die Bühne gebracht, sein Drama »Messalina« (1876, Neufassung 1907) beeinflusste die zahlreichen Verfilmungen des Stoffes, von »Messalina – der Fall einer Kaiserin« (1923) bis »Messalina – Kaiserin und Hure« (1980), in denen das alte Rom als ein einziger Sumpf des Lasters erscheint. Diese Art der Geschichtsdarstellung wiederum wird in der Eingangssequenz von »Fellinis Roma« (1971) karikiert: Der italienische Regisseur Federico Fellini beschwört ein Kino-Erlebnis seiner Jugend herauf, eben einen Messalina-Film, und lässt ein paar Szenen nachspielen: Eine davon zeigt, wie die Kaiserin, sich lustvoll im Bade räkelnd, ihre Mordbefehle erteilt; sie lächelt tückisch, während die Opfer abgeführt werden; in der Arena müssen sich ihre Opfer dann gegenseitig umbringen.
Während es Messalina so zu einem wenn auch ziemlich katastrophalen Nachruhm brachte, blieb ihrer Nachfolgerin Agrippina dergleichen erspart, obwohl sie näher an die Schalthebel der Macht gelangte als ihre Vorgängerin. Man kennt sie heute hier zu Lande noch als Gründerin, besser gesagt Namensgeberin der Stadt Köln. Das römische Militärlager am Rhein, Agrippinas Geburtsort, wurde im Jahr 50 erweitert und zur Kolonie erhoben und nach der Kaiserin Colonia Agrippinensium benannt. Der Name verkürzte sich später zu Colonia = Köln. Aber Agrippina war die Mutter des Kaisers Nero, zugleich auch eines seiner vielen Opfer, und er war es nun mal, der im Gedächtnis der Nachwelt erhalten blieb und nicht seine Mutter.
Die Geschichte Agrippinas ist mit der mehrerer römischer Kaiser verknüpft. Geboren am 6. November 15 als Tochter des berühmten Feldherrn Germanicus und seiner Frau Agrippina der Älteren, war sie dadurch auch eine Schwester Caligulas, der nach dem frühen Tod des Vaters im Jahr 37 von den Prätorianern zum Kaiser erhoben wurde. Im gleichen Jahr brachte sie, seit 28 mit einem Angehörigen des Kaiserhauses, Cn. Domitius Ahenobarbus, vermählt, ihren Sohn Nero (damals noch Lucius Domitius genannt) zur Welt. Im Jahr 39 war Agrippina in ein Komplott zum Sturz Caligulas verwickelt, das aber aufflog. Sie wurde zusammen mit ihrer Schwester Livilla auf die Pontinischen Inseln verbannt. Nach Caligulas Ermordung und der Ausrufung des Claudius zum Kaiser konnte sie, inzwischen Witwe, nach Rom zurückkehren, fand sich aber schon bald den Nachstellungen Messalinas ausgesetzt, die für ihren Sohn Britannicus die Konkurrenz des Agrippina-Sohnes Domitius (= Nero) fürchtete. Tacitus behauptet, nur die Affäre mit Silius, in den sie bis zum Wahnsinn verliebt gewesen sei, habe Messalina daran gehindert, Agrippina ein Verfahren wegen Verschwörung oder Ähnlichem anzuhängen.
Nach Messalinas Tod brauchte Kaiser Claudius eine neue Frau. So jedenfalls Tacitus, der nicht müde wird, auf diese besondere Schwäche des Claudius, nämlich seine Abhängigkeit von den Frauen, hinzuweisen. Agrippina machte das Rennen, sie stach dank ihrer hochadligen Abstammung, ihrer erwiesenen Fruchtbarkeit und ihrer »Verführungskünste« (Tacitus) eine Reihe anderer aussichtsreicher Kandidatinnen aus. Es gab allerdings ein ernstes Hindernis: Claudius war ihr Onkel. Aber die Klippe wussten die Ratgeber des Kaisers zu umschiffen: Bei anderen Völkern gebe es sogar Geschwisterehen, machten sie im Senat geltend. Das Inzestverbot sei ein alter Zopf, von Zeit zu Zeit müsse man prüfen, ob hergebrachte Sittengesetze noch mit dem modernen Leben übereinstimmten. Den Rest erledigte eine Menschenmenge, die draußen auf der Straße dem Heiratsplan begeistert zustimmte.
Agrippina hatte kaum den Ehevertrag in der Tasche, als sie auch schon die Zügel in die Hand nahm. Claudius schien sich aus den Regierungsgeschäften weitgehend zurückgezogen zu haben, möglicherweise lag das an seinem vorgerückten Alter und einem schlechten Gesundheitszustand, sicher aber auch an der Dominanz, die Agrippina entwickelte. Sie drängte in öffentliche Aufgaben hinein, so etwa bei der Unterwerfungszeremonie, die der besiegte Britannierhäuptling Caratacus in Rom zu absolvieren hatte. Auch gegenüber Agrippina musste der Gefangene seine Verehrung erweisen. »Das war etwas Neues«, stellt Tacitus fest, »dass eine Frau römische Truppen kommandierte. Sie gab sich damit als Teilhaberin der Herrschaft aus.« Vor allem galt Agrippinas Augenmerk der Sicherung der Erbfolge. Von Anfang an war sie darauf bedacht, ihren Sohn aus erster Ehe, den bereits erwähnten Lucius Domitius, später bekannt unter dem Namen Nero, zur Zeit der Eheschließung mit Claudius elf Jahre alt, in eine günstige Position zu bringen. Als erstes besorgte sie ihm eine Ehefrau, Octavia, die Tochter des Kaisers aus der Ehe mit Messalina. Das Mädchen war bereits mit einem angesehenen und populären Römer verlobt, aber das störte Agrippina nicht weiter, sie initiierte eine Intrige, die den Ehemann in spe seine Ämter kostete, und in die Enge getrieben beging er Selbstmord.
Auch bei der Wahl der Erzieher für den jungen Nero traf Agrippina die Entscheidungen. So wurde der Philosoph Seneca engagiert, der so ins Zentrum der politischen Macht gelangte. Man kennt ihn heute als den abgeklärten, der Welt abgewandten Stoiker. Das Bild rührt von den Schriften seiner späteren Jahren her, da Nero als Kaiser sich von ihm emanzipierte und Seneca nurmehr als Warner auftrat. Als Erzieher des Knaben jedoch mischte sich der Philosoph durchaus ins politische Tagesgeschäft ein, schrieb etwa Reden für seinen Schützling.
Im Jahr 54 ereignen sich wundersame Dinge, die als schlechte Vorzeichen gedeutet wurden. Tacitus, ganz Dramatiker, beschwört in seinen Annalen die Stimmung, in der sich der Untergang des Claudius vollzieht. Ein Soldatenlager geht in Flammen auf, ein Bienenschwarm lässt sich auf dem Giebel des Kapitols nieder, Hermaphroditen kommen zur Welt … Und mittendrin Agrippina in ihrer Angst: Man hat ihr zugetragen, dass Claudius in betrunkenem Zustand gesagt haben soll, sein Schicksal sei es, erst unter den Schandtaten seiner Gattinnen leiden und diese dann bestrafen zu müssen. Es scheinen ihm auch Zweifel gekommen zu sein, ob er recht daran getan hatte, Nero, wie es Agrippina verlangte, zu adoptieren und seinen leiblichen Sohn Britannicus in der Erbfolge zurückzusetzen. Agrippina muss sich beeilen, will sie ihrem Sohn die Herrschaft sichern. Also beschließt sie, ihren Mann umzubringen, bevor dieser vielleicht auf einen ähnlichen Gedanken kommt und sie beseitigt. Eine Giftmischerin wird beauftragt, dazu ein Arzt. Das Gift soll möglichst unauffällig und langsam wirken, gleichzeitig aber den klaren Verstand ausschalten, damit das Opfer nicht merkt, wie ihm geschieht. Bei einem Festmahl wird dem Kaiser das Mittel, versteckt in einem schmackhaften Pilzgericht, verabreicht. Aber Claudius betrinkt sich fürchterlich, bekommt auch Durchfall, und die Verschwörer müssen befürchten, dass aus ihrem Anschlag nichts wird. In dieser Situation geht Agrippina aufs Ganze. Der Arzt tritt in Aktion. Er hat eine Feder dabei, die benutzt wird, um durch Kitzeln des Schlundes Erbrechen hervorzurufen – damit man weiter essen kann. Die Spitze der Feder ist mit einem schnell wirkenden Gift bestrichen. Claudius überlebt diese »Behandlung« dann auch nicht. Kaltblütig und umsichtig bereitet Agrippina die nächsten Schritte vor. Sie verhängt eine Art Nachrichtensperre. Der Senat wird einberufen und zu Gesundheits- und Segenswünschen an die Adresse des Claudius veranlasst – während der also Geehrte längst in Totenkleider gehüllt in seinem Palast liegt. Inzwischen vollzieht sich ein geräuschloser Machtwechsel. Als alles geordnet ist, wird am 13. Oktober Nero als Princeps (so der Titel der römischen Kaiser) präsentiert. Es gibt keinen Widerspruch.
Historiker bezweifeln heute, dass sich alles so abgespielt hat, wie es Tacitus schildert. Aber auch sie gestehen Agrippina ein bedeutendes Maß an Geistesgegenwart zu. Wenn der Giftmord vielleicht nur Erfindung ist und Claudius aus anderer Ursache plötzlich verstarb, sodass Agrippina gar nicht nachhelfen musste, verstand sie doch schneller als andere, die Situation für sich zu nutzen.
Nero schrieb Verse, übte sich im Gesang und in den bildenden Künsten, verbrachte viel Zeit bei Pferden und Wagenrennen und trieb sich auch gerne mit Jugendlichen seiner Gesellschaftsklasse nachts auf den Straßen Roms herum, wo er schon mal in Schlägereien verwickelt wurde. Politik zu machen überließ er anderen. Seiner Mutter fiel es unter diesen Umständen leicht, sich im Zentrum der Macht zu etablieren. Neros Erzieher Seneca und der Prätorianerpräfekt Burrus traten ihr dabei zur Seite. Sie veranlassten Säuberungen, planmäßig wurden die Vertreter des alten Regimes aus ihren Stellungen verdrängt. Narcissus zum Beispiel, der engste Vertraute des Kaisers Claudius, wanderte ins Gefängnis und kam dort ums Leben. Das gute Einvernehmen innerhalb des neuen Führungstrios sollte indes nicht lange währen. Burrus und Seneca waren nicht bereit, Agrippina eine offizielle Stellung als Regentin zu gewähren. Wie Tacitus meint, empfanden sie Unbehagen angesichts ihres »unbeherrschten Wesens«, sie sei »von der ganzen Leidenschaft einer schlimmen Herrschsucht entbrannt«. Die Kaiserin-Mutter sah sich bald in einen Machtkampf verstrickt, der umso gefährlicher für sie wurde, als sich auch Nero gegen sie wandte. Er hatte ein Liebesverhältnis mit einer Freigelassenen namens Acte angefangen. Seine Erzieher hatten nichts dagegen, wenn er nur die adligen Damen Roms in Ruhe ließ. Agrippina aber passte die Liebesgeschichte nicht, sie hatte andere Pläne mit ihrem Sohn. Der jedoch verteidigte störrisch sein Recht, sich Frauen zu wählen, die ihm zusagten.
Anders als im Namen irgendeines Imperators oder Imperator-Kandidaten konnte Agrippina sich nicht in die Politik mischen, also suchte sie sich einen Mann, der die Bedingungen dafür erfüllte. Ihre Wahl fiel auf Britannicus, ihren Stiefsohn. Dessen Herrschaftsrechte hatte sie zuvor souverän ignoriert, da sie ja ihren Sohn Nero ins höchste Amt manövrieren wollte. Nun, da Nero nicht mehr mitspielte und die beiden Berater sich ihr gleichfalls verweigerten, griff sie auf Claudius’ Sohn zurück und drohte damit, ihn von den Prätorianern an Neros Stelle zum Imperator ausrufen zu lassen.
Schärfer konnte die Kampfansage nicht ausfallen. Nero reagierte tückisch und brutal. Bei einem Festmahl ließ er Britannicus vergiften. Ungerührt sah er dem Todeskampf zu und erklärte den Gästen, der Jüngling neige zur Epilepsie und erleide gerade einen seiner gewohnten Anfälle. Agrippina verlor ihre Ehrenwache und durfte das Haus ihres Sohnes nicht mehr betreten. Gleichwohl intrigierte sie weiter, noch gab sie den Kampf nicht verloren. Unermüdlich war sie hinter den Kulissen zugange, sammelte Verbündete, raffte Geld zusammen. Bei einem Gelage wurden Nero die Umtriebe seiner Mutter hinterbracht. Darauf beschloss er, sie umzubringen. Er ließ sich jedoch von seinen Beratern beeinflussen, Agrippina noch eine Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. In glänzender Rede wies sie alle Vorwürfe zurück, worauf Nero seine Mordpläne fürs erste vergaß. Sie kamen aber sofort wieder auf die Tagesordnung, als der Imperator sich in Poppaea Sabina verliebte und dafür die von seiner Mutter gestiftete Ehe mit Octavia drangab. Poppaea verlangte von ihm, Agrippina endgültig zu beseitigen. In dieser Situation soll laut Tacitus die Mutter, »in ihrer unbeherrschten Gier, ihre Machtstellung zu behaupten«, bereit gewesen sein, sich dem Sohn hinzugeben – um ihn auf diese Weise von anderen Frauen abzuhalten. Das will der Autor mündlichen Berichten entnommen haben, die er für glaubwürdig hält, da Agrippina durch die Inzest-Hochzeit mit ihrem Onkel »für jede Schandtat vorgeübt« gewesen sei. Ob etwas daran war oder nicht, die Mordpläne nahmen nun wieder Gestalt an. In den Kaiserbiografien des antiken Schriftstellers Sueton (um 70 bis um 140) ist nachzulesen, auf was für Einfälle Nero und seine Vertrauten kamen, um den Mord als Unfall zu tarnen: In Agrippinas Schlafzimmer soll durch eine künstliche Maschinerie die Decke zum Einsturz gebracht werden oder man will sie auf ein Schiff locken, das für ein Auseinanderbrechen auf hoher See präpariert ist; die Schiffs-Idee setzt sich durch. Der Kahn geht bei Baiae, einem Luxus-Kurort, auch richtig unter, aber Agrippina rettet sich schwimmend. Die Nachricht vom glücklichen Überleben seiner Mutter versetzt Nero in Panik, er sendet Soldaten ins Landhaus der Agrippina, die den Mord auf ganz herkömmliche und offene Weise begehen, mit dem Schwert. Der Öffentlichkeit wird eine jämmerliche Geschichte präsentiert, die dadurch nicht besser wird, dass Seneca sie formuliert: Man habe Beweise, dass Agrippina ihrerseits geplant habe, Nero einen Mörder ins Haus zu schicken; nach dessen Entlarvung habe sie Selbstmord begangen. Tacitus fügt seiner Darstellung des Muttermordes im Jahr 59 noch ein bezeichnendes Detail hinzu: Dem Zenturionen, der, das Schwert in der Faust, auf sie zutrat, habe Agrippina ihren Schoß entgegengestreckt und ihn aufgefordert, dort hinein zu stoßen, in den Schoß, der Nero geboren …
Der Auftraggeber und Nutznießer der Tat spielte eine Weile den Leidtragenden und tat, als ob er den Tod seiner Mutter beweine. In die Hauptstadt traute er sich allerdings erst zurück, als er sicher sein konnte, dass es keine Unruhen geben werde. Fortan kannte er keine Bedenken mehr zu tun, was ihm beliebte, und sich vollständig seinen Launen hinzugeben, ob es nun darum ging, als Sänger aufzutreten oder tatsächliche und vermeintliche Gegner, auch in der eigenen Familie, mit Mord, politischen Prozessen und Hinrichtungen aus dem Weg räumen zu lassen. Seine Schreckensherrschaft, unvergesslich durch den Brand Roms und die blutigen Christenverfolgungen, dauerte bis ins Jahr 68, dann zwang ihn eine Rebellion der Armee, Selbstmord zu begehen.
Poppaea übrigens, die ihn zum Mord an seiner Mutter Agrippina angestiftet hatte, sollte wenig davon haben. Zwar heiratete sie Nero im Jahr 62, nachdem er sich von Octavia hatte scheiden lassen, und sie bekam auch ein Kind von ihm, das jedoch nur wenige Monate lebte. Während einer erneuten Schwangerschaft ereignete es sich, dass Nero verspätet von einem Wagenrennen nach Hause zurückkehrte. Poppaea, leidend, machte ihm deswegen Vorwürfe. Nero geriet in Wut und trat seine Gattin in den Bauch. Sie starb an den Folgen der Misshandlung.