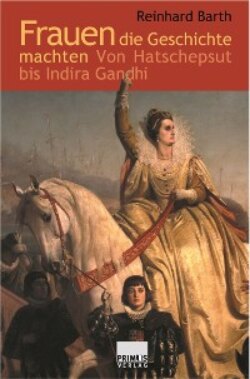Читать книгу Frauen die Geschichte machten - Reinhard Barth - Страница 16
Chrodechilde
ОглавлениеDie erste Königin des Frankenreichs
Der Übertritt des Frankenkönigs Chlodwig I. vom Heidentum zum christlichen Glauben, vollzogen zu Weihnachten in einem nicht klar bestimmbaren Jahr zwischen 497 und 499 oder auch erst 506, war eines der folgenreichsten Ereignisse der Weltgeschichte, darin sind sich die Historiker einig. Der Fürst aus dem Geschlecht der Merowinger war bis dahin noch einer unter vielen anderen germanischen Herrschern, die in der Zeit der Völkerwanderung auf dem Boden des früheren Römischen Reiches Staaten errichteten. Mit der Taufe rückte er in eine Position, die ihm Möglichkeiten bot, die den anderen Herrschern verschlossen blieben. Die Gründungen der Wandalen in Nordafrika, der Westgoten auf der Iberischen Halbinsel, der Ostgoten und Langobarden in Italien zerfielen alle wieder. Das Fränkische Reich dagegen wuchs unter Chlodwig und seinen Nachfolgern über Jahrhunderte stetig an. Unter den Karolingern schließlich, die die Merowinger beerbten, erstreckte sich das Fränkische Reich vom Ebro bis zur Elbe, von der Bretagne bis nach Ungarn und von Holstein bis nach Mittelitalien. Und selbst nach den vielen Teilungen im 9. und 10. Jahrhundert blieben lebensfähige Großstaaten, Frankreich und Deutschland, übrig.
Der Grund für die enorme Stetigkeit und Standfestigkeit des Fränkischen Reiches lag im Bündnis mit der römischen Kirche. Denn Chlodwig trat nicht einfach nur zum Christentum über, sondern zum Katholizismus, zum Glauben, den die Kirche in Rom praktizierte – damals keine Selbstverständlichkeit. Die christliche Welt war seit dem Konzil von Nicäa 324/325 geteilt in die Anhänger des Bischofs Athanasius, der die Lehre von der Gottgleichheit Jesu Christi vertrat, und die Gläubigen, die seinem Kontrahenten Arius folgten, der postulierte, dass Jesus dem Vater nur wesensähnlich und also untergeordnet sei. Athanasius war der maßgebliche Mann für das Papsttum und die Kirche in Rom, unter den Germanen hingegen, die das Christentum angenommen hatten, galt Arius als die entscheidende Instanz. Das Konzil von Nicäa hatte die Lehre des Arius verdammt, sie befand sich seitdem auf verlorenem Posten, wenn das auch angesichts der Zahl ihrer Anhänger noch kaum zu spüren war. Chlodwigs Entscheidung für das athanasianische, also römisch-katholische Bekenntnis brachte ihn in Frontstellung zu den germanischen, arianisch orientierten Staaten der Nachbarschaft. Das kam ihm durchaus nicht ungelegen, da das abweichende Bekenntnis ihm einen günstigen Vorwand für die künftige fränkische Expansion etwa in Richtung des westgotischen und des burgundischen Reiches bot. Der Frankenkönig konnte nun gleichsam als Missionar auftreten, der den rechten Glauben mit der Waffe in der Hand durchsetzte. Vor allem aber förderte es die Konsolidierung des eigenen Machtbereiches. Chlodwig gründete sein Reich im ehemals römisch besetzten Gallien. Die einheimische Bevölkerung war katholisch, die Kirchenorganisation nach Rom orientiert. Die Kirche nahm vielfältige Aufgaben wahr, die ehemals der römische Staat geleistet hatte, etwa im Bereich der Sozialpolitik. Das konnten die Franken jetzt für sich nutzen. Indem Chlodwig den in Gallien dominierenden Glauben annahm, tat er einen bedeutenden Schritt hin zur Integration. Bis dahin hatte germanische Reichsbildung auf römischem Boden immer Fremdherrschaft bedeutet. Eine dünne Herrscherschicht etablierte ihren Staat ohne Beziehung zur einheimischen Bevölkerung, mit der sie nicht einmal das religiöse Bekenntnis teilte. Das war im Fränkischen Reich anders. Bereitwillig nahmen die Einwanderer die Kultur der Unterworfenen auf, und da es, wenigstens was den Glauben betraf, keine Differenzen gab, fielen die Prozesse der Eingewöhnung und Verschmelzung beiden Seiten leichter.
Chlodwigs Übertritt zum katholischen Glauben – was er übrigens nicht allein tat, sondern gemeinsam mit 3000 Mann seines Gefolges – soll auf Veranlassung seiner Frau Chrodechilde geschehen sein. Der fränkische Geschichtsschreiber Gregor von Tours berichtet 590 in seinen »Zehn Bücher Geschichten«, Chrodechilde, selbst bereits Christin, habe ihren Mann lange bearbeitet, dem Heidentum abzuschwören. Dies tat er zu einem kritischen Zeitpunkt, während einer Schlacht gegen die Alemannen. »Chlodwigs Heer war nahe dran, vernichtet zu werden«, schreibt Gregor. »Als er das sah, erhob er seine Augen zum Himmel, sein Herz wurde gerührt, seine Augen füllten sich mit Tränen, und er sprach: ›Jesus Christ, Chrodechilde sagt, du seiest der Sohn des lebendigen Gottes, Hilfe sollst du den Bedrängten, Sieg geben denen, die auf dich hoffen – ich flehe dich demütig an um deinen mächtigen Beistand.‹«
Über die Frau von König Chlodwig gibt es nur wenig Quellenmaterial, und direkt zeitgenössisch ist fast nichts davon. Das früheste Zeugnis ist ein Brief des Erzbischofs von Trier aus dem Jahr 567, gerichtet an eine Enkelin Chrodechildes: Darin wird sie aufgefordert, dem Beispiel ihrer Großmutter zu folgen und ihren Mann, den Langobardenkönig Alboin, zu bekehren. Der bereits erwähnte Gregor von Tours verfasste seine »Zehn Bücher Geschichten« um 590. Die Chronik des Fredegar, in der die Königin gewürdigt wird, entstand um 625, das anonyme »Buch der fränkischen Geschichte«, in dem sie gleichfalls vorkommt, um 726, die »Vita Sanctae Chrothildis«, eine Lebensbeschreibung der mittlerweile zur Heiligen aufgerückten Königin noch viel später, wahrscheinlich erst im 10. Jahrhundert. Wie nicht anders denkbar, stammt alles Quellenmaterial aus kirchlichen Kreisen und gibt insofern eine eigene (gefärbte) Sicht auf die Dinge wieder. Die Rolle, die Chrodechilde bei der Bekehrung des Frankenkönigs spielte, wird darin nach Kräften hervorgehoben. In die Darstellung ihres Lebens mischte man Legenden, Märchen und Sagen hinein.
Wer war Chrodechilde? Chrodechilde stammte aus burgundischem Königsgeschlecht. Sie war die Tochter eines Teilherrschers namens Chilperich. Ihr Geburtsdatum ist unbekannt, es könnte um das Jahr 478 gelegen haben. Die Quellen dichten ihr ein Aschenbrödel-Dasein am Hof ihres Onkels Gundobad an, der ihre Eltern und ihre Brüder ermordet haben soll. Das ist vermutlich ebenso unrichtig wie auch die Geschichte von Chlodwigs Brautwerbung: Ein Vertrauter des jungen Frankenkönigs, der sich als Bettler verkleidete, soll der scharf bewachten Chrodechilde den Heiratsantrag überbracht haben. Dabei geschah die Brautwerbung ganz offiziell, die Hochzeit fand vermutlich zwischen den Jahren 492 und 494 statt. Chrodechilde war etwa 15 Jahre alt, der Bräutigam, geboren 466, deutlich älter als sie. Er war auch bereits Vater. Eine unbekannte Frau hatte ihm einen Sohn namens Theuderich geboren. Dergleichen war im merowingischen Königshaus und auch sonst in der germanischen Welt üblich, man nannte solche Verhältnisse Friedelehen. Die Kinder aus diesen Verhältnissen galten als erbberechtigt. Theuderich sollte dann auch nach Chlodwigs Tod 511 seinen Anteil am väterlichen Erbe erhalten, genau wie die Söhne, die Chrodechilde zur Welt brachte.
Die junge fränkische Königin war Christin, aber anders als bei den arianischen Burgundern üblich, im römisch-katholischen Glauben erzogen. Sie verdankte das einer Ziehmutter, die sich am Hof ihrer angenommen hatte. Das Christentum hatte sich in der Oberschicht auch schon zu römischer Zeit vor allem durch die Frauen ausgebreitet.
Wie kam ihr Mann Chlodwig an den neuen Glauben? Geschah es, wie bei Gregor beschrieben, nach langem beharrlichen Bohren Chrodechildes und theologischen Diskussionen der Eheleute, in denen Chlodwig Mühe hatte, die Vorzüge seiner heidnischen »Götzen«, also Wodans, Thors und anderer Größen der germanischen Götterwelt, zu verteidigen? Oder gar durch den Einsatz der berühmten »Waffen der Frau«? Das »Buch der fränkischen Geschichte«, die Quelle aus dem 8. Jahrhundert, will uns jedenfalls glauben machen, dass Chrodechilde am Hochzeitstag auf der Schwelle zum Schlafzimmer einen entsprechenden Anlauf dazu unternahm. »Am Abend desselbigen Tages«, erzählt der wahrscheinlich geistliche Verfasser, »als sie nach dem Hochzeitsbrauche miteinander schlafen sollten, wandte sie, wie sie verständigen Sinnes war, ihre Gedanken und Hoffnungen an den Herrn und sprach: ›Nun, mein König und Herr, höre die Worte deiner Magd und gewähre in Gnaden, was deine Magd bittet, ehe sie deinem Willen sich beugt.‹ Der König sagte: ›Verlange, was du willst, und ich will es dir gewähren.‹« Das »verständige« Mädchen legt daraufhin ihrem Gemahl einen regelrechten Forderungskatalog vor, nach dem er sich zum Glauben erstens an Gottvater, zweitens an den Sohn Jesus Christus und drittens an den heiligen Geist bekennen soll. Ferner soll er den heidnischen Götzen abschwören, die Kirchen, die er zerstört hat, wieder aufbauen und Chrodechildes Erbteil bei ihrem Onkel reklamieren. Chlodwigs Antwort ist ausweichend. Das burgundische Erbteil – gewiss, dafür will er sich einsetzen. Aber die anderen Dinge – die sind vorerst nicht zu machen, »zu schwer« lautet seine Auskunft.
Führt man sich vor Augen, was von Chlodwig sonst bekannt ist, seine Schlauheit und Gewalttätigkeit – er schreckte bekanntlich nicht davor zurück, Verwandte eigenhändig umzubringen – die Autorität, die er genoss, und sein politischer Scharfblick, dann kann man ihn sich kaum als zugänglich für weibliche Missionsversuche vorstellen – es sei denn, er erkannte einen Nutzen für sich dabei. Der Bischof von Tours verweist auf die Bedrängnis in der Alemannenschlacht, die letztlich den Ausschlag gegeben habe. Dieser Beweggrund wird heute für plausibel gehalten. Chlodwigs Bekehrung vollzieht sich, so die Deutung, durch ein starkes Erlebnis, das ihm zuteil wird, in diesem Fall eine fast schon verlorene Schlacht, die sich wunderbarerweise zu seinen Gunsten wendet. Das entspricht germanischer Anschauung. Im Kampf klärte sich, ob eine Sache gut und gerecht war. Wenn die alten Götter nicht vermochten, Chlodwig den Sieg zu sichern, ihn im Gegenteil in Todesnot geraten ließen, dann war er bereit, auf den neuen Gott zu setzen. So redet Chlodwig – in Gregors Darstellung – Gott in seinem Gebet auf dem Schlachtfeld als Vertragspartner an, mit dem er ein Geschäft eingeht: »Gewährst du mir jetzt den Sieg über diese Feinde und erfahre ich so deine Macht, die das Volk, das deinem Namen sich weiht, an dir erprobt zu haben rühmt, so will ich an dich glauben und mich taufen lassen auf deinen Namen.«
Soll Chrodechilde also gar keinen Einfluss auf die Entscheidungen ihres Mannes gehabt haben? Das wird man nach Prüfung der Nachrichten, vor allem der über ihren späteren Lebensgang, so nicht stehen lassen können. Sie erscheint darin als eine Frau, die sich ins politische Geschäft einzumischen und ihre Interessen durchzusetzen wusste. Bereits vor dem Übertritt ihres Mannes zum Christentum sorgte sie dafür, dass ihre Kinder getauft wurden. Dabei musste sie allerdings einen herben Schicksalsschlag hinnehmen: Der erste Sohn, Ingomer, starb noch in seinen Taufkleidern, auch der zweite, Chlodomer, wurde früh von schwerer Krankheit befallen. Er überlebte jedoch, ebenso die beiden nächsten Söhne Childebert und Chlotachar sowie die Tochter Chlodechild. Nach dem frühen Tod ihres Mannes im Jahr 511 begann jetzt ihre eigentliche politische Rolle. Dergleichen sollte im Merowingerhaus auch später noch vorkommen. Die Funktion einer Regentin, wie sie Chrodechilde ausübte, nahmen etwa auch Balthild († nach 690), die Witwe König Chlodwigs II., wahr, die sich besonders auf dem Gebiet der Kirchenpolitik betätigte, oder die berüchtigten Königinnen Fredegunde († 597) und Brunichilde († 613), die das Herrscherhaus zum Schauplatz einer Jahrzehnte währenden blutigen Privatfehde machten.
Chrodechilde ihrerseits griff in die Kirchenpolitik ein, veranlasste Klostergründungen und setzte in Tours, dem religiösen Zentrum des Landes (hier stand das Grab des »Nationalheiligen« Martin), mehrere Bischöfe ein. Da sie Zugriff auf den Staatsschatz hatte, konnte sie den Männern ihrer Wahl reichlich Mittel zukommen lassen. 523 wirkte sie bei der Vorbereitung des Feldzuges ihrer Söhne gegen Burgund mit. Laut Gregor von Tours, um den Tod ihrer Eltern zu rächen. Als ihr Sohn Chlodomer im Burgunderkrieg ums Leben kommt, übernimmt sie die Erziehung seiner Söhne. Damit aber kam sie den beiden anderen Söhnen, Childebert und Chlotachar, ins Gehege. Diese hatten nämlich beschlossen, Chlodomers Besitz unter sich aufzuteilen. Ihrer Mutter unterstellten sie, die Kinder nur deswegen unter ihrer Obhut zu halten, um sie später als Erben König Chlodomers präsentieren zu können. Um dies zu verhindern, brachten Childebert und Clothachar ihre Neffen kurzerhand um. Die Morde, geschehen im Jahr 531, waren für Chrodechilde das Signal, sich aus der politischen Welt zurückzuziehen. Sie nahm Quartier in Tours, in dem von ihr gegründeten Frauenkloster von St. Peter. Dort starb sie im Jahre 544. Ihre Gebeine wurden in der Apostelbasilika Sainte-Geneviève in Paris beigesetzt, die König Chlodwig einst gründete und in der er gleichfalls die letzte Ruhestätte gefunden hatte.
Um Chrodechilde oder Chlothilde, wie sie in der frommen Überlieferung auch genannt wird, rankten sich bald Legenden, die ihr mildtätiges Wesen hervorhoben. So soll sie, als die Arbeiter bei dem Bau einer ihrer Kirchen bei großer Sommerhitze starken Durst litten, das trübe Wasser aus einer spärlichen Quelle in reinsten Wein verwandelt haben. Später sollen dann Lahme, die sich an der Quelle wuschen, wieder haben laufen können. In den Stand der Heiligen erhoben, wurde Chrodechilde die Patronin der Frauen, der Notare und der Lahmen, zuständig auch für die Heilung von Fieber und Kinderkrankheiten und für die Bekehrung irregegangener Ehegatten (dies der direkte Reflex auf ihren Anteil an der Taufe Chlodwigs). Ihre Attribute auf bildlichen Darstellungen sind Krone, Zepter und Schleier. Sie teilt Almosen aus und trägt das Modell einer Kirche, ein Engel neben ihr hält ein Wappenschild mit drei französischen Lilien. Zu Merowingerzeiten hatten die französischen Lilien allerdings noch keine Bedeutung. Aber dies zeigt, welche Rolle der Königin Chrodechilde beigemessen wurde: Späteren Geschlechtern galt sie als die Stamm-Mutter der merowingischen Herrscher.