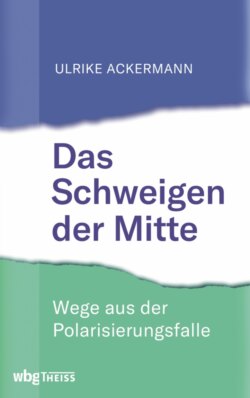Читать книгу Das Schweigen der Mitte - Ulrike Ackermann - Страница 12
„Einzelkämpfer um Wahrheit“
ОглавлениеAuch die große ungarische Philosophin Agnes Heller, die 2019 mit 90 Jahren verstarb, war in die Debatten über die Rolle von Intellektuellen immer wieder involviert. Sie war nur knapp der nationalsozialistischen Judenvernichtung entgangen, hatte sich als junge Frau den Kommunisten angeschlossen, wurde jedoch kurze Zeit später aus der KP ausgeschlossen. Ihre Beteiligung an der Ungarischen Revolution 1956 und der spätere Protest gegen den Einmarsch der Warschauer Truppen in Prag 1968 bescherten ihr Berufsverbote. Fortan durfte sie weder reisen noch publizieren. Schließlich emigrierte sie 1977 und lehrte später an der New School in New York. Von mir zur Rolle der Intellektuellen befragt, antwortete sie Ende der 1990er-Jahre: „Die Verantwortlichkeit der Intellektuellen besteht darin, zu wissen, es gibt keine einheitliche, absolute Lösung. Man kann nie sagen, jetzt sind wir angekommen, jetzt können wir unser Geschäft beenden. Wir werden nämlich nie ankommen. Alle Schritte, die man mit der liberalen Demokratie tut, sind gute Schritte.“ Aber, fügte sie an, in allen Schritten liege auch eine Gefahr, denn die Moderne sei labil. Sich dieser Labilität bewusst zu sein, immer wieder die problematischen Punkte zu kritisieren, immer wieder zu entdecken, was neue Gefahren birgt, das seien die wirklichen Aufgaben der Intellektuellen – und „nicht, das zu sagen, was die größte Gefahr vor fünfzig Jahren war.“
Ralf Dahrendorf verkörperte bis zu seinem Tod 2009 diesen Typus des Intellektuellen ganz fabelhaft. Seine Arbeit als Wissenschaftler, öffentlich streitender Intellektueller und zeitweise Politiker kreiste zeit seines Lebens um die Verfassung der Freiheit – aus der Perspektive des Soziologen, des deutschen und britischen Staatsbürgers und des Weltbürgers. In seinem letzten Buch Versuchungen der Unfreiheit. Die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung entwickelte Dahrendorf eine Art Katalog der intellektuellen Tugenden. Er wählte dafür Biografien öffentlicher Intellektueller aus, die zwischen 1900 und 1910 geboren und von ähnlichen Erfahrungen geprägt wurden. Mit ihnen, u.a. Raymond Aron, Karl Popper, Isaiah Berlin und Hannah Arendt, durchstreift er das letzte Jahrhundert und ergründet, warum gerade sie sich nicht vom rechten oder linken Totalitarismus haben verführen lassen, trotz mannigfaltiger Heimsuchungen. Dabei entwickelt er eine Tugendlehre der Freiheit, „allgemeine Werte plus individuelle Mühe“. Mut, Sinn für Gerechtigkeit, Besonnenheit und Weisheit, verbunden mit ihrer geistigen Stärke und inneren Kraft befähigten sie, den totalitären Verführungen zu widerstehen. Sie hatten den „Mut des Einzelkämpfers um Wahrheit“ und vertraten ihre Meinung in fremder, oft feindseliger Umgebung, dem Zeitgeist entgegengesetzt, einsam und unabhängig, ohne den Rückhalt einer Gemeinschaft oder Partei. In ihrer Suche nach Wahrheit war ihnen ständig bewusst, dass sie die Wahrheit nicht finden würden, und so revidierten sie, wenn nötig, ihre vormals eingenommene Position. Als „engagierte Beobachter“, ausgestattet mit der „Weisheit der leidenschaftlichen Vernunft“, begleiteten sie die politischen Tumulte und Katastrophen des letzten Jahrhunderts, analysierten ihre Zeit und bezogen Stellung.
Dahrendorfs Protagonisten waren fast alle am Netzwerk des Kongresses für kulturelle Freiheit beteiligt gewesen. Doch organisiertes Eingreifen der Intellektuellen, wie es im Rahmen des Kongresses immer wieder stattgefunden hatte und wie es sich Jahrzehnte später noch Pierre Bourdieu wünschte, war Dahrendorf fremd. Er war als öffentlicher Intellektueller ein „Grenzgänger zwischen Sozialwissenschaften und Politik, zwischen Analyse und Aktion“, ein „straddler“, wie er sich selbst beschrieb, der keine Gebrauchsanweisungen gebe, aber die menschlichen Dinge mit immer neuen Versuchen – und Irrtümern – voranbringen wollte, um die Lebenschancen für alle zu vergrößern.
Mitte der 1950er-Jahre war er kurz Wissenschaftlicher Assistent bei den aus dem amerikanischen Exil zurückgekehrten Theodor W. Adorno und Max Horkheimer am Frankfurter Institut für Sozialforschung, den Leitfiguren der sogenannten Kritischen Theorie. Doch behagte Dahrendorf das dortige Betriebsklima nicht, wollte er doch seinen eigenen Weg gehen. Obwohl er als Student noch begeistert gewesen war von Adornos und Horkheimers berühmter Schrift Dialektik der Aufklärung, die noch weitere Studentengenerationen stark prägen sollte, ging Dahrendorf auf Distanz zu den Kritischen Theoretikern. Er wurde später – besonders mit seinen Schriften Gesellschaft und Freiheit 1962 und Gesellschaft und Demokratie in Deutschland 1968 – zum liberalen Gegenspieler von Jürgen Habermas, der das theoretische Erbe Adornos und Horkheimers angetreten hatte und sich als Sachverwalter und Fortentwickler der Kritischen Theorie und eines weiterentwickelten Marxismus verstand. Und dabei war der heute 90-jährige Habermas durchaus einflussreich, was seine Position auf dem zweiten Platz der Cicero-Liste 2019 belegt.