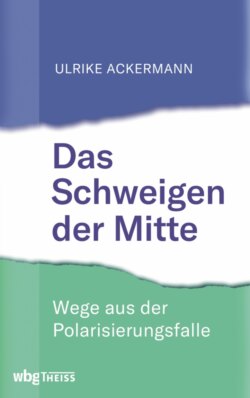Читать книгу Das Schweigen der Mitte - Ulrike Ackermann - Страница 7
Einleitung
ОглавлениеIn seinem letzten Buch Versuchungen der Unfreiheit wünschte sich Ralf Dahrendorf Intellektuelle als besonnene, „engagierte Beobachter“, ausgestattet mit der Weisheit der leidenschaftlichen Vernunft. Er hoffte auf ihre Interventionen angesichts eines neuen Autoritarismus und verlangte von ihnen gleichermaßen kühle Reflexion, „ein Leben zwischen den Eindeutigkeiten, ein unbequemes Leben also, das dennoch ertragen werden will.“
Gibt es diese öffentlichen Intellektuellen noch, die unbequem sind, aber nicht schrill, die beraten können, ohne Machthörig zu sein? Brauchen wir sie überhaupt noch nach diesem rasanten Strukturwandel der Öffentlichkeit im Zuge der digitalen Revolution? Jene bürgerliche Öffentlichkeit, in der Intellektuelle ehemals agierten, verflüchtigt sich zunehmend zwischen Blogs und Plattformen im Internet, zwischen Informationsblasen, Shitstorms und sich ständig selbst aufheizenden Echoräumen. Und damit verlieren auch die intellektuellen Akteure selbst an Bedeutung. Einige beklagen diese Fragmentierung der Öffentlichkeit, andere bejubeln den Verlust der einstmaligen Deutungshoheit, die Intellektuelle innehatten, und rühmen die neue Demokratisierung der Diskurse. So überhaupt noch Rat eingeholt wird, sei es in der Politik, in Institutionen oder Talkshows, sind heute anstelle breit gefächerter und universalistischer Perspektiven zudem eher Experten mit spezialisiertem Fachhorizont gefragt. Geistfeindlichkeit und die Neigung, die Komplexität der Welt auf einfache Muster herunterzubrechen und keine Ambivalenzen zu dulden, machen sich allenthalben breit. Diese Anfeindung des Intellekts geht einher mit einer immer vehementer um sich greifenden Anti-politik. Ihre autoritären Anführer scharen per Twitter diesseits und jenseits des Atlantiks eine virtuelle Volksgemeinschaft um sich und setzen sich über Gewaltenteilung und deliberative Traditionen der Demokratie dreist hinweg. Wenn diese über Jahrhunderte hart erkämpften politischen Freiheiten selbst zur Disposition stehen und unter wachsenden Druck geraten, wäre eigentlich die Stunde der Intellektuellen gekommen, um diese Freiheiten zu verteidigen. Doch wo sind sie heute und wer sind sie überhaupt?
Seit der Dreyfus-Affäre Ende des 19. Jahrhunderts und Émile Zolas berühmter Parteinahme – die Geburtsstunde des modernen Intellektuellen – hadern sie mit ihrer Rolle. Anlass für diese erste spektakuläre Intervention eines Intellektuellen war die Verurteilung des jüdischen Hauptmanns Alfred Dreyfus wegen Spionage für die Deutschen von einem Pariser Gericht. Begonnen hatte sie mit Émil Zolas offenem Brief an den Präsidenten der Republik, der am 13. Januar 1898 in der von Georges Clemenceau herausgegebenen Tageszeitung L’Aurore mit der Überschrift „J’Accuse“ erschien. Der französischen Armee und Justiz warf er vor, das Recht zu beugen und einen Komplott gegen die Republik zu schmieden. Zolas Aufruf folgte eine Flut von Petitionen, Artikeln und Debatten, in denen Schriftsteller und Journalisten öffentlich das Wort ergriffen, um sich für oder gegen Dreyfus zu positionieren. Erstmals wurden diese Unterzeichner der zahlreichen Petitionen Intellektuelle genannt: zustimmend und positiv aufseiten der Dreyfus-Verteidiger und verunglimpfend seitens seiner Gegner. Bei ihnen mischten sich antisemitische Töne mit der Sorge um die nationale Einheit und die Staatsraison, die sie durch Zolas Appell gefährdet sahen. Die Dreyfus-Verteidiger hingegen intervenierten, um die Würde des einzelnen Menschen, um Wahrheit und Gerechtigkeit zu verteidigen, waren ihnen universelle Werte doch wichtiger als das nationale Interesse. Von Anfang an stellte sich damit die Frage nach dem politischen Engagement der Intellektuellen: Ist es ihre Aufgabe, gegen die Macht aufzustehen, oder sollen sie sich der Politik enthalten und ihre Schreibtische, Katheder oder Leinwände besser nicht verlassen?
Bis heute stehen Intellektuelle vor diesem Dilemma: öffentliches Eingreifen in Debatten oder Enthaltsamkeit gegenüber der schnöden Empirie und dem schmutzigen Geschäft der Politik? Intervention oder Abstinenz zugunsten der hehren Wissenschaft, Literatur und Neutralität? Obwohl die komplizierte Weltlage gerade jetzt intellektuellen Esprit im öffentlichen Raum und der Politik bitter nötig hätte.
Die Unzufriedenheit der Bürger mit dem politischen Personal, das allzu oft Politmarketing mit Politik verwechselt, der immense Vertrauensverlust und die Verachtung der Eliten sind in Europa und den USA inzwischen so ausgeprägt, dass die alten Volksparteien reihenweise abgewählt werden und populistische Parteien und Bewegungen allgegenwärtig geworden sind.
Die Landtagswahl in Thüringen 2019 zeigte erneut, dass die politische Mitte zerbröselt und keine Regierungsbildung mit dem bürgerlichen Lager mehr möglich ist. Die extremen Ränder stellen die absolute Mehrheit, die Linke ist erstmals stärkste Partei in einem Bundesland geworden, und die gewachsene AfD erhält ein Viertel der Stimmen.
Doch nicht nur die politische Klasse hat in den letzten Jahren stark an Glaubwürdigkeit verloren, sondern das Misstrauen und die Ressentiments der Bevölkerung gelten auch den Leistungseliten in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Medien. Ihnen wird vorgeworfen, versagt zu haben, weil sie ihre Bodenhaftung eingebüßt hätten und den immensen Herausforderungen, mit denen die westlichen, liberalen Demokratien konfrontiert sind, nur zögerlich begegnet seien: Weltweite Migrationsbewegungen nach Europa auf der Flucht vor Bürgerkriegen und auf der Suche nach Wohlstand, die Europäische Union (EU) selbst in der Krise und am Scheideweg, westliche Werte und Freiheiten unter Druck von außen wie von innen, fortgesetzter islamistischer Terror gegen unseren Lebensstil und das Wiedererstarken autoritärer politischer Führer. Man denke nur an die neoimperiale Politik Wladimir Putins, Chinas ökonomischen Eroberungsfeldzug oder Erdoğans islamistische Präsidialdiktatur. Der autoritär-chauvinistische Führungsstil hat auch in Ostmitteleuropa und im Westen seine Nachahmer gefunden. So wird der Rechtsstaat etwa in Polen oder in Ungarns sogenannter „illiberaler Demokratie“ ausgehöhlt. Von Donald Trump gar nicht zu reden, der das lange erfolgreiche westliche Freiheitsprojekt und die bisher geltende Weltordnung täglich weiter demontiert. Lange Zeit waren die Menschenrechte und die Verbreitung von Demokratie Maßstäbe für die US-Außen- und Bündnispolitik. Das ist vorbei: Die bisherige Weltordnung mit Amerika als ordnender, westlicher Führungsmacht droht sich aufzulösen.
Blickt man zurück nach Deutschland, stellt sich die Frage, wie hier die Intellektuellen in dieser unübersichtlich schwierigen Lage agieren. Greifen sie ein oder schweigen sie? Sind sie nützlich oder irrelevant in den Debatten, die unsere Gesellschaft heute über ihre Zukunft und ihren Zusammenhalt umtreibt? Der Soziologie Karl Mannheim sprach 1929, von einer „freischwebenden Intelligenz“, die mutig interveniere, wenn es politisch brenzlig wird, und die zugleich institutionell unabhängig sei. Wer verkörpert eine solche Intelligenz heute noch in Deutschland und wie positionieren sich Intellektuelle politisch in den lodernden gesellschaftlichen Konflikten hierzulande?
Ihr Deutungsmonopol haben sie verloren, auch weil es im Zuge der digitalen Vervielfachung der Kommunikationswege und Plattformen kein Deutungszentrum mehr gibt. Auch die Zahl der intellektuellen „Großköpfe“, die in vergangenen Jahrzehnten die Rede führten und Debatten aus den Universitäten initiierten und aus dem Kulturbetrieb heraus in die Gesellschaft hinein wirkten, hat sich immens verkleinert.
Die großen gesellschaftlichen Debatten werden heute nicht aus der politischen Mitte heraus geführt, sondern entzünden sich von den Rändern her und münden fast umgehend in Polarisierungen. Obwohl das ideologische Rechts-Links-Schema überwunden schien, wird es doch immer wieder bemüht, gleich einem Pawlow’schen Reflex. Gerade Vertreter der akademischen Linken im Wissenschafts- und Kulturbetrieb mit ihren vielfältigen und gut vernetzten Institutionen wirken meinungsbildend, wenn sie unbequeme, nicht gefällige Positionen abkanzeln, weil sie vermeintlich dem Common Sense widersprächen – zum Beispiel in Debatten über Migration, Integration und den politischen Islam oder auch immer wieder über die politische Gestalt und Praxis der EU. Oft geschieht dies mit dem Hinweis, es handele sich bei diesen Positionen um populistisches, rechtes, rassistisches, gar faschistisches oder islamophobes Gedankengut oder provoziere den Beifall aus derartigen Kreisen, also von der ganz falschen Seite. Das sind weit verbreitete Versuche, andere politische Einschätzungen und Deutungen der gesellschaftlichen und politischen Lage zu delegitimieren, was zuweilen sogar in Sprechverboten gipfelt. Rechte und konservative Intellektuelle, die sich zum Erstaunen der linksliberalen Öffentlichkeit inzwischen um Petitionen gruppieren, kontern mit dem Vorwurf der „Meinungsdiktatur“ und der „Herrschaft des politisch Korrekten“, die von links durchgesetzt würden und inzwischen den Mainstream bestimmten. Darin wiederum wittern die Linken das Aufziehen einer konservativen Revolution, gar einen untergründig immer noch in der deutschen Seele fortwährenden Faschismus, dem radikal Einhalt zu gebieten sei. Natürlich ist es alarmierend, wenn Asylbewerberheime angezündet werden, wenn sich Rechtsextreme und Neo-Nazis heute wieder dreister zusammenrotten, bestens vernetzt sind, ihre Parolen lautstark herausbrüllen und zu Terroristen und Mördern werden. Verstörend ist auch die Zunahme des Antisemitismus von rechts, aber auch von links, nicht erst seit dem Anschlag in Halle 2019 – und die lange Tatenlosigkeit des politischen Berlins. Dennoch ist die Rede vom Heraufziehen des Faschismus unsinnig, alarmistisch und verharmlost diese totalitäre Herrschaftsform. Es beginnt auch hier wieder reflexhaft das grobe Faschismus-Antifaschismus-Wechselspiel und prägt den Streit wie eh und je in der Rechts-Links-Konfrontation, obwohl sich die Kontroversen etwa über soziale Gerechtigkeit immer stärker von jener dezidiert klassenpolitischen Position entfernen, die sich vornehmlich an marxistischen Koordinaten orientierte. Der Antikapitalismus ist jedoch immer noch beliebt – auf linker wie auf rechter Seite – und die Schriften von Karl Marx erleben eine Renaissance in der Rezeption, obwohl die Zeit der unterdrückten industriellen Arbeiterklasse längst vorbei ist. Ins Zentrum der erneuten Rechts-Links-Konfrontation ist nun vor allem der Streit über das Selbstverständnis der Nation, ihre Grenzen, ihren Zusammenhalt und über den Umgang mit gesellschaftlichen Minderheiten gerückt. Gestritten wird über die vorgebliche oder reale soziale Benachteiligung neuer Opfergruppen, darunter Migranten, sexuelle, ethnische und religiöse Minderheiten. Frauen stehen immer noch als Benachteiligte und fortwährendes Opferkollektiv im Fokus. Auch in der Debatte über den adäquaten Umgang mit dem Klimawandel stehen sich die Lager unversöhnlich gegenüber.
Wir beobachten heute Polarisierungsprozesse auf unterschiedlichen Ebenen: Sie zeigen sich in sozialen Spaltungen gesellschaftlicher Gruppen, sie prägen Debatten, fördern eine dichotome politische und ideologische Lagerbildung und zeichnen natürlich auch die intellektuelle Landschaft. Intellektuelle sind Teil dieser Prozesse, aktuell wie historisch. Sie forschen über und blicken auf die Realität, deuten, stiften Sinn, ob mit großem oder kleinem Engagement, öffentlich oder im akademischen Raum. In keinem Fall aber stehen sie über den Dingen.
Die Polarisierungen in diesen Debatten sind flankiert von einem wachsenden Moralisierungsdruck, der ein umfassendes Argumentieren, das heißt eine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Krisen und Herausforderungen ohne Denkverbote und ideologische Scheuklappen immer schwieriger macht. Deshalb schnappt die Polarisierungsfalle zu, und sie greift so erbarmungslos, weil die Kontrahenten sich in ihrem Wunsch nach Eindeutigkeit, Reinheit der Position und beim Leugnen von Ambivalenzen gegenseitig noch befeuern.
Der Platz der politischen Mitte hingegen ist weitgehend verwaist – wovon auch der allseits beklagte Niedergang der Volksparteien zeugt. Und dieses entstandene Vakuum wird, bis auf eine sehr überschaubare Anzahl von Protagonisten, intellektuell nicht bespielt. Das heißt: In der politischen Mitte sind Intellektuelle, die den gegenwärtigen Krisen mit beherzt freiheitlichen, antitotalitären und universalistischen Positionen relevant begegnen würden, kaum wahrzunehmen oder fristen ein Dissidenten-Dasein. Die Mitte ist geistig entleert.
Die Polarisierungsfalle lässt sich indes nur öffnen, wenn andere Positionen und Argumente dazwischenfunken und in der verheerenden bipolaren Konfrontation die Mitte für die Vernunft und neue Gedanken zurückerobern. Diesem Befund geht der vorliegende Essay auf den Grund, um entlang der gesellschaftlichen Debatten der letzten Jahre zu verstehen, warum wir uns in dieser unkomfortablen und misslichen Situation befinden. Wo wir doch gerade jetzt alle intellektuelle Kraft aufbieten müssten, um den Anfeindungen der Freiheit und den Angriffen auf unsere liberal-demokratische Ordnung adäquat zu begegnen.