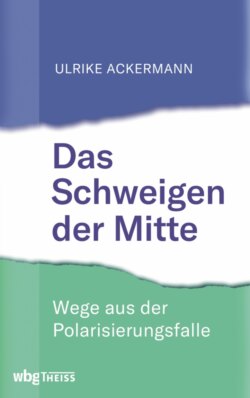Читать книгу Das Schweigen der Mitte - Ulrike Ackermann - Страница 9
Verortungen von rechts bis links
ОглавлениеPierre Bourdieu pochte auf die „kritische Mission“, die den Intellektuellen als Schriftstellern, Künstlern und Wissenschaftlern obliege. Denn aufgrund dessen, was sie wissen und selbst beherrschen, verkörperten sie eine Form von Universalität und hätten als Kollektiv die Funktion, Vernunft zu repräsentieren.
Angesichts des aktuellen Unbehagens im Wissenschaftsbetrieb und der Debatten über Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit an Hochschulen sind Bourdieus damalige Mahnungen geradezu hellseherisch: Der intellektuelle Rekurs auf Universalität schließe die kompetente Wahrnehmung ihrer Eigeninteressen ein. Dazu zählte er vor allem die Veröffentlichung eigener Werke und die Realisierung der Freiheit von Lehre und Forschung. Er war davon überzeugt, dass Intellektuelle kollektiv intervenieren müssten, um „mit ihren Werten allgemein-kritische, vernünftige Werte zu verteidigen“, sagte er mir 1992 in einem Gespräch.
Bourdieu, selbst nicht frei von eitlen Neigungen, sparte nicht mit Polemik gegenüber den sogenannten Nouveaux Philosophes, jenen öffentlich sehr präsenten Intellektuellen, die im Zuge des sogenannten Gulag-Schocks 1974 mit ihrer marxistisch-leninistischen, trotzkistischen oder maoistischen Vergangenheit gebrochen hatten. Auslöser der großen Debatte war damals die Veröffentlichung des Buchs Archipel Gulag von Alexander Solschenizyn über die Straf- und Todeslager in der Sowjetunion. Gestritten wurde über Bewertung und Einschätzung der kommunistischen Verbrechen, die von vielen Intellektuellen lange Zeit verharmlost oder verschwiegen worden waren. André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut und Pascal Bruckner gingen mit ihrer eigenen linken Vergangenheit und intellektuellen Verleugnungsstrategie hart ins Gericht und vertraten fortan in Debatten eine antitotalitäre Agenda. Die alten Lagergrenzen von rechts und links erodierten, und es entstand allmählich eine neue intellektuelle Landschaft. Ganz anders verhielt es sich damals in Deutschland, in der die Weichzeichnung des Kommunismus und ausgeprägte Opposition gegenüber einem als bürgerlich-konservativ verunglimpftem Antikommunismus bei Intellektuellen noch bis weit nach dem Mauerfall und den friedlichen Revolutionen in Europa virulent blieb. Der Schriftsteller Heinrich Böll stand in der deutschen Debatte, als er damals seinen Kollegen Solschenizyn gegen die Anwürfe verteidigte, ein reaktionärer Antikommunist zu sein, auf ziemlich einsamem Posten. Den Verharmlosern der sowjetischen Diktatur hielt er entgegen: „Kein Zweifel, im Archipel Gulag wird nicht etwa nur entstalinisiert, es wird auch entlenisiert, beiden Väterchen wird auf die Finger geklopft und ins Stammbuch geschaut.“ Solche neuen „Antitotalitären“ ernteten prompt den Vorwurf des Renegatentums, besonders von Intellektuellen auf der deutschen Rheinseite.
Der akademische Linke Pierre Bourdieu seinerseits attackierte die Nouveaux Philosophes nicht offen politisch. Er versuchte, sie zu delegitimieren, weil sie institutionell nicht eingebunden waren und keinen akademisch abgesicherten Status hatten – und dennoch über eine solch umwerfende Präsenz in den Medien verfügten. Der hoch angesehene Soziologe, selbst medial äußerst präsent, giftete als Staatsbeamter just gegen jene unabhängigen, „freischwebenden Intellektuellen“, die sich jenseits staatlicher Alimentierung und Förderung auf dem freien Markt des Denkens, Schreibens und Debattierens behaupten mussten. Für ihre Unabhängigkeit zahlten sie im kulturindustriellen Sektor natürlich ihren Preis, ständig unter dem Druck, Neues produzieren und ihre Bücher optimal bekannt machen und vertreiben zu müssen. Ihre vornehmlich gewählte Ausdrucksform des Essays ist wortwörtlich zu verstehen: Sie verfassten Versuche der Zeitdiagnose jenseits geschlossener philosophischer Systeme, soziologischer Schulen oder Lehrmeinungen und politisch-normative Einlassungen, die es nicht darauf anlegten, dem kulturellen Mainstream zu entsprechen. Natürlich waren auch sie nicht immer vor Irrtümern gefeit.
Trotz seiner Häme gegenüber diesen außeruniversitären Kollegen begrüßte Bourdieu die Uneinigkeit und Kontroversen zwischen Intellektuellen. Ihre Auseinandersetzung sei letzten Endes ein Kampf darum, was richtig ist, also ein Kampf um die Wahrheit. Doch im vernetzten Kultur-, Medien- und Wissenschaftsbetrieb geht es beileibe nicht nur um die hehren Werte der Aufklärung, sondern immer auch um Macht, Geltungsansprüche und den Kampf um Ressourcen.
Schon Julian Bendas 1927 erschienenes Buch La trahison des clercs entfachte eine lang währende Diskussion über die gesellschaftliche Rolle der Intellektuellen. Ihm ging es um die Verteidigung eines Berufsstandes, der sich nicht vonseiten der Politik oder von aktuellen Notwendigkeiten vereinnahmen lassen solle, sondern „im Namen ewiger Werte und nicht dem Gebot der Stunde gemäß“ urteile. Der mit dem Kommunismus kokettierende Philosoph Walter Benjamin hielt ihm damals in seiner Rezension des Buchs entgegen, Aufgabe des Intellektuellen sei es gerade nicht, über den Dingen zu stehen, sondern der Wirklichkeit möglichst nahe auf den Leib zu rücken.
Nur weil sie aufgrund ihrer Ausbildung fähig sind, nach Vernunft, Wahrheit und Erkenntnis zu streben, verfügen Intellektuelle nicht unbedingt über eine bessere Moral und sind nicht gefeit davor, zu irren oder sich blenden zu lassen. Sie sind aufgrund ihres Berufs oder ihrer Berufung also nicht per se die authentischen Vertreter universeller Prinzipen, wie Pierre Bourdieu gern insinuierte. Selbst wenn sich die Genese ihres Berufsstands den Prinzipien der Aufklärung und deren erfolgreicher sozialgeschichtlicher Durchsetzung verdankt. Viele von ihnen haben gerade im vergangenen Jahrhundert der totalitären Diktaturen gezeigt, wie sie sich für ethnisch-rassistische und Klasseninteressen zum Diener eines Regimes haben machen lassen oder zu Mitläufern wurden: Linksintellektuelle, welche die Sowjetunion feierten und die kommunistischen Lager und Verbrechen leugneten, schönredeten oder ignorierten; Rechtsintellektuelle, die von der konservativen Revolution, einer Reinheit der Rasse und der Weltherrschaft träumten und den Nationalsozialismus und Faschismus ideologisch bedienten, verteidigten und später versuchten kleinzureden.