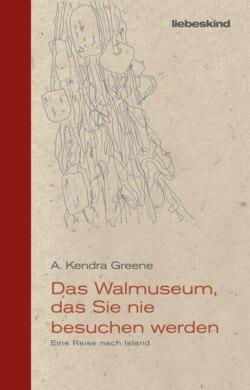Читать книгу Das Walmuseum, das Sie nie besuchen werden - A. Kendra Greene - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ANKUNFT
ОглавлениеUnter einem grauen Morgenhimmel holt mich Lilja vom Flughafenbus ab und fragt, während sie meine Tasche in ihr kleines silbernes Auto schwingt, ob ich ihre Nachricht bekommen habe, dass ich mir keine Sorgen wegen des Vulkans machen soll. »Das brauchst du nämlich nicht, er wird deine Reise nicht beeinträchtigen, so was passiert hier ständig.«
Der gesamte Transatlantikflug von Boston nach Reykjavík dauert weniger als fünf Stunden, also kaum genug Zeit, um ein Nickerchen zu machen, einen dritten Film anzufangen oder sich der korrekten Aussprache jedes unbekannten Buchstabens im isländischen Alphabet zu vergewissern – vor allem von »eth« und »thorn« –, doch offensichtlich reicht diese Zeit andererseits aus, um ein Flugzeug zu besteigen und einen halben Ozean zu überqueren, ohne die geringste Ahnung zu haben, dass man direkt auf einen plötzlichen Anstieg der seismischen Aktivität zusteuert.
Wobei einen das nicht überraschen dürfte. Die fünfundvierzig Minuten vom internationalen Flughafen zum Busterminal in der Innenstadt führen durch den Dunst alter Lavafelder und heißer Quellen, und daraus tauchen allmählich die ersten Häuser und Gebäude auf. Sie säumen das Meeresufer einer Insel, die zwei tektonische Platten überbrückt – einer Insel, die sich wegen ebendieser Platten und ihrem Hang, zu gleiten und ihr geschmolzenes Herz auszuschütten, aus dem Wasser erhoben hat.
Lilja sagt: »Mach dir keine Sorgen wegen des Vulkans« und beginnt im gleichen Atemzug, von möglichen Aschewolken und Gasmasken zu reden und von Hubschraubern, die Wanderer in den Bergen auflesen, weil es keinen besseren Weg gebe, um sie zu warnen, dass sie möglicherweise in Lebensgefahr schwebten.
Lilja ruft die Website des nationalen Wetterdienstes auf und zeigt mir, wie ich hin- und herschalten kann zwischen den Umrissen Islands mit der Regenvorhersage, der Nordlichtervorhersage und den Punkten und Sternen, die eine Reihe winziger Erdbeben abbilden, die jede Verschiebung und Erschütterung der letzten zweiundsiebzig Stunden dokumentieren. Meistens, so zeigt die Karte, erreichen die Beben nur eine Stärke von unter 3,0 auf der Richterskala. Ich bin an einer anderen Küste aufgewachsen, in Kalifornien, und die gesprenkelte Karte ruft eine Art Nostalgie in mir hervor, eine Sympathie für diese fast unmerklichen Ereignisse.
Ich solle immer auf der Hut sein, sagt sie. Ich solle die Karte ständig aktualisieren. Es spiele keine Rolle, dass sie winzig seien, es spiele keine Rolle, dass sie beinahe obskur seien. Ich solle beobachten, ob die Zahl der Beben zu- oder abnehme. Ich dürfe nicht vergessen, dass ihre Ausrichtung nicht zufällig und jedes von ihnen ein Zeichen sei. Ich solle sie mir genau ansehen: Dort, wo sie gehäuft aufträten, verliefen nämlich die Grenzen der Verwerfungen und Spalten, die ansonsten unsichtbar seien. Sie kennzeichneten jene Unterströmungen, die alles andere herausbildeten. Und diese Beben wiesen uns stets auf das hin, was uns noch bevorstehe.
Die Bergkämme hier bestehen aus schwarzem Felsen oder sind mit Lupinen bewachsen, vielleicht mit Schafen übersät, wenn nicht sogar mit Schnee bedeckt. Wo das Ufer breit genug ist, sammle ich Seeglas und Porzellanscherben, gehe an Federn und manchmal an Knochen vorbei. Ich bin, so könnte man es wohl ausdrücken, wegen der Grenzen dieses Ortes gekommen. Denn nicht nur hier, sondern überall passiert etwas an den Rändern.
Ich bin wegen der Grenzen des Begriffs »Museum« gekommen. Denn bei all den vielen Museen, für die ich gearbeitet habe, in denen ich als Volontärin tätig war oder in denen ich ein Praktikum gemacht habe, trotz all der Kontinente, auf denen ich Museen besuchte, habe ich nirgendwo sonst erlebt, dass die Grenzen zwischen privater Sammlung und öffentlichem Museum so durchlässig, so freizügig, so leicht zu überschreiten und so transparent sind, beinahe, als existierten sie nicht.
»Also nimm dir vielleicht besser nichts vor, bis wir wissen, ob die Lava das Gletschereis schmilzt und die Flut des Schmelzwassers die nördlichen oder die südlichen Straßen unpassierbar macht, oder, wer weiß – das haben wir alles schon erlebt –, sogar beides.«
Es heißt, wenn man fehlerhaft getauft worden sei, wenn das Weihwasser nicht die Augen benetzt habe, behalte man unter Umständen das Zweite Gesicht und könne die Elfen sehen, auch wenn sie sich einem nicht von selbst offenbarten. Hier spüre ich, dass an dieser alten Geschichte etwas Wahres dran sein könnte, dass mir ein Blick auf etwas Außergewöhnliches geschenkt wurde, verborgen, obwohl es die ganze Zeit da war, inmitten von allem anderen, was wir sehen oder wissen oder in unsere Taschen stecken oder in unseren Händen halten.
Irgendwann später, in der Stille eines Museumscafés, werde ich mit einer Familie aus meiner Heimat plaudern und erzählen, dass der hiesige Professor für Museumskunde in Island bei 330.000 Einwohnern 265 Museen und öffentliche Sammlungen zählt, was an und für sich schon erstaunlich ist – umso mehr, wenn man bedenkt, dass fast alle diese Institutionen in den letzten zwanzig Jahren gegründet wurden. Sie kommen einem vor wie Samen, die ewig schlummerten und dann endlich durch ein großes Feuer oder einen strengen Frost aufgebrochen wurden, um zu keimen und schließlich Wurzeln zu schlagen und zu blühen.
Erstaunlich, da stimmen mir meine Landsleute zu, auch wenn sie im Café des Museums sitzen bleiben, ihren Kaffee schlürfen und den Vorraum nicht verlassen, um sich die Ausstellungsstücke anzusehen. Draußen verdichtet sich der Nebel und zieht wieder ab, sammelt sich und verweht; die Welt hinter der Glaswand des Museums ist immer da, aber verschleiert, zerfließend, mal für die Sinne wahrnehmbar, mal nicht.
»Es muss nicht unbedingt eine Überschwemmung sein, er könnte auch Asche speien. Vielleicht wird die Ernte vernichtet, oder die Schafe werden vergiftet, vielleicht muss man durch einen Waschlappen atmen, und eine Hungersnot entfacht die Französische Revolution.«
Es sind uralte Kräfte. Das Magma und die Beben. Nahrungsknappheit und Entbehrungen. Die Art und Weise, wie wir die Teile dieser schmerzhaften, glorreichen physischen Welt lieben, aber auch die Art und Weise, wie wir sie wegen der Geschichten, die wir aus ihren Scherben formen, überleben. Wir lieben Felsen und Vögel, alte Boote und Messingringe. Aber hauptsächlich die Geschichten. Die Geschichten sind etwas Besonderes. Wir bewahren und sammeln nicht nur Gegenstände, häufen sie an und restaurieren sie. Wir stecken ebenfalls viel Hingabe in das Umwidmen, Erschaffen und Erfinden von Dingen, um diese Geschichten zu bewahren, ohne die wir nicht leben können. Wir lieben Zauber und Geheimnisse, Ungeheuer und Geister. Wir lieben die Frau an der Schwelle zur Verwandlung, die nach ihrem Seehundfell sucht, damit sie nach Hause zurückkehren und wieder das werden kann, was sie vorher war. Daran haben wir uns seit jeher orientiert. Das ist es, womit wir uns am Mast festzurren. Das sind alte Kräfte – unbezwingbare Kräfte, die die Welt neu formen.