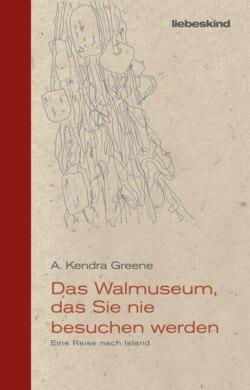Читать книгу Das Walmuseum, das Sie nie besuchen werden - A. Kendra Greene - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSEIT DEN ALTEN ZEITEN hat sich vieles verändert. Der Walfang ist erst seit Kurzem wieder legal – die Branche ist derart geschrumpft, dass heute alle verbliebenen Walfangschiffe im Besitz einer einzigen Familie sind –, aber auch wenn es erhältlich ist, so sind die Leute doch nicht mehr an den Verzehr von Walfleisch gewöhnt. Früher war es im Überfluss vorhanden. Die Walfänger verschenkten Stücke des Leviathans; man brauchte nur zur Walfangstation zu gehen und eine Tüte mitzubringen, in die man es hineinpacken konnte. Meistens waren es Plastik-Einkaufstüten. Aber wenn man ein paar Müllsäcke zusammenkramte, wenn man ein paar gute Freunde hatte, wenn man vorher anrief und der Wal, den sie gefangen hatten, die richtige Art von Wal war, wenn man seine eigene Axt mitbrachte, dann reservierten die Walfänger einem wohl auch einen Teil des Tieres, den sie nicht verwenden konnten. Und so konnte es passieren, dass man mit seiner Tochter den Penis des Wals abtrennte – oder besser: nur die Spitze, das Drittel, das aus dem Körper ragt, wenn sich im Tod die Muskeln entspannen und das Organ ins Gleichgewicht kommt – und das glitschige, schwere Ding auf den Rücksitz seines Autos hievte.
DER ERSTE ISLÄNDER, den ich kennenlernte, hieß Garðar. Garðar war groß und blond und arbeitete mit meiner Schwester zusammen in einem staatlichen Labor in Kalifornien. Er bot sich an, ihr beim Aufhängen der Schränke in ihrer neuen Küche zu helfen, und während wir auf dem Betonboden saßen und Einbaupläne entzifferten, gestand ich, dass ich rein gar nichts über Island wusste. Ich fragte Garðar, was ich seiner Meinung nach wissen sollte.
Im Nachhinein denke ich, er hätte mir erzählen können, dass die Insel den Polarkreis überspannt, dass sie eine Gesamtbevölkerung von 330.000 Menschen und die höchste Alphabetisierungsrate der Welt sowie eine eigene Regierungsbehörde hat, die nur dafür zuständig ist, Fremdwörter ins Isländische umzuwandeln (Handys sind nach einem archaischen Wort für ein junges Schaf benannt, weil ihr Summen an ein Blöken erinnert). Er hätte auch die Sängerin Björk oder die Band Sigur Rós nennen und es dabei belassen können. Er hätte auch seinen Namensvetter, den schwedischen Wikinger Garðarr Svavarsson, erwähnen können und dass Island eine Zeit lang sogar nach diesem Garðar benannt war. Doch er erzählte nichts über die Jahre, in denen Island Garðarshólmi war. Er erwähnte das alles nicht. Ohne weitere Einleitung berichtete er mir über Island nur eines: »Wir haben ein Penismuseum.«
»Wirklich?«, fragte ich.
»Ja. Das einzige auf der ganzen Welt.«
ICH LIEBE BERECHTIGTE SUPERLATIVE. Das Beste oder Erste oder Älteste ist schön und gut, aber die älteste durchgehend betriebene Eisdiele der Welt zum Beispiel, die größte Streichholzbriefsammlung Europas, das zweitälteste Museum westlich des Mississippi – wie viel charmanter sind diese Behauptungen durch ihre gemäßigte Prahlerei, ihre eigentümliche Besonderheit? Und dennoch entziehen sie sich einem irgendwie, trotz ihrer Präzision, und man weiß nicht, auf welcher Grundlage sie beruhen. Sollen sie uns glauben machen, dass ihnen eine Bescheidenheit zugrunde liegt, die um die Grenzen selbst der gewissenhaftesten Forschung weiß? Schließlich kann man schlechterdings nicht genau sagen, was alles in der Welt existiert, und gebietet es nicht die Ehre, nicht mehr zu behaupten, als man beweisen kann? Oder wissen die Urheber der Bezeichnungen ganz genau, dass sich die umfassendste Streichholzbriefsammlung der Welt in Uruguay befindet, und wollen es nur nicht verraten?
Im besten Fall klingen diese Titel wie Nischen, die so lange eingedampft und geschmälert werden, bis es keine mögliche Konkurrenz mehr gibt. Sieg durch Ausschluss! Ruhm durch Zermürbung! Und doch verkünden sie ihre Botschaft so triumphierend, als wäre es eine höchst begehrte Auszeichnung, der regionale, selbst ernannte Beinahe-Vizemeister zu sein.
Nach eigener Einschätzung ist das »Isländische Phallologische Museum wahrscheinlich das einzige Museum der Welt, das eine Sammlung von Phalli aller in einem bestimmten Land vorkommenden Arten von Säugetieren enthält«.
Falls irgendeine andere Institution um diese Ehre konkurriert, wird es schwer sein, ein kleines Inselland zu schlagen, dessen geografische Lage die Artenvielfalt erheblich einschränkt. Wenn der Sammelwahn tatsächlich nur auf die einheimischen Landsäugetiere beschränkt wäre, hätte Island nach dem Einfangen eines einzigen Polarfuchses aufhören können.
Doch warum sollte man sich nur auf Säugetiere beschränken, fragt man sich. Biologisch wäre das ganz und gar unlogisch. Fische sind, was Phalli angeht, eine durchaus lohnende Beute, wie das Isländische Phallologische Museum anhand zweier Exemplare von Seebarschen beweist. Es gibt Libellen mit Phallus. Und zwar besitzen nur drei Prozent der Vogelarten irgendeine Art von Phallus, aber man kann sie schwerlich vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass der Penis der Ente ein korkenzieherartiges Tentakelorgan ist, das sich zu einer Länge entfaltet, die der des gesamten Körpers der Ente entspricht.
Aber bleiben wir für den Augenblick bei den Säugetieren als erklärten Sammelobjekten. Es klingt recht überschaubar, dass es sich bei der Sammlung des Phallologischen Museums um eine Art Säugetierphallus-Arche-Noah handelt – alle Tiere wurden nacheinander hineingeführt –, doch tatsächlich gibt es gar keine offizielle Zählung der Säugetierarten in Island. An Land muss man entscheiden, welche der eingeführten Arten zählen und ob die Sammlung um jedes importierte exotische Tier erweitert wird. Zu Wasser muss man entscheiden, wo Island aufhört und der offene Ozean anfängt. Und selbst wenn man seine Grenzen gezogen hat: Der Ozean verändert sich.
Vor vierzig, fünfzig Jahren sah man keinen Blauwal weiter nördlich als bei der südisländischen Stadt Reykjavík. Dasselbe galt für den Buckelwal. Doch seitdem haben die sich verändernden Wassertemperaturen die Wale immer weiter nach Norden gelockt und sie dort immer präsenter gemacht, während der Glattwal und das Walross immer seltener gesichtet werden. Außerdem gibt es immer weniger Eis, auf dem Eisbären aus Grönland nahe genug herantreiben können, um den Rest des Weges zu schwimmen. Im Laufe der Geschichte kamen sie so oft, dass es offizielle Gesetze darüber gibt, wie mit ihnen umzugehen ist. Jedenfalls besitzt das Museum ein Eisbärenpenis-Exemplar: spät erworben, ein knochenloses Stück Fleisch, das das isländische Museum für Naturgeschichte nicht brauchte, als es seine Skelettmontage vorbereitete. Früher wurden sogar Belugawale vor der isländischen Küste gesichtet, aber inzwischen nicht mehr. Das Museum besitzt kein Penisexemplar von ihnen und wird wohl auch nie eines erhalten.
SIGURÐUR HJARTARSON WURDE 1941 geboren, damals, als die Isländer noch Bürger Dänemarks waren. In den 1950er-Jahren arbeitete er den Sommer über auf einem Hof im Norden, wo zu seinen täglichen Gebrauchsgegenständen unter anderem ein Ochsenziemer gehörte. Damals machte sich niemand Gedanken darüber, dass ein verschrumpelter, getrockneter Stierpenis als Peitsche benutzt wurde, doch 1974 weckte dieses Objekt durchaus Neugierde. Zu dieser Zeit war Sigurður Schulleiter an einem Gymnasium an der Südwestküste, wo er einen Ochsenziemer von den Eltern eines Schülers geschenkt bekam. Er sagt nicht, warum.
Sigurður hat einen Masterabschluss in lateinamerikanischer Geschichte. Ein Lehrbuch, das er geschrieben hat, wird bis heute noch in Islands zehnten Klassen verwendet, und in dem Sommer, als wir uns trafen, übersetzte er gerade ein Manuskript von 1806 über die Eroberung Mexikos. Er besichtigt mit Begeisterung Kirchen und Museen; wenn er in Spanien ist, besucht er stets die Goyas im Prado und ein Wandteppichmuseum mit Werkstatt in der Nähe des Bahnhofs. 1977 half er bei der Gründung der Friends of the Arctic Fox, einem Naturschutzverein, der bis heute aktiv ist, und er hat etwa fünfzig Artikel zu diesem Thema publiziert. Was ich damit nur sagen will: Ein Ochsenziemer ist nicht unbedingt das nächstliegende Geschenk für diesen Mann.
Doch ich glaube gerne, dass der Ochsenziemer eine gute Wahl wäre, wenn man einem Schulleiter eine Peitsche schenken wollte. Sowohl seine Verwendung als auch seine Herkunft suggerieren eine gewisse Aggression und eine angemessene Autorität, und doch ist er eigentlich nur auf dem Land von richtigem Nutzen, was die getrocknete alte Haut wiederum umso bedeutungsvoller macht. Das Geschenk wirkt ein wenig lächerlich, ein Hauch von Satire unter der Maske der Tradition. Und als solches ist es dennoch ein gutes Geschenk, denn wenn Sigurður mit irgendetwas ausgestattet ist, dann mit Sinn für Humor.
Was auch immer die Absicht des Geschenks war, es wirkte inspirierend. Nicht auf Sigurður – er legte es unbenutzt in ein Regal in seinem Büro. Doch einige Lehrer arbeiteten im Sommer auf einer nahe gelegenen Walfangstation, und sobald sie von dem Ochsenziemer erfuhren, fingen sie an, Walpenisse in Sigurðurs Büro zu schleppen. Was bedeutet, dass die anfängliche Erweiterung der Sammlung als Scherz begann. Man muss sich nur vorstellen, wie seltsam befriedigend es ist, einen riesigen Penis auf den Schreibtisch seines Chefs zu legen! Ja, es war ein sehr guter Scherz. Und dann, niemand weiß genau wann, ist mehr daraus geworden.
HERMES WAR, BEVOR er zum Gott der Reisenden wurde, ein Gott der Übergänge und Grenzen. Das würde mich nicht weiter beschäftigen, trotz der Erwärmung der Ozeane und der dadurch veränderten Migrationsbewegungen, wenn ich nicht eines Tages etwas über Alkibiades gelesen hätte. Dieser wurde in Abwesenheit von einem Gericht zum Tode verurteilt, weil man ihn des Hermenfrevels bezichtigte. Hermen, das muss ich erwähnen, sind keine Menschen, sondern etwa mannshohe Stelen aus Stein mit einer vierkantigen Basis, dem Kopf eines Gottes und, das ist das Besondere, männlichen Genitalien, die genau an der Stelle herausragen, wo sie sich befinden würden, wenn es sich um einen Körper und nicht um ein Stück Stein handelte. Irgendwie mag ich diese Hermen. Mir gefällt die Vorstellung, auch wenn sie sicher nicht stimmt, dass sie eine Art fehlendes Glied in der Evolution der Skulptur darstellen. Ich bilde mir ein, erst habe es Platten gegeben, dann Büsten, und dann, nachdem man die Sache mit dem Kopf gemeistert hatte, beschloss irgendjemand, das zweitwichtigste Teil hinzuzufügen. Später kamen die Beine und dann die Arme dazu, und ehe man sichs versah, hatte man – sowohl im National Mall-Park als auch in der Geschichte der repräsentativen Skulptur als solche – eine Bandbreite vom obeliskenförmigen Washington Monument am einen und dem üppig ausgestalteten Lincoln Memorial am anderen Ende.
Als ich Griechenland bereiste, begegneten mir die Hermen nicht mehr an Kreuzungen, wo sie früher als Kultbilder des bärtigen Wegegotts standen, sondern in Museen, wo ich sie in meiner jugendlichen Arroganz als irgendwie kindisch abtat oder als Werke von Künstlern, die zu faul waren, ihre Arbeit zu beenden. Die Hermen sind natürlich unterschiedlich gestaltet – es stellen nicht einmal alle den Gott Hermes dar –, aber ich begegnete ihrem lasziven Grinsen und den übertriebenen Genitalien so häufig, dass ich sie in meiner humorlosen Wissenschaftlichkeit und Prüderie nicht ernst nehmen konnte.
Und doch geschah es in einem griechischen Museum, dass ich zum ersten Mal wirklich über Penisse nachdachte. Es war im Nationalmuseum in Athen, wo unser Altphilologie-Professor Jörgen Ernstson, der an diesem strahlenden Märztag ein mit winzigen Elefanten und Palmen bedrucktes Halstuch trug, beiläufig darauf hinwies, dass die männlichen Genitalien an den Statuen des klassischen Griechenlands im Verhältnis zum Rest der Figur unproportional seien. Genauer gesagt: zu klein.
Jörgen Ernstson war gerade dabei, uns etwas über die Schwierigkeiten bei der Identifizierung zu erklären; niemand könne wissen, ob die Bronze vor uns Zeus oder Poseidon sei, weil das, was der bärtige Kerl in seiner rechten Hand gehalten hatte, verloren gegangen war. Und ohne den Blitz/Dreizack/Weißgottwas konnte man im Grunde nichts weiter sagen, als dass die Arme zu lang für den Körper waren. Das Gespräch wäre womöglich ganz anders verlaufen, wenn jemand die leeren Augenhöhlen angesprochen hätte, aber der Sprecher der Gruppe junger Männer in unserer Kohorte fragte stattdessen nach dem Penis.
Wir können nur vermuten, dass die Arme wegen der Perspektive verlängert sind, um einer Illusion der Verkürzung entgegenzuwirken, und dass die Statue nicht aufgestellt wurde, um eine besonders große Spannweite zu betonen. Vielmehr wurde sie vermutlich auf gleicher Höhe wie die Betrachter platziert, die dadurch in der Flugbahn dessen standen, was der Arm der Statue hochhielt, als ob es geworfen werden sollte. Wir wissen nicht sicher, warum die Arme so lang sind, aber für die Penisgröße gibt es eine eindeutige Erklärung. Der Penis als dargestelltes Objekt wurde von den Griechen zwar nicht unbedingt als vulgär, aber doch als etwas Niederes angesehen – eine permanente Erinnerung an das Körperliche, das Fleischliche, das schwer zu Kontrollierende. Er war ein animalisches Attribut. Der ideale Mensch hingegen war ein vernünftiges Wesen, fähig, das Tier in sich zu unterwerfen, und von daher die Gestaltung der Statuen: große Männer ohne große Ausstattung.
Die Männer in unserer Gruppe kicherten. Sie hatten sich tatsächlich schon eine Weile gewundert und waren froh um eine Erklärung. Für mich dagegen war es ein Aha-Erlebnis auf einer ganz anderen Ebene. Ich hatte es nicht bemerkt. Normalerweise hätte ich in einem Saal mit nackten Statuen einen Weg gefunden, meinen Blick beiläufig, aber bewusst zu lenken, sodass weder mein Hinsehen noch mein Wegsehen bemerkt worden wäre. Doch diese neue Information veränderte etwas: Ich hatte das Gefühl, hinschauen zu dürfen. Oder besser: nicht nur hinschauen, sondern mustern zu dürfen, ja, zu müssen. Schon der Unterschied in der Ausführung der Bauchnabel bei den Figuren im Zeustempel in Olympia zeigt, dass die Giebelskulpturen an der Vorderseite des Tempels von einer anderen Werkstatt gefertigt wurden als die von der Rückseite abgewandten. Ich lernte daraus, dass Einzelheiten wichtig sein können und man stets die Augen offen halten muss. Es hängt tatsächlich viel davon ab, ob ein Nabel nach innen oder außen gewölbt ist. Und auf die Penisgröße, so stellte ich erstaunt fest, kommt es eben doch an.
DER ALKOHOL WAR ein wichtiger Katalysator. Man kann keinen Walpenis geschenkt bekommen, da sind wir uns wohl einig, ohne dass die Freunde davon erfahren. Nicht in einer Stadt mit fünftausend Einwohnern. Nicht, wenn die Freunde auch Trinkkumpane sind. Und es ist wahrscheinlich auch egal, dass die Freunde Akademiker und Parlamentsmitglieder sind – irgendjemand reißt garantiert einen Witz, ja, man kann sich die Witze immer schwerer verkneifen. Die Freunde werden sie ständig einstreuen. Das ist ganz normal. Man kann nichts dagegen tun. Die Scherze werden virulent. Und egal, für wie gelehrt oder distinguiert man sich hält, man wird feststellen, dass jedes Mal die Stimmung steigt, wenn man über ein Penismuseum redet. Irgendwann wird man – zwangsläufig – seinen Reizen erliegen.
Und so ging es auch in der Kneipe in Akranes. Ehe man sichs versah, scherzten Sigurður und seine Freunde über die Feinheiten der Organisation einer imaginären Einrichtung. Sie erfanden ein isländisches Akronym für das Phallologische Museum: RIS/HIS, ein Wortspiel, das übersetzt so viel bedeutet wie »sich glücklich erheben«. Das englische Wort phallological ist Sigurðurs eigene Erfindung, aber einem Lateinlehrer seiner Schule schreibt er die Bezeichnung Phalloteca für die hypothetische Institution zu. Es herrschte allgemeine Großzügigkeit und jeder Beitrag wurde mit Ehrentiteln der nicht existierenden Institution belohnt, bis jeder von ihnen zumindest zu einem ordentlichen Mitglied in gutem Ansehen erklärt wurde.
Natürlich wurde nichts davon ernsthaft als Möglichkeit in Betracht gezogen. Doch die Tatsache, dass es überhaupt eine Möglichkeit gab, egal wie zweifelhaft sie war, veränderte manches. Das Isländische Phallologische Museum rückte, wenn auch nur vage, in den Bereich des Realisierbaren. Es hatte die besondere Kraft von einem Ding mit Namen bekommen. Die Sammlung mag mit einer Peitsche begonnen haben, aber das Museum, so kann man wohl mit Sicherheit behaupten, wurde an einer Bar aus der Taufe gehoben.
Die Freunde waren nicht gerade begnadete Propheten. Keiner an der Bar sagte: »Wäre es nicht toll, wenn deine Tochter und deine Schwiegertochter in ihrem Kinderkleiderladen ein bisschen Platz für dein Museum hätten und du beim Benoten von Arbeiten Penis-Souvenirs schnitzen könntest?« Doch genau so kam es. Die Frauen hatten Probleme, die Miete zu bezahlen, also boten sie Sigurður die Hälfte des etwa 350 Quadratmeter großen Ladenlokals in einer hübschen kleinen Gasse neben der Haupteinkaufsstraße von Reykjavík an. Sigurður sammelte inzwischen seit über zwanzig Jahren und hatte männliche Fortpflanzungsorgane von vierunddreißig der sechsunddreißig Säugetierarten Islands zu Hause liegen. Warum also nicht? Er zog mit zweiundsechzig Exemplaren in seine Hälfte des Ladens, und am 23. August 1997 öffnete das Isländische Phallologische Museum seine Pforten. Es war Sigurðurs sechsundfünfzigster Geburtstag.
DER ERSTE ARTIKEL über die Sammlung erschien siebzehn Jahre, bevor es ein Museum zu besuchen gab. Der ursprüngliche Schwerpunkt der Sammlung waren Walpenisse, und im Jahr 1980 konnte bereits über dreizehn Exemplare berichtet werden. Eine Reykjavíker Zeitung brachte folgende Schlagzeile: 30 KG WALPENIS IN EINER PLASTIKTÜTE GELIEFERT.
Als ich Sigurður frage, wie aus einer Sammlung ein Museum wird, zuckt er mit den Schultern. Die gleiche Reaktion ernte ich bei dem pensionierten Professor vom Vulkanmuseum draußen auf der Snæfellsnes-Halbinsel, ja, im Grunde in jedem Museum, egal wo in diesem Land. Tja, wer weiß?, soll das heißen. Die Lokalzeitung findet etwas über dein Spezialgebiet heraus und schreibt darüber, die Leute fragen, ob sie sich deine Schätze mal ansehen dürften, sie vereinbaren Besuchstermine, und so reift die Idee, nimmt Gestalt an. Mit jeder Anfrage wird die private Sammlung ein bisschen öffentlicher. Und dann, eines Tages, geben dir Fremde Geld.
In Sigurðurs Fall ruft vielleicht ein Mitglied eines örtlichen Frauenvereins an, das einen gemeinsamen Ausflug zu ihm arrangieren will, oder ein Freund, der Besucher aus dem Ausland beherbergt, möchte vorbeikommen. In Island wird ein Junggesellinnenabschied als »Gänseparty« bezeichnet, und auch die Gänsepartys begannen, sich zu melden.
Vielleicht bedeutet es nichts (ich bin mir fast sicher, dass es so ist), aber ich möchte anmerken, dass sämtliche Reden zur Eröffnung des Museums von Frauen gehalten wurden. Die Männer – all die Schriftsteller und Parlamentarier, die linksgerichteten, biertrinkenden Männer, die jahrelang über das Museum geredet und seine Planung vorangetrieben hatten – schwiegen. Sie standen am Rande und klatschten. Es war, als gäbe es zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu sagen. Ihre Worte hatten bereits ihr Ziel erreicht, ihnen ihren Platz zugewiesen, und vielleicht war das genug, um sie sprachlos zu machen.
Nur einer von ihnen, ein Musiker, hatte etwas zu bieten: eine Originalkomposition, die er später am Abend vortrug, als sich alles beruhigt hatte, die Reden vorbei waren und die Gespräche sich vielleicht wieder weniger ernsten Themen zuwandten.
DAS ISLÄNDISCHE PHALLOLOGISCHE Museum ist kleiner, als man denkt. Die Sammlung von 212 Exemplaren hiesiger Tiere passt in einen Raum. Die vierundsechzig Exemplare der ausländischen und der volkstümlichen Sammlungen teilen sich eine übergroße Nische. Und trotzdem ist es ein wenig überwältigend. Das Erste, was ich im Isländischen Phallologischen Museum tue, nachdem ich die Schwelle überschritten habe, ist innehalten, um mich zu sammeln, und dann gehe ich aufs Klo.
Selbst für die 60 Prozent der Besucher, die keinen Phallus benutzen, um sich zu erleichtern, wirkt das Wasserklosett wie eine natürliche Einführung in das Thema – und die Architektur des Museums legt diese Option nahe. Der Haupteingang öffnet sich zu einem Treppenabsatz, einem kleinen Foyer, das zwei Wege zum Weitergehen bietet. Eine Treppe nach oben links führt zu den Museumsgalerien; eine Treppe nach unten rechts (das klingt fast freudianisch) bringt einen zu einem verschlossenen Lagerraum und dem WC.
Das ist keine Absicht. Der ursprüngliche Entwurf für das Museum sah laut einer Karikatur in den Archiven einen langen Galerie-Korridor vor, der am Ende in zwei kreisförmige Räume mündete, von denen einer einen Souvenirladen und einer ein Café beherbergen sollte – eine Konstruktion nicht unähnlich dem aktuellen Design des internationalen Flughafens von Island, dessen Luftaufnahmen nach seiner Eröffnung viel kommentiert wurden. Nein, dass das Museum in dem eigentümlichen Gebäude in der Héðinsbraut 3a untergebracht ist, hat nur mit der örtlichen Bank zu tun, die dem Museum den Standort für kleines Geld anbot, froh, dass jemand in das hundert Jahre alte Haus einzog und die Zugluft eindämmte.
Die kleinen Schilder für die Herren- und die Damentoilette sind nicht einheitlich. Das der Männer besteht aus einer Holzschindel, die mit einem nackten Jungen bemalt ist, der in eine Schüssel pinkelt. Die Ausführung ist ein wenig grob, die Bedeutung jedoch unverkennbar. Die Damentoilette hingegen ist diskreter, geheimnisvoller, gekennzeichnet durch ein Porzellanoval, das eine viktorianische Dame zeigt, vollständig bekleidet, vom bodenlangen Kleid und dem hohen Rüschenkragen am Hals bis zu den behandschuhten Händen. Im Gegensatz zu dem nackten Jungen gibt sie keinen Hinweis auf den Zweck des Raumes, sondern deutet nur schüchtern an, dass man hinter dieser Tür vielleicht – wer weiß? – einen Spaziergang auf dem Land machen oder seine Stiefel neu schnüren könnte, ohne jemandem schamlos einen Knöchel zu zeigen.
Wenn man Sigurður fragt: Warum keine Vaginas, warum nicht generell ein Museum für Genitalien?, antwortet er einem mit dem Augenzwinkern eines Mannes, der seit etwa fünfzig Jahren verheiratet ist: »Frauen sind in jeder Hinsicht komplizierter als Männer.« Er meint das nicht spitzfindig. Na ja, vielleicht doch, aber es gibt auch ganz praktische Gründe. Es ist schon eine technische Herausforderung, das betont Konvexe zu zeigen, und was ein Museum zeigen kann, hat viel mit dem zu tun, was es bewahren kann. Dieses Museum ist, möglicherweise in erster Linie, eine Studie über Konservierung. Und die besteht in diesem Fall aus einer Reihe von Experimenten.
Die ersten beiden Walpenisse, von einem Finnwal und einem Seiwal, wurden erst mit Silikon gefüllt und dann mit Salz, um das Fett wegzuätzen. Sigurður räumt ein: »Das hätte ich nicht tun sollen.« Aber irgendetwas musste natürlich geschehen. Die Uhr tickte. Der Kurator traf also eine Entscheidung, und zwar schnell, und gerechterweise muss gesagt werden, dass das Ergebnis vierzig Jahre überdauert hat, auch wenn die Haut des Seiwals jetzt auf der linken Seite in einem mäandernden Kringel aufgerissen ist, auseinandergezogen wie die Ufer eines trägen Flusses.
Ein weiterer Seiwalphallus wurde auf eine andere Art konserviert. Das Exemplar ist in der Mitte gebogen und zusammengeklappt, damit er in ein Einmachglas passt, das zwar vom Volumen, aber nicht von der Länge her genügte. Auswahlmöglichkeiten gibt es tatsächlich viele: Während der Penis eines Zwergwals ausgehöhlt, gesalzen und getrocknet auf einer Holzplatte platziert wurde, blieb ein anderer intakt, komplett mit Retraktor-Muskeln und Beckenknochen, und ruht in einem eigenen Aquarium wie ein abnormaler Nautilus, die Glasplatte darüber voller trüber Kondensationstropfen, das innere Gewebe fiedrig austretend wie fransiger Stoff.
Bei jeder Art der Konservierung leidet das Exponat in gewisser Weise und stellt keinen lebensechten Zustand dar. Sich auflösendes Gewebe trübt das Formalin in Form von Flocken und flauschigen Blüten. Die Haut eines Pottwalphallus ist geschrumpft, sodass der Holzkern hervorschaut; eine dünne, schwarz gesprenkelte Dermis, der Rest ist zu Wildleder geworden. Ein sechzig Pfund schwerer Blauwalpenis, der einst kaum auf den Rücksitz eines Autos passte, ist nun zottelig und hat sich auf ein Drittel seiner Größe verkleinert. Das Formalin im Behälter eines anderen Blauwalexemplars wurde dreimal gewechselt, um das Blut und das Öl zu entfernen, zuletzt vor drei Jahren, doch seitdem ist erneut so viel Öl aus dem Organ ausgetreten, dass es eine fingerdicke Fettschicht bildet, die wie eine Bernsteinplatte vierzig Zentimeter unter dem gläsernen Deckel schwimmt.
Formalin wirkt, weil es tötet. Es ist furchtbar giftig. Lässt man eine Flasche mit Formaldehyd fallen, mit der man gerade hantiert, bleiben einem fünf, vielleicht sechs Sekunden, um aus dem Raum, aus dem Gebäude zu kommen. Man verwendet es grundsätzlich verdünnt. Schon eine 3,5-prozentige Formalinlösung reicht aus, um eine Probe für immer zu konservieren; sie tötet alle Bakterien und Pilze ab, die sonst das Gewebe zersetzen könnten. Sigurður musste in den 1970er-Jahren eine Genehmigung für das Zeug einholen, aber seitdem hat ihn keine Behörde mehr kontrolliert.
Es dauert zwei bis drei Tage, bis das Formalin ein Exemplar versteift hat. Hoffentlich hat man es richtig positioniert, und hoffentlich hat man es warm bekommen, damit es ganz ausbluten konnte. Nachdem das Formalin seine Arbeit getan hat, kann das Exponat in Alkohol gelagert werden. Alkohol ist zwar viel sicherer, aber auch teurer als Formalin, von daher macht sich nicht jeder diese Mühe.
Sigurður sammelt übrigens auch noch andere Dinge: Bücher, Musik, Käfer sowie präkolumbianische und indigene südamerikanische Kunst. Seine vier Kinder und deren Freunde interessierten sich früher am meisten für die Käfersammlung, obwohl sich im Schuppen die Phallus-Exemplare häuften. Ein Jahr lang reiste die Familie durch Mexiko, besuchte Museen und Bibliotheken und alles, was ihr Interesse weckte. Und nur mit ein wenig Baumwolle, die in Formaldehyd getupft wurde, bändigten und sammelten sie nach Herzenslust Spinnen und mehr Insekten, als sie benennen konnten.
Insekten – das weiß jeder, der hin und wieder in den Ecken abstaubt – trocknen ganz hervorragend. Sie konservieren sich praktisch von selbst. Ein Hoch auf das trostlose Exoskelett für die simple Illusion einer dauerhaften Form! Wir neigen das Haupt voller Mitleid vor jenen Kuratoren, die sich endlos abmühen, ein Pfund Fleisch zu konservieren.
DAS ERSTE, WAS ICH SEHE, als ich das Museum betrete, ist ein halb nackter Mann. Nicht etwa als Fotografie, Gemälde oder als Skulptur, sondern da steht ein richtiger Mann mit roten Haaren und nacktem Oberkörper. Ein durchtrainiertes Exemplar, Anfang zwanzig, und als ich die Treppe hinaufsteige, erblicke ich einen zweiten Mann in exakt demselben Zustand der Entkleidung.
»Medium«, verkünden sie dem Kurator. Der Kurator scheint nichts Ungewöhnliches an diesem Auftritt zu finden, sagt nichts und geht in ein Hinterzimmer. Als er zurückkommt, bezahlen die beiden hemdlosen Schotten zwei T-Shirts, eines mit dem IPM-Logo und das andere mit dem Namen des Museums in sieben verschiedenen Sprachen.
Der Kurator deponiert ihre Kronen in einer hölzernen Geldkassette, die aus guter isländischer Birke geschnitzt ist und einen Phallus von der Größe einer Brotdose darstellt. Da ich gerade unbeschäftigt bin, bitten sie mich, sie zu fotografieren. Der Rotschopf zeigt mir, wo ich mich hinstellen soll, damit sie vom Killerwal- und dem Pottwalexemplar eingerahmt werden. Als die beiden Männer ihre Hosen runterlassen, drücke ich den Auslöser.
Der Rothaarige, so stellt sich heraus, ist Zoologe und sein Freund Biologe, und sie brauchen dieses Foto für ihre Schwimmmannschaft. Sie erzählen mir, dass es bei ihnen Tradition ist, im Urlaub in der Mannschaftsbadehose vor Denkmälern und Sehenswürdigkeiten zu posieren. »Den Pyramiden von Gizeh, den Mayatempeln in Mexiko, dem Parthenon …«
»Einer wurde letztes Jahr vor dem Weißen Haus verhaftet«, sagt der Schotte mit einer Mischung aus Neid und Stolz. »Wir haben gehofft, dass wir hier rausgeworfen werden, damit wir erzählen können: ›Wir wurden aus dem Penismuseum rausgeschmissen‹, aber dieser Typ«, sagt er und nickt dem Kurator zu, »ist einfach zu nett!«
Sigurður Hjartarson ist eigentlich eher für seine schroffe Art bekannt als für seine Schlagfertigkeit, für seine kleidsamen Hosenträger oder die Totenköpfe in seinem Arbeitszimmer zu Hause. Doch vielleicht ist er nach 131 Artikeln und einem Dokumentarfilm über sein Museum einfach nur die immer gleichen Fragen leid. Siebenundzwanzig Länder auf mindestens vier Kontinenten haben Artikel über das Isländische Phallologische Museum veröffentlicht. Diejenigen in Sprachen, die ich lesen kann, charakterisieren es wechselweise als seltsam, verrückt, kauzig, infam, einzigartig und sadistisch. Meist klingt der Tenor schon im Titel an, und vermutlich sollte ich mich nicht daran stören, aber während ich durch die Archive des Museums blättere – neun Sammelbände in einem Bücherregal, in dem »Wale, Delfine und Schweinswale« neben »Sexualia: von der Vorgeschichte bis zum Cyberspace« stehen –, regt es mich allmählich auf und ärgert mich, wie selten offenbar jemand bemerkt, was für ein ansprechendes kleines Museum das hier ist. Es ist kurios, das stimmt, aber auch einnehmend exotisch, gemütlich vertraut, mit Stühlen zum Ausruhen und Erklärungsbroschüren, und es ist klugerweise auf die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen ausgelegt. Und, seien wir ehrlich, so seltsam ist es eigentlich gar nicht.
Aus einer bestimmten Perspektive ist es geradezu traditionell. Denn wie viele Museen gäbe es ohne individuelle Sammler oder Amateur-Naturforscher? Beide sind grundlegende und allgegenwärtige Säulen der Museumsgeschichte. Und überhaupt ist das Ungewöhnliche an sich doch eine Museumstradition. Willst du einen menschlichen Backenzahn sehen, der wie ein knöcherner Kamm im Schädel eines Hahns steckt? Du willst eine hermaphroditische Riesenmotte bestaunen, bei der ein Flügel Größe und Muster des Männchens und der andere des Weibchens hat? Du willst einen Edelstein in einer Farbe betrachten, von der du nicht wusstest, dass sie existiert? Ein Mineral, das sich ganz von allein aufgrund seiner Zusammensetzung zu einem perfekten Würfel geformt hat? Einen lebendigen Baum, der so gezogen und gestutzt wurde, dass im Inneren ein Raum entstanden ist, den man betreten kann? Eine Nachricht aus der Feder von Elvis Presley an Richard Nixon auf Airline-Briefpapier? Alte Valentinskarten mit rassistischen Pointen? Das Netz, das eine Spinne im Weltraum gesponnen hat? Jenen Löffel, den die Insassin eines Sanatoriums verschluckt hat, weil eine Operation besser als ihr sonstiges Leben war? Du willst überrascht werden? Dann geh in ein Museum.
DAS MUSEUM WIRD ZUM TEIL von einer Reihe von Hodensack-Hautlampen beleuchtet. Wir stehen direkt unter ihnen, als Sigurður nach oben zeigt. Er erklärt, dass es eine Weile gedauert hat, bis er die richtige runde Form gefunden hatte, um die Haut beim Trocknen zu dehnen. Er deutet auf einen seiner frühen Versuche, und als ich in ihren Schein hinaufschaue, sehe ich Geometrie. Ich frage mich, wie klein man einen Fußball machen kann, als er wissen will, ob ich das Muster erkenne. Die Haut ist dichter, wo sie eingedrückt ist. Das Licht leuchtet dunkler an diesen Falten, und es dämmert mir, dass die Lampenhaut über einen Handball gespannt wurde, um sie zu dehnen, und dass sie das Muster des Balls angenommen hat.
Überall auf der Welt gibt es Dinge wie Penisschreine, Penisskulpturen und Penisfestivals. Es gibt das chinesische Museum für Sexualkultur sechzig Meilen nordwestlich von Shanghai, das Musée de l’Érotisme in Paris und dazu noch ein Dutzend andere in Amsterdam, New York, Tokio und weiß Gott wo. Aber dies ist genauso wenig ein Museum über Sex wie über das Urinieren. Es ist kein Museum der Funktion, sondern der Form, und oft ist nicht einmal der komplette Apparat intakt, sondern nur das, was man abschneiden, was man aufbewahren kann.
Vielleicht nähern wir uns damit dem Grund dafür, warum es so wenige Museen gibt, die auf einzelne anatomische Teile spezialisiert sind. Es gibt die Nasenakademie im Museum für studentisches Leben an der schwedischen Universität Lund. In einem Krankenhaus in Dallas ist die private Sammlung eines Chirurgen mit Bronzeabgüssen von Promi-Händen ausgestellt. Wenn man sich lange genug im Phallologischen Museum aufhält, wird irgendjemand die Frau erwähnen, die in Europa ein Vagina-Museum plant, doch es soll ein Museum für Vagina-Kunst werden, nicht für vaginale Präparate. Oder jemand fragt den Kurator: »Wissen Sie, dass Sie einen Kollegen in den Niederlanden haben?« Es ist ein Hodensammler, wie sich herausstellt. Nur von Tieren, und im Gegensatz zum IPS ist seine Kollektion unbedeutend, ja nicht einmal ein Museum.
Gerade als ich beginne, mich zu fragen, wann genau die vergleichende Anatomie aus der allgemeinen Vorstellungswelt verschwunden ist – weshalb wir diese Wissenschaft vergessen haben, die so alt ist wie die Antike, ihre Beiträge zur Evolutionsbiologie, zur Phylogenese und zur vergleichenden Genomik, das Lebenswerk von Cuvier und Huxley, die Grundlage für Darwin, wie Edward Tyson feststellte, dass ein Schweinswal und Wale allgemein Säugetiere sind, und wie das der Welt die Augen öffnete –, ist das Gespräch bereits zur Geografie übergegangen. Ob ich wüsste, dass im finnischen Tampere traditionell penisförmige Pralinen hergestellt würden?
»Man schenkt sie den Damen.«
Diese Information erhalte ich von einem Bewohner besagter finnischer Stadt, einem Mann, der gerade seine beiden Söhne fotografiert hat. Das Fotografieren ist im Museum erlaubt. Die Besucher dürfen blitzen, so viel sie wollen. Der Finne hat die Jungen, erst den größeren, dann den kleineren, neben das Exemplar A-2-h gestellt: den Phallus eines erwachsenen Pottwals, der im Jahr 2000 lebend in Hrútafjörđur gestrandet ist. Der Wal war bei seinem Tod 15,8 Meter lang und starb an einem Darmverschluss. Nur die Spitze des Penis wurde abgenommen, doch mit 170 Zentimetern und siebzig Kilogramm ist sie ein beliebter Hintergrund für Porträts, zumal sie auch ein wenig größer ist als die meisten Menschen, die sich mit ihr fotografieren lassen. Wäre sie aus Messing, würde die Spitze sicherlich hell glänzen und ein Band um ihre Rückseite verlaufen, dort, wo ein grinsender Besucher nach dem anderen einen Arm um sie legt wie ein alter Schulkamerad. Die Besucher benehmen sich hier so wohlerzogen wie in jedem anderen Museum auch, aber mir fällt auf, dass die Frauen, ja, besonders die Frauen, Gegenstände berühren. Die Männer, so beobachte ich, machen lieber Fotos.
Der Finne hinterlässt eine Karte am Schreibtisch des Kurators und sagt, er solle den Chocolatier anrufen, vielleicht würde er eine Form spenden. Er sammelt seine Jungs und seine Kameraausrüstung ein und geht zur Tür. Im Hinausgehen sagt er, als ob das jemanden interessieren würde: »Sie machen sie auch aus weißer Schokolade.«
ES GIBT ZAHLREICHE GLÄSER, und sie sind mit allen Arten von Deckeln verschlossen: Marmeladen- und Senf- und Essiggurkengläser, ausgewaschen und mit Proben gefüllt, die Metalldeckel anschließend wieder aufgeschraubt und zugeklebt. Es gibt Einmachgläser, die mit orangefarbenen Gummiringen luftdicht verschlossen wurden. Ohne die Etiketten würde ich glauben, dass eine Sammlung von Meeresschnecken und Knollen unter die Penisse gemischt wurde, so viele der Formen sind mir eher als Wasserfauna und -flora vertraut.
Capra hircus, die Ziegenexemplare, sind auffällig behaart. Sie sehen selbst aus wie Tiere, wie kleine Opossums, die sich zusammengerollt haben und schlafen. Der getrocknete Phallus eines alten Ebers, der auf einen Stein montiert ist, gleicht einer knospenden Wüstenblume. Der Penisknochen des Stinktiers hat den Schwung und die Lappen einer Taglilie, während die Penisknochen junger grönländischer Robben so dünn und hellbraun wie Streichhölzer sind.
Vielleicht weil er in einem Glasgefäß mit Metalldeckel untergebracht ist, das identisch ist mit dem Set, in dem der verfaulte Phallus eines Grindwals mit langen Flossen aufbewahrt wird, nehme ich an, dass ein Narwalstoßzahn nur ein weiteres Baculum ist, bis ich das Etikett genauer lese und erkenne, dass der Elfenbeinkegel kein Penisknochen, sondern ein Zahn ist. Sicher, es ist ein Zahn, der höchstwahrscheinlich von einem Männchen stammt – obwohl manchmal auch den Weibchen welche wachsen –, aber warum ist er hier?
Zu diesem Rätsel kommt noch eine andere Enttäuschung hinzu. Wer käme bei den vier gezeigten Katzen-Penisknochen jemals auf die Idee, dass der fleischige Phallus, der den Knochen umgibt, mit Widerhaken versehen ist? Wenn wir schon über Penisse reden, ist das dann nicht eine Sache, die man wissen sollte?
DAS WICHTIGSTE IST, die Nachrichten zu hören. Es kommt in den Nachrichten, wenn Wale stranden und Eisbären anlanden, und dann muss man ein paar Telefonate führen. Aber es funktioniert auch in umgekehrter Richtung: Die Leute rufen das Museum an, und dann kommt das Museum in die Nachrichten. »Wir haben ein Walross!«, sagt der Anrufer, oder das Boot hat gerade etwas hereingebracht. Ein Bauer aus der Nachbarschaft verliert seinen preisgekrönten Hengst und bittet, eine Spende in memoriam anzunehmen.
Niemand bezeichnet es als Zusammenarbeit, aber die Sammlung war und ist abhängig von guten Kontakten, einem Netz von Beziehungen. Sigurður hätte gerne ein besseres Eisbärenexemplar, aber, wie er sagt, »Grönländer sind noch schlimmer als Isländer – sie antworten nie auf einen Brief«.
Am Ende ergibt sich das meiste durch Zufall, durch Schicksal. Einmal war eine Gruppe von Isländern in Südafrika, wo ein Schleckermäulchen von Elefant zur Plage für die Zuckerindustrie geworden war. Wenn ein Elefant Gefallen am Zuckerrohr findet, gibt es nichts, was ihn davon abhält, immer wieder die grün-roten Felder zu zertrampeln und sich satt zu fressen. Wenn du der Elefant bist, ist das das Nirwana. Wenn du das Feld besitzt, tötest du den Elefanten. Nachdem dieser spezielle Elefant erschossen worden war, schnitten ein paar einheimische Jungs den Penis des toten Dickhäuters ab und kickten ihn herum wie einen Fußball, bis die Isländer eingriffen. Wir können etwas Besseres damit anfangen, sagten sie. Wir haben eine Idee. Die Ad-hoc-Fußballer verzichteten auf ihre Trophäe, und die Isländer machten ein paar Anrufe. Der Kurator stellte sechstausend Kronen für den Präparator zur Verfügung und zahlte das Sechsfache für den Transport des afrikanischen Exemplars in den Nordatlantik. Island hat strenge Gesetze für den Import von Fleisch, aber Knochen und konservierte Einzelstücke kommen problemlos durch den Zoll.
In gewisser Weise sind die Exemplare selbst nicht halb so bemerkenswert wie die Tatsache, dass sie überhaupt gesammelt werden können. Man muss sich nur Folgendes vorstellen: Man kann bei einer Walfangstation vorbeischauen oder jemanden anrufen, über den man in der Zeitung gelesen hat, dann kommt man mit einer scharfen Klinge und einem Behälter an und geht mit einem Ausstellungsstück nach Hause. Leute aus aller Welt rufen an. Zum Beispiel ein Mann, der seinen Schafbock liebte – er hatte ihm mehr als zweihundert Schafe geschenkt. Als er starb, rief er den Kurator an und fragte: »Wollen Sie sein Exemplar?«
Kein Tier wurde jemals für das Museum getötet. Aber wenn man einen Jäger oder einen Fallensteller kennt oder die Mannschaft, die geschickt wird, um einen streunenden Eisbären zu erlegen, was kann es schaden, nach etwas zu fragen, das sie sowieso nicht brauchen? Wer sollte schon so ein kleines Stück Nerz vermissen?
ALS SIGURĐUR 2004 aufhörte zu unterrichten, zog er in die nördliche Küstenstadt Húsavík und nahm das Museum mit. Auf Postkarten der ursprünglichen Museumsräume in Reykjavík sind kleine Bilder von Walen neben den Erklärungstexten angebracht. In dem neuen Museum in Húsavík ist sogar dieser wenige Kontext verschwunden. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ein amerikanischer Marder aussieht, aber ich habe seinen Penis gesehen. Ich weiß das, weil jedes Exemplar mit einem kleinen grünen Klebepunkt markiert ist, wie auf einem Flohmarkt.
Die Punkte kleben an Gläsern, Passepartouts und Rahmen, und ihr Code aus Buchstaben und Zahlen lässt sich zuverlässig mit den Einträgen im Museumskatalog übersetzen, der an der Rezeption erhältlich ist. Die Broschüre ist in sechs Sprachen gedruckt, jede separat in farblich gekennzeichnete Umschläge gebunden. Nach Abnutzungsgrad zu urteilen, werden in absteigender Beliebtheit benutzt: Deutsch, Englisch, Französisch, Isländisch, Italienisch und Spanisch. Besucher fragen mit gleichbleibender Häufigkeit nach Russisch, Kroatisch, Finnisch und Litauisch, doch bisher gibt es den Katalog des Isländischen Phallologischen Museums weiterhin nur in den Sprachen, die an der Schule unterrichtet wurden, an der Sigurður zur Zeit der Museumseröffnung gearbeitet hat; jede Abteilung steuerte ihren Anteil bei. Sigurður behauptet, dass es das IPM eigentlich in drei Sprachen gibt: »Isländisch, das kaum jemand spricht; Latein, das niemand spricht; und Esperanto, das auch niemand spricht – aber jeder sprechen sollte.«
Das Gründungsexemplar der Sammlung, der Ochsenziemer, ist mit »D-10-a« gekennzeichnet, was der Erklärung im Katalog entspricht: »Junger ausgewachsener Bulle, gegerbt, 1974 erworben.« Das Exemplar hängt an der Wand zwischen einem Hoden-Lampenschirm und einer Passage aus Teil eins, Akt sechs, Szene vier von Shakespeares Heinrich IV. An anderen Wänden hängen Passagen von Melville und aus dem Oxford English Dictionary; die Erklärung des folkloristischen Exemplars PF-119, der Elfenbock, zitiert einen Roman des isländischen Literaturnobelpreisträgers Halldór Laxness. Aber abgesehen von dem Barden, dem Preisträger und Moby Dick im Allgemeinen sind die Wände stumm. Wenn man mehr wissen will als das, was man sehen kann, muss man woanders nachfragen.
IN DER ZWEITGRÖSSTEN STADT Islands leben dreißigtausend Menschen; in allen anderen Städten nur ein Bruchteil davon. Dennoch gibt es in diesem Land keinen Mangel an Museen. Noch seltsamer: Auf meine Nachfrage hin stellt sich heraus, dass es in Island kaum ein Museum gibt, das vor den 1990er-Jahren eröffnet wurde. Das mag nichts weiter bedeuten, als dass eine Nation, die lange arm war, endlich wohlhabend geworden ist. Vielleicht hängt es auch mit Inseln, Isolation und Identität zusammen. Sicherlich wird niemand, der etwas mit den Museen zu tun hat, wirklich niemand, Tourismus oder Kommerz als Gründe nennen. Doch zumindest im Einzelnen scheint es, als wäre irgendetwas in der jüngsten Vergangenheit geschehen, das in Island eine Blütezeit der Museen verursachte.
In seinem Aufsatz »Globalized Members: The Icelandic Phallological Museum and Neoliberalism« stellt der Anthropologe Sigurjón Baldur Hafsteinsson einen Zusammenhang zwischen der Gründung des Phallologischen Museums und dem her, was er als Ideologien der 1991 gewählten Regierung bezeichnet. Die Parteipolitik begünstigte das Unternehmertum, die Kommerzialisierung der Kulturbranche und die Förderung folkloristischer Traditionen. Sie unterstützte zudem individuelle Freiheiten, einschließlich der sexuellen. Sigurður vom Phallologischen Museum ist sich keiner kulturellen Veränderungen, einer bestimmten Politik oder eines Impulses bewusst, die seine Entscheidung zur Gründung des Museums beeinflusst hätten, aber er sagt: »Zwanzig Jahre vorher hätte ich es nicht versucht.«
Es gibt drei Museen in Húsavík, die alle noch nicht besonders lange existieren. Das Húsavík Walmuseum wurde 1997 eröffnet, 2002 folgte das kombinierte Naturkunde-, Heimat-, Meeres- und Kunstmuseum mit Bezirksarchiv, die gemeinsam als Kulturhaus Húsavík bezeichnet werden, und 2004 dann das Isländische Phallologische Museum.
Im Kulturhaus lerne ich etwas über Blech-Schwimmflügel und dass Atem im Bart gefrieren kann, bis man seinen Schnurrbart absägen muss, um weiter Luft holen zu können. Ich lerne: »Auf Isländisch wird ein unerwartetes Glück oft als ›hvalreki‹ bezeichnet – ›ein strandender Wal‹.«
Im Walmuseum von Húsavík, das sich als »einziges Museum in Europa, das ausschließlich Walen und walspezifischen Themen gewidmet ist«, bezeichnet und in dem schon Hoden und Penis eines Schweinswals ausgestellt waren, bevor das Phallologische Museum in die Stadt kam, sinniere ich über hvalreki. Ich denke daran, wie im November 1997 ein erwachsener Wal an der Nordwestküste strandete, nachdem er schon eine ganze Weile ohne Unterkiefer überlebt hatte, und wie er zu einem Segen für zwei Institutionen in Húsavík werden sollte. Das kieferlose Skelett ging an das Walmuseum und der Penis sowie ein Hoden an das Phallologische Museum gleich um die Ecke.
Für ganz Island existiert nur ein einziges Telefonbuch. Die 330.000 Einwohner des Landes passen bequem in einen Band, und als ob man damit suggerieren wollte, dass sowieso jeder jeden kennt, sind die Einträge nach Vornamen sortiert. Man hat mir erklärt, dass dies weniger mit einer besonders großen Vertrautheit unter den Bewohnern einer kleinen Insel zu tun habe als damit, dass diese Methode bei einem patronymischen Namenssystem eben einfach am praktischsten sei. In der isländischen Tradition erhält man seinen Nachnamen vom Vater, sodass Eltern nur selten dieselben Nachnamen wie ihre Kinder tragen und Geschwister je nach Geschlecht unterschiedliche Nachnamen haben. So hieße mein Bruder etwa Warrensson, also Warrens Sohn, und ich Warrensdóttir, Warrens Tochter.
Ich brauche mehrere Tage im Museum, bis mir diesbezüglich ein Licht aufgeht. Þorgerđur Sigurđardóttir ist kein Künstler, sondern eine Künstlerin, und sie muss die Tochter eines gewissen Sigurður sein – wahrscheinlich die des Kurators höchstpersönlich. Þorgerđur Sigurđardóttir beschäftigte mich wegen ihrer Skulptur namens Our Silver Boys, die an der nördlichen Wand des Museums installiert ist. Sie ist elegant in ihrer Strenge: fünfzehn Silberabgüsse, die die isländische Handballnationalmannschaft repräsentieren, stehen aufrecht wie sprießende Pilze in einer Vitrine etwa doppelt so groß wie ein Schuhkarton. Dazu muss man wissen, dass die Handballmannschaft hierzulande so populär wie anderswo eine Boyband ist und die meisten Isländer jedes Mitglied namentlich nennen können. Als die Mannschaft bei den Olympischen Spielen 2008 Silber gewann, war das eine sehr große Sache für diese Ein-Telefonbuch-Nation. Und das brachte Sigurður auf eine Idee. Einer der Olympioniken war ein ehemaliger Schüler von ihm und der Sohn eines Kollegen. Ein Anruf bei der Mutter des Spielers, und Sigurður hatte die Nummer der Mannschaft und rief ihn in Peking an. Der Spieler ging ans Telefon, aber in der Kabine herrschte ein Heidenkrach und man konnte sich vor lauter Jubel und Geschrei kaum verständigen. Und obwohl alle in den ersten Gesprächen einverstanden schienen, erwies sich die tatsächliche Logistik, fünfzehn Superstars dazu zu bringen, Modell zu sitzen (stehen?), um einen Abguss ihrer Penisse anzufertigen, schließlich als gar nicht so einfach.
Ich würde sagen, es ist eine schöne Installation. Prägnant sogar. Wie schlicht sie auf Fragen der Männlichkeit, des Wettbewerbs und der Überschneidung von persönlichem und nationalem Stolz hinweist! Es ist eine launige Anmerkung über den Penis als Trophäe, ganz zu schweigen von einem subtilen Verweis auf Fragen der Geschlechtsidentität und Geschlechtertrennung in Sportarenen. Sie ist mehr als nur eine originelle Erinnerung daran, wie ein kleines Land auf der Weltbühne eine Medaille gewonnen hat – ja, sie ist wirklich ziemlich großartig.
Eines Tages, nachdem ich lange genug im Museum herumgelungert bin, lädt mich Sigurður ein, mich zu setzen. Er räumt ein paar Stapel mit Infoblättern beiseite, um Platz auf dem Schreibtisch zu schaffen, sodass wir an diesem Nachmittag Kekse essen und Apfelsaft trinken können. Drei Tage lang arbeiten wir uns durch eine Schachtel Haust Grahamskex, brechen jeden waffelgemusterten Vollkornkeks in zwei Hälften und essen ihn langsam auf. Als ich ihn nach Our Silver Boys frage, wirft er mir ein paar Einzeiler zu. »Nein, sie stehen nicht in der gleichen Reihenfolge wie auf dem Bild«, sagt er. Und: »Ich werde nicht sagen, wer welcher ist, aber ich denke, ihre Frauen könnten es dir verraten!«
Dann erzählt er mir etwas, das mindestens genauso wahr klingt. Als er nicht alle Medaillenträger zusammenbekommen konnte, um die Formen anzufertigen, bat Sigurður seine Tochter, einfach fünfzehn Keramikmodelle in verschiedenen Längen und Formen herzustellen. Und dann, nach langem Suchen, entdeckten sie einen silberfarbenen Autolack, der die Keramik zum Glänzen brachte wie echtes Silber.
DURCH WEITERE AHNENFORSCHUNG finde ich später heraus, dass Embla Magnúsdóttir nicht nur die zwölfjährige Künstlerin hinter »Facies Clarae Emblensis (Famous Faces)« ist – eine Collage, die Justin Timberlakes Kopf auf einem langen, gliedmaßenlosen Körper zeigt, der aus der rosafarbenen Seite eines Magazins ausgeschnitten wurde –, sondern auch Sigurðurs Enkelin, die Tochter seines Schwiegersohns Magnús.
Zusätzlich zu dem Katalog der Exponate verfügt das Isländische Phallologische Museum über einen separaten Führer für »Kunstwerke und andere künstlerische Kuriositäten«, die überall im Museum ausgestellt sind. Dort sind 207 Objekte aufgelistet, mitsamt ihren pseudolateinischen Namen in Klammern dahinter. Zum Beispiel Nummer 12, Der begehrenswerte Marzipanmann (Homo gastronomicus Marsipanicus). Oder Nummer 13, Die Weihnachtsseife (Homo jabonicus natalicus). Die Liste enthält viel Exotisches: den Philippinischen Aschenbecher, einen Barcelona-Löffel; die Kanarische Brustwarze, den Camdener Kleiderbügel; den Dänischen Flaschenöffner, den Urinierenden Portugiesen. Das ferne Papua-Neuguinea hat nicht nur einen, sondern sogar zwei Penisfutterale geliefert: einen für festliche Anlässe und einen für den täglichen Gebrauch. Die Diskretion verbietet es, das Goldene Geburtstagsgeschenk oder die Sehr maskuline Schürze näher zu erläutern, aber es sei gesagt, dass sie nicht zu den Beiträgen gehören, die der Kurator ungefragt erhalten und als zu vulgär verworfen hat, ganz ohne jeden künstlerischen Wert, sodass sie in die Mülltonne gehörten.
Als ich den Kuriositäten-Katalog des Museums studiere, werden Sigurðurs familiäre Verbindungen immer deutlicher. Eine Tochter brachte das Thailändische Juwel aus dem Mittelalter und den Verlegenen Chinesen mit. Im Jahr darauf kamen eine andere Tochter und zwei Enkelkinder mit dem Kolumbianischen Liebesspielzeug nach Hause. Einmal packte der Kurator zu Weihnachten das Schniedel-Pflegeset für den Herrn und die Kolumbianische Penisflöte aus, als Geschenke von einer Enkelin und einem Enkel. Der Rosa McDonald’s-Mann (Homo rubicundus McDonaldensis) stammt vom Enkel des Kurators; er brachte ihn nach einem Besuch bei McDonald’s in Reykjavík mit. In Island gibt es keinen McDonald’s mehr; die Kette ist mehr oder weniger mit dem Abzug des US-Militärs verschwunden; aber dieses Exemplar ist erhalten geblieben.
Ich lerne die erwachsene Lilja kennen, die vom Alter her meine große Schwester sein könnte, als sie für eine Woche das Museum beaufsichtigt. Das Museum ist 114 Tage im Jahr geöffnet, von Ende Mai bis Anfang September, und damit Sigurður zwischendurch Pause machen kann, lösen ihn seine Kinder wechselweise ab. In der übrigen Zeit des Jahres, wenn das Museum geschlossen hat, Sigurður aber in der Stadt ist, kann man es unter Umständen nach Absprache besichtigen. Der Kurator hinterlässt einen Zettel mit seiner Handynummer an der Tür. Termine, so steht darauf, gebe es für die »ganz Wissbegierigen«.
»Irgendeiner ruft immer an«, sagt Sigurður, obwohl man es vorher nie wissen kann.
Lilja ist Autorin; sie hat kurze blonde Haare und die großen blauen Augen ihres Vaters. An dem Tag, an dem wir uns kennenlernen, trägt sie Ohrringe aus Wolle, die ihre Schwester gemacht hat, und die wippen, als sie mit einem Nicken bestätigt, dass die Sammlung seit Jahrzehnten die Geschenke innerhalb der Familie inspiriert hat. Ich denke an meinen eigenen Vater, einen Apotheker, der später Jurist wurde und immer ein Buch über Sprache, Politik oder regionale Geschichte auf seinem Nachttisch liegen hat. Es ist nicht seine Schuld, aber er war seit jeher die schwierigste Person in der Familie, wenn es darum ging, Geschenke zu kaufen. Mein Bruder und ich haben einmal in einem genialen Moment erkannt, dass wir seine Geschenke nicht nur nach Traditionen oder unseren Ahnungen aussuchen dürfen. Also fragten wir ihn, was ihm gefällt, und er sagte nach einigem Nachdenken: »Ärzte, die vor Gericht aussagen.« Wir stellten uns vor, ihm einen Arzt mit einer großen roten Schleife zum Verhör unter den Baum zu legen. Stattdessen kauften wir ihm – na, was wohl? – doch wieder ein Buch. Womit ich sagen will: Wenn Sigurður nicht Kurator wäre, wenn er diese Sammlung nicht hätte, wer wüsste dann, was er ihm zum Geburtstag schenken sollte? Ganz ehrlich, das wäre echt ein Problem.
WENN MAN SIGURÐUR FRAGT, ist die Folkloristische Sammlung seine Lieblingsabteilung des Museums. Sie gehört sicherlich zu den ältesten; ihre Wurzeln reichen bis in die Kneipe zurück. Von der Größe her ist sie die bescheidenste der phallologischen Sammlungen: eine einzige Vitrine mit einundzwanzig Exemplaren, die in die Ecke einer Nische passt, die ansonsten von ausländischen Penissen dominiert wird. Sie steht gleich neben dem amerikanischen Schwarzbären, dem Tammar-Wallaby und der Zwergspitzmaus.
Obwohl es sich um eine kleine Sammlung handelt, bietet sie einen ziemlich umfassenden alternativen Überblick über die isländische Mythologie. Zum Beispiel enthält sie den Penis eines einäugigen, einarmigen und einbeinigen Strandmeckerers, oder den eines isländischen Weihnachtsmannes, »am 6. Januar 1985 tot am Fuße des Berges Esja bei Reykjavík gefunden und am 6. Januar 2000 von einem ehemaligen Bürgermeister von Reykjavík dem RIS-HIR geschenkt«. Neben dem unglücklichen Dreikönigsopfer gibt es Seeheuler und Schattenhunde sowie einen Strandläufer, »der 1848 von Jón Magnússon in Südost-Island gefunden wurde und von dem es hieß, er sei ›wahrheitsliebend, gefügig, zurückhaltend und annehmbar intelligent‹ gewesen«.
Ja, auch ein Meermann, ein Seestier und ein Wasserpferd sind zu bestaunen, und o Wunder, auch ein Wirbler, ein Wechselbalg und ein Fuchs. Und, kaum zu glauben, der böse Geist von Snæfell und die leichenfressende Katze von Thingmull! Und, wie interessant, eine Seemaus! Alles echt, auch wenn es aussieht wie aus Stein, Knochen, Kürbissen oder Holz gefertigt. Das Exemplar eines huldumađur oder »verborgenen Mannes« wird nur durch ein mit Flüssigkeit gefülltes Gefäß angedeutet und sonst nichts. Es ist das Geschenk eines Parlamentsmitglieds. Sigurður schwört mir, dass es da drin ist.
EINE FREUNDIN ERZÄHLTE mir einmal von einem Traum, den sie als kleines Mädchen hatte, als sie hauptsächlich mit Jungs befreundet war. Sie träumte, dass ihre Penisse anschwollen und größer und größer wurden, sich um die Beine der Jungen wickelten, bis sie zu Wassermännern wurden und, mit ihren Penisschwänzen schlagend, im schmutzigen Straßengrabenwasser davonschwammen. In Erinnerung ist ihr geblieben, wie einsam sie sich fühlte, nachdem sie weg waren. Zwar gehört das weder ins Reich der Folklore noch dem der Mythen, aber ich wünschte, es gäbe noch eine weitere Sammlung, ein Kabinett für Schwänze und Träume, Ehrfurcht und Schrecken.
LILJA ERZÄHLT, DASS manche Feministinnen das Museum mögen, weil es den Phallus von seinem Sockel holt und ihn als ein ganz gewöhnliches Ding zeigt, ihn seines Geheimnisses beraubt. Faszinierend, wenn man bedenkt, dass die Exemplare im wahrsten Sinne des Wortes auf Sockeln stehen – außer sie hängen wie Trophäen an der Wand oder sind in monumentalen Prismen aufgestellt, die zu groß sind, um sie vom Boden aufzuheben. Ganz zu schweigen von den legendären und mythischen Exemplaren, die hier zu sehen sind.
Doch natürlich haben sie recht, die Feministinnen. Das Interessante am Isländischen Phallologischen Museum ist Folgendes: Es ist ein Museum über ein Wort. Ein Wort, das auf eine Art und Weise aufgeladen und befrachtet ist, die sehr oft nichts mit der Biologie der Sache an sich zu tun hat. Beim Rundgang durch das Museum erinnert jedes physische Exemplar an die Kluft zwischen dem eigentlichen Ding, das ein Wort wie »Penis« beschreibt, und all den anderen Dingen, die dieses Wort konnotieren. Es ist eine Art peinliche Trennung. Wie schäbig von uns, im Getöse der Assoziationen und Anspielungen ständig den Mythos zu beschwören, während wir hartnäckig die schlichte, nackte Tatsache von Blut, Fleisch und Haut vernachlässigen.
Im weiteren Sinne ist dies ein Museum der Sprache, der Erwartungen dessen, was man sich unter einem Phallologischen Museum vorstellt, und der trockene Witz dessen, als was es sich dann entpuppt. Der Witz: Es ist genau das, was es vorgibt zu sein. Penisse von einer Wand zur anderen. Vielleicht ein paar Hoden hier und da, ein paar Kunstwerke und Artefakte, aber hauptsächlich ist es nichts als ein großer Raum voller Penisse.
Bevor man das Museum betritt, bereitet man sich innerlich darauf vor, schockiert zu werden, nur um dann festzustellen, wie erstaunlich es doch im Grunde genommen ist, dass es jemand gewagt hat, etwas so Alltäglichem ein Museum zu widmen – der Penis wird nicht als vulgär, sondern als gewöhnlich präsentiert. Tatsächlich könnte man leicht vergessen, dass es noch andere Penisse auf der Welt gibt. Sofern man nicht zufällig den Penisknochen eines Waschbären als Glücksbringer trägt oder einen Oosik – den Penisknochen eines Walrosses – als Souvenir in Alaska erstanden hat, ist man sich der Existenz eines Baculums vermutlich gar nicht bewusst gewesen. Und selbst wenn man einen in der Tasche trägt oder den Walrossknochen quer in den Koffer gelegt hat, damit er überhaupt reinpasste, weiß man eventuell nicht, dass er den lateinischen Namen Baculum trägt, geschweige denn, dass die meisten männlichen Säugetiere so einen Penisknochen haben, einschließlich aller Primaten – außer uns.
Ganz schön listig, diese doppelte Umkehrung der Erwartungen. Ich denke, man besucht das Museum, weil man »Phallologisches Museum« hört und nicht glauben kann, dass das, was man sich darunter vorstellt, wirklich existiert. Und das tut es tatsächlich nicht. Sobald man durch die Tür tritt, weiß man, dass man sich geirrt hat. Es ist nicht obszön. Es ist nicht einmal lustig – nur man selbst hat sich ein wenig lächerlich gemacht.
Zwar bietet das Museum also nicht das, was man sich darunter vorgestellt hat, aber dafür etwas Besseres. Es gibt einem etwas, womit man nicht gerechnet hat.
Und hier kommt der Clou: Man will nicht, dass es das ist, was man sich vorgestellt hat. Man ist froh, dass es so nüchtern ist. Dies ist ein Museum mit Substanz. Sein Geschenkeladen ist klein und bescheiden: vierzig Postkarten, T-Shirts in zwei Designs, ein paar Bücher und die Hodensack-Hautlampen. Bis vor Kurzem konnte man auch Birkenholz-Schlüsselanhänger erwerben, die der Kurator eigenhändig geschnitzt hatte. Was auch immer man erwartet hat, so ist es doch noch überraschender und erfüllender, etwas charmant Fremdes zu entdecken. Unglaublich: die vergleichende Anatomie, diese alte Wissenschaft, ist wirklich irgendwie erhellend – und damit hat man nicht gerechnet.
LETZTEN SOMMER MUSSTE es Barock sein. Jetzt sind es Beethovens Klavierkonzerte und Streichquartette, zwei CDs, die den ganzen Sommer über abwechselnd eingelegt werden, bis sie kaputtgehen. Der CD-Player steht versteckt neben dem Schreibtisch. Darüber hängen zwei Kalender an der Wand – einer mit antiker griechischer Vasenmalerei, der andere mit Che Guevara, der einen Fotoapparat einstellt –, aber es ist nichts darauf vermerkt, was einen Tag vom anderen unterscheiden würde. Sigurður steht neben den leeren Kalendern und markiert mit einem Strich in einem Notizbuch das Eintreffen eines Besuchers. »Achthundert Kronen«, sagt er und vervollständigt das Couplet mit: »nur Bargeld«. Wobei man übrigens in ganz Island nur in diesem Museum und im Stadtbus überhaupt Bargeld braucht. Sigurður wiederholt diesen Satz und die entsprechende Ergänzung hundertmal am Tag, trocken und gleichförmig, wie eine Litanei.
»Haben Sie es nicht kleiner?«, fragt er einen Besucher nach dem anderen, wenn sie versuchen, einen Fünftausend-Kronen-Schein einzuwechseln, und ich frage mich jedes Mal, ob das ein Penis-Witz ist, aber niemand lacht. Früher kostete das Museum nur halb so viel, doch der Eintrittspreis stieg mit der Zeit langsam an, bis das Museum 2008 endlich schwarze Zahlen schrieb. Als er dann nicht mehr draufzahlte, fand Sigurður es unnötig, den Preis danach noch weiter zu erhöhen. An den Strichen im Eintrittsbuch lässt sich erkennen, dass das Museum mit jedem Jahr stärker frequentiert wird, obwohl es zu Beginn und am Ende jeder Saison immer ruhig zugeht. Trotzdem summiert es sich. Im Laufe des Sommers wird Sigurður etwa dreizehntausend Besucher verzeichnen, Strich für Strich. Es ist schon ein wenig paradox, was sich letzten Endes als Belohnung für so viel Originalität, Spontaneität und sprachliche Spielerei erweist: Man hat ein Museum auf die Beine gestellt und muss sich dann endlos mit den immer gleichen grundlegenden Verwaltungsaufgaben abplagen.
Eine Freundin von mir ist der Meinung, der Unterschied zwischen einer Sammlung und einem Museum sei reine Interpretationssache. Wir kamen darauf, als wir ein anderes isländisches Museum besuchten, das ich nicht zuletzt deshalb liebe, weil sein Name mit »Das Museum der kleinen Dinge« oder »Das Allerlei-Museum« übersetzt wird, und weil die Ausstellungsstücke Dinge umfassen wie etwa ein paar Dutzend dicke, alte Nägel, die wie ein Igel-Prototyp aus einer alten, weiß getünchten Tafel ragen.
Im Museum der kleinen Dinge sind nicht nur Nägel ausgestellt, sondern auch Schlüssel, jede Menge Schlüssel, Telefone und jeder einzelne Bleistift, der seit der Einschulung in den Besitz des Sammlers gelangt ist. Meine Freundin ist Architekturhistorikerin und ich habe Kunstsammlungen verwaltet, und wir waren beide sehr angetan von einer Texttafel, auf der der Sammler über ein potenzielles Ausstellungsobjekt sagt: »Auch wenn es jetzt noch nicht alt ist, wird es das eines Tages sein.«
Meine Freundin war jedoch nicht bereit, der Allerlei-Sammlung den Status eines Museums zuzugestehen, ganz egal, wie es sich selbst nannte. Horten sei kein Kuratieren, sagte sie. Die schiere Masse mache noch kein Museum aus. Museen, konstatierte sie, seien Sammlungen, die sortiert und zu Geschichten arrangiert seien, denen eine Ordnung, eine Erklärung und ein Sinn gegeben werde. Sammlungen an sich seien nur Gruppierungen von Dingen.
Ich denke, das ist eine nützliche Unterscheidung, und ich frage mich, ob wir in der Praxis nicht mehr Museen hätten, wenn nicht nur so wenige Menschen die notwendigen unterschiedlichen Fähigkeiten in sich vereinten – die sich einerseits für das Sammeln, Erzählen und Ordnen von Geschichten begeistern als auch gerne geduldig Kataloge führen, Eintritt kassieren, aufräumen und immer wieder erklären, dass sie einen so großen Geldschein nicht wechseln können.
IN DEM SOMMER, in dem ich das Phallologische Museum besuche, wird Sigurður siebzig Jahre alt. Es ist sein letzter Sommer, ja es sind seine letzten Wochen im Museum. Ich frage, ob es eine große Abschiedsparty geben wird.
»Nein«, sagt der Kurator.
Als die chilenische Zeitschrift Las Últimas Noticias Sigurður 2007 fragte, was er mit dem Museum machen werde, wenn er sterbe, sagte er, er wisse es nicht. »Posiblemente lo donaré a la Iglesia Luterana de Islandia.« Möglicherweise werde ich es der lutherischen Kirche von Island schenken, sagte er. Die Lutheranische Kirche hat noch kein Interesse bekundet, aber Sigurður hat im Laufe der Jahre viele andere Angebote bekommen. Im Jahr 2010 wollten einige Isländer das Museum kaufen und modernisieren, eine Neugestaltung mithilfe von Museumsarchitekten in Reykjavík durchführen. Aber es ist nicht zu verkaufen, nicht an sie. Zu riskant. Zu groß ist das Risiko, dass es sich in etwas Pornografisches, Lüsternes verwandeln würde, etwas, das es nicht sein soll.
Wenn Sigurður in den Ruhestand geht, wird sein einziger Sohn das Museum übernehmen, es zurück nach Reykjavík bringen und dort weiterführen. Im Großen und Ganzen wird alles so bleiben, wie es ist: die gleichen Spezifikationen, die gleichen Etiketten. Die gleiche handgeschnitzte Kasse, der gleiche Einlass-Sermon. Wobei wir unter der Führung des Sohnes zumindest mit einem besser ausgestatteten Souvenirladen rechnen können. »Fürs Geschäft hat er ein besseres Händchen«, sagt Sigurður.
»Mein Vater hat keine Lust dazu«, sagt Lilja und weist mit dem Kinn auf das Bücherregal, das als Geschenkeladen durchgeht. »Die Geldkassette aufschließen, den Leuten Wechselgeld rausgeben …« Er misst dem einfach keine große Bedeutung bei. Früher hatte er Spaß daran, phallische Türklinken, Garderoben und Holzhämmer zu schnitzen. Im Jahr 2000 konnte man ein Springseil mit hölzernen Phallusgriffen für nur sechsundzwanzig Dollar kaufen, aber Sigurður hat vor zwei oder drei Jahren aufgehört zu schnitzen. Die Produktion der Schlüsselanhänger hat er nach Indonesien ausgelagert (es gibt sie mittlerweile in drei verschiedenen Farben), aber die Salz- und Pfefferstreuer sind nur noch Sammlerstücke, und wenn man so etwas wie einen Rückenkratzer will, so sind diese leider ausverkauft.
Ich frage Lilja, ob es in der Familie Unmut über die Entscheidung gab, Hjörtur das Museum zu überlassen, aber sie versichert mir, dass sie und ihre Schwestern einverstanden waren. Zwar haben die Schwestern dem Museum so manches gespendet und lieben es – die Älteste hat 2003 sogar eine prächtige nicht-kirchliche Hochzeit in seinen Räumen gefeiert –, aber die Frauen waren sich einig: Dieses spezielle Museum könne nur vom Vater an den Sohn weitergegeben werden.
DIE SAMMLUNG WIRD FORTGEFÜHRT. Natürlich wird sie das. Eineinhalb Monate bevor er in den Ruhestand geht, hat der Kurator noch eine Wunschliste: ein Exemplar von einem Eisbären (ein besseres), von einem Blauwal (ein vollständigeres), eines von einem reinrassigen isländischen Hund. Die Exemplare der bereits in der Sammlung vertretenen Spezies können immer eine Aufwertung vertragen, und der Umfang der Sammlung kann jederzeit um neue Arten erweitert werden. Manche Meerestiere haben meterlange Phallusse – wenn es nur einen Ahab gäbe, der sie herbeibrächte! Eine vollständige Sammlung auch nicht-isländischer Exemplare könnte das Lebenswerk eines anderen Mannes – oder, Verzeihung, Menschen werden. Allein die Sammlung der Exemplare heimischer Säugetiere war erst im April 2011 abgeschlossen.
Páll Arason war in Island, wie Sigurður es höflich ausdrückt, »eine bekannte Persönlichkeit« – andere würden ihn wohl eher berühmt-berüchtigt nennen. Als Pionier des isländischen Tourismus war Arason »der Erste oder Zweite«, der Reisegruppen in das Hochland, das schöne und unberechenbare Innere der Insel führte. Ein alter Hippie beschrieb mir einmal schwärmerisch den Anblick der Hochlandfelsen, die wie versteinerte Trolle geformt sind, und ich habe gehört, dass es herrlich sein muss, die Gegend auf dem Pferderücken zu erkunden, obwohl Regen oder Schneeregen ohne Vorwarnung über einen hereinbrechen können und einem dann nichts anderes übrigbleibt, als sich durchzuschlagen, bis es wieder aufhört. Als ich meinen Mietwagen abhole, liegt eine Pappkarte der Gegend auf dem Lenkrad, die in zwei Farben zeigt, wohin ich mit der winzigen weißen Blechbüchse fahren darf und wohin nicht. Ein dünnes blaues Band umgibt die Insel; die erlaubten Wege ignorieren das gesamte Hochland mit seinen schlechten Straßen, dem schlechten Wetter und den fehlenden Orten, man kann ja ohnehin nirgends anhalten. Die Karte weist nicht ausdrücklich darauf hin, dass es dort Drachen, Seeungeheuer, Hexen oder Trolle gibt, aber dennoch überlasse ich das Hochland dem Ermessen von Fahrern mit, wenn nicht abenteuerlicherem Gemüt, so doch gewiss robusteren Transportmitteln.
Arason wurde als Abenteurer bewundert, aber er war auch als politischer Faschist und berüchtigter Frauenheld bekannt. Die Presse bevorzugt manchmal das Wort Nazi, wie in der Schlagzeile: SE CORTÓ EL PENE DEL NAZI! Kurator schneidet Penis des Nazis ab! Was auch immer Páll Arason sonst noch gewesen sein mag, so ist er doch wohldokumentiert als die erste Person, die dem Museum ein menschliches Exemplar vermachte. Zu dem Zeitpunkt war er achtzig Jahre alt. Sigurður fehlten damals nur noch zwei Arten, um wirklich von jedem Säugetier in Island ein Exemplar zu besitzen. Die Sammlung war noch nicht einmal ein Museum; dieses sollte erst später im selben Jahr eröffnet werden, aber Arasons Absicht, ein posthumer Spender zu werden, wurde schriftlich festgehalten, unterzeichnet und bezeugt.
Arason war schon alt, als er die Vereinbarung traf, aber er lebte danach noch viele Jahre, lange genug, um mit über neunzig einen gewissen Verfall zu bemerken, lange genug, um festzustellen, dass sein Penis als Exemplar nicht mehr das Vermächtnis war, das er hinterlassen wollte. Ja, er lebte lange genug, um seine Entscheidung noch einmal zu überdenken. Bis dahin hatte das Museum nichts weiter vorzuweisen als den juristischen Papierkram einer versprochenen Schenkung. Also genau genommen war im Museum eine menschliche Vorhaut ausgestellt, und die Hoden eines anderen Spenders waren zu sehen, aber ohne ein komplettes phallisches Exemplar eines Homo sapiens betrachtete der Kurator die Sammlung als unzulänglich.
Im Lauf der Zeit meldeten sich drei weitere, jüngere Männer: ein Amerikaner, ein Deutscher und ein Brite. Auch ihre Schenkungsurkunden wurden an der Galeriewand aufgehängt. Der Kurator dachte nicht lange darüber nach, ob sie nun eine heimische oder eine fremde Spezies repräsentierten. Und dann, Anfang 2011, fünfzehn Jahre nach der Schenkungserklärung, verstarb Arason.
Man könnte meinen, dass in diesen fünfzehn Jahren Zeit zur Vorbereitung war, reichlich Zeit, ein Übermaß an Zeit, Zeit im Überfluss, ein Meer von Zeit. Die juristische Vorarbeit war schließlich schon fein säuberlich erledigt worden. Jeder wusste um Arasons letzten Wunsch, und 275 Exemplare hatte das Museum bereits präpariert. Und doch, als Dr. Peters spät in der Winternacht anrief, in der Arason verstorben war, lautete seine Frage: »Was soll ich tun?«
Ein nüchterner Sigurður hätte gesagt: »Bring ihn frisch her!« Ein nüchterner Sigurður hätte geraten: »Nimm zwei bis drei Teelöffel Essig, um das Blut herauszuziehen.« Austretendes Blut trübt nämlich die Konservierungsflüssigkeit, aber wenn es einmal abgelaufen ist, braucht man nichts weiter zu tun, als das Präparat zu konservieren, es zu positionieren und es in sein Formalinbad zu tauchen. Doch es war mitten in der Nacht, und irgendwie geriet einiges durcheinander. Es heißt, es wurden Fehler gemacht. Sigurður nennt es die »Tragödie des Herrn Arason. Schrecklich, schrecklich.« Er schwört, es wiedergutzumachen.
Mir persönlich graust es davor, ihn anzuschauen. Das kleinste Exemplar des Museums ist weniger als zwei Zentimeter groß, der Penisknochen eines Hamsters, und ich starre ihn bereitwillig mit der bereitgestellten Lupe an, ohne den Unterschied zu den fast unmerklich größeren Exemplaren der Hausmaus und der schwarzen Ratte wirklich zu erkennen. Das menschliche Exemplar in derselben Vitrine zu betrachten, ist mir jedoch auf eine Art und Weise unangenehm, wie es einem nur bei nicht identifizierbaren Dingen geht.
Glücklicherweise ist die menschliche Spende, Exemplar D-15-b, leicht zu übersehen. Wenn man im Uhrzeigersinn geht, endet der Hauptgang an dem Gitter aus Regalfächern, an dem man bereits beim Eintreten vorbeikommt. Dort sind die drei menschlichen Exponate zusammen ausgestellt, unterhalb des Nerzexemplars und genau zwischen dem Hundeexemplar und dem Rotfuchsexemplar. Der menschliche Phallus wird flankiert von einem Marmeladenglas mit Vorhaut, Exemplar D-15-a, und einer Glasglocke mit Hoden, Exemplar D-15-c. Ein kleiner Junge, der vor dem Regal steht, das berühmte Exemplar kaum fünfzehn Zentimeter von seinem Kinn entfernt, dreht sich um und fragt seine Mutter: »Welches ist es?« Sie schaut im Katalog nach, deutet auf das entsprechende Gefäß, und der Junge zuckt erschrocken zurück.
»Sieht gar nicht aus wie in echt«, stimmt ihm seine Mutter zu.
Im Weggehen merkt die jüngere Schwester des Jungen sachlich an: »Es ist wahrscheinlich das Innere.« Sie trägt Zöpfe, und sie sieht so zuversichtlich aus bei diesem Trost, so sicher, dass am Ende doch alles seine Richtigkeit hat, dass ich nicht auszusprechen wage, was mir offensichtlich erscheint: Nichts im Inneren wäre so haarig.
AN EINEM ANDEREN TAG entdeckt ein anderer kleiner Junge die Hodensack-Hautlampen und verkündet: »Ich will so eine essen.«
An diesem Tag ist Lilja im Museum, und sie lehnt sich zu mir rüber und flüstert: »Er hat Pech – falsche Jahreszeit.« Wenn es Januar oder Februar wäre, erklärt sie mir, könnte ich in jedem beliebigen Supermarkt eingelegte Widderhoden kaufen, aber jetzt, im Juli, müssten wir uns noch gedulden. Dafür essen wir ein paar Wochen später in Reykjavík Schwarzbroteis nach dem Rezept ihrer Mutter und penetrant riechende Würfel von verwesendem Hai.
Liljas Vater hatte mich an meinem letzten Tag im Museum daran erinnert, Wal zu probieren, bevor ich wieder nach Hause fahre. Man müsse vielleicht mit dem Geschmack von Walfleisch aufgewachsen sein, meinte der Kurator, aber er sei von wesentlicher Bedeutung für Isländer. Wäre ich Isländerin, gehörte ich zu der Generation, die ohne den Geschmack von Wal aufgewachsen sei, ohne das Ritual des Walessens, was zwangsläufig zu Identitätsproblemen führen würde. Als ich an der alten Walfangstation in der Nähe von Akranes vorbeifahre, kann man von außen kaum erkennen, dass sie noch in Betrieb ist. Die grauen Gebäude und die Ketten an den Zäunen wirken wie die Relikte eines toten Gewerbes, die sich noch am Fjord festklammern. Doch vielleicht hat es hier schon immer so ausgesehen, vielleicht war es schon so, als Sigurður vor Jahren mit seiner Tochter hierherfuhr, derselben auffallenden, schelmischen Frau, die den Hai bestellt und mir jetzt dabei zusieht, wie ich mit einem Zahnstocher ein verrottetes Stück zum Mund führe (weil man den Gestank nicht von Silberbesteck abbekommt), und interessiert beobachtet, wie der Geschmack zunächst erträglich ist, aber dann das zarte, blasse Fleisch einen widerlichen Ammoniakgeschmack verbreitet und ich es ausspucken muss.
Man könnte meinen, alte Traditionen wären seltsam, weil sie nun mal alt sind. Man kann sich leicht vorstellen, dass sie einmal Sinn ergeben haben, aber zu lange überdauerten, ihren Zweck überlebt haben, anachronistisch und rudimentär wurden. Sicherlich trifft das manchmal zu. Andererseits wäre es vorstellbar, dass bestimmte Handlungen, Gegenstände, Geschichten und Lieder gerade deshalb zur Tradition wurden, weil ihnen eine gewisse Eigenart anhaftet. Ist es nicht das Außergewöhnliche, die einzigartige Kuriosität einer Sache, die verblüffende Verwandlung oder der essenzielle Widerspruch zu den Erwartungen des Beobachters, die diese Sache wert machen, wiederholt und weitergegeben zu werden? Museen, so habe ich einmal gesagt, werden aus einer Neuartigkeit heraus geboren, ja, sie werden von ihr getragen. Sie haben keine bessere Tradition. Du isst – zum ersten Mal – von dem Aas eines giftigen Hais, der sechs Monaten zuvor begraben wurde, weil du hungerst. Aber du isst ihn auch in Zeiten des Überflusses, weil es so eindeutig atemberaubend ist, dass man so etwas tun kann.