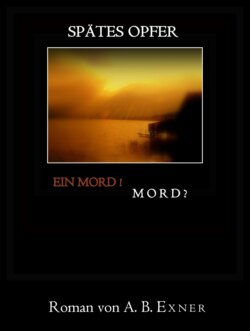Читать книгу Spätes Opfer - A.B. Exner - Страница 12
Bert Klose
ОглавлениеIch hatte nur noch drei Wochen bis zur Entlassung vom Armeedienst. Alle Angebote, mich für länger zu verpflichten, schlug ich aus. Tauchen? Ja! Kampfschwimmer? Nein. Vielleicht später einmal bei der Wasserschutzpolizei? Mal sehen. Dirk Färber wollte mich vom Zug abholen. Jetzt, um neun Uhr zwölf. In Berlin Lichtenberg. Dann sollte es mit seinem Moped in den Prenzlauer Berg gehen. Seit siebzehn Tagen hatte er seine Fahrerlaubnis wieder. Er durfte wieder fahren. Wir wollten heute am Abend in den BEWAG-Club gehen. Seit Jahren ein absoluter Insidertipp in der Nähe vom Bahnhof Friedrichstraße. Dort, gleich um die Ecke, befand sich auch das Berliner Ensemble. In diesem Theater arbeitete Veras Mutter als Personalerin. Vera. Dirk war nicht am Bahnhof. Nicht vor dem Bahnhof. Als ich mit der S-Bahn fünfundvierzig Minuten später in der Stolpischen Straße ankam und bei ihm klingelte, machte seine Schwester Gaby auf. Ein kurzes: Hallo, wie geht’s, sollte es werden und dann wollte ich zu Dirk ins Zimmer. Aus der Begrüßung wurde ein Heulen. Dirks und Gabys Mutter war zwei Tage zuvor mit einem schweren Hirntumor in die Klinik gebracht worden. Es gab keine Ergebnisse, keine Informationen. Ob es eine Chance gab, nun – die Ärzte sprachen einfach nicht darüber. Ihr Vater sei seit mehreren Tagen nicht zu Haus aufgetaucht. Wieder ein Tränenschwall. Nach mehr als einer Stunde fragte ich nach Dirk. Sie wies nur auf sein Zimmer. Dirk lag zugedeckt in seinem Bett neben zwei Flaschen Goldbrand. Leeren Flaschen. Nachdem ich ihn in eine aufrechte Position gebracht hatte, grinste er mich an und fragte, ob ich ihm beim Implodieren seiner Leber zuhören wolle. Dann übergab er sich nach vorn in seinen eigenen Schoß. Gaby kam rein. Sie warf die vollgekotzte Bettdecke auf den Balkon und Dirk ging ins Badezimmer. Sie setzte sich schluchzend neben mich. Er habe seit Monaten nichts mehr getrunken. Das war das Erste, was Gaby zu diesem Thema sagte. Jetzt, wo er fest mit Vera zusammen sei, riss er sich zusammen. Eine neue Arbeit in einem Lager für Elektronikbauteile in der Storkower Straße habe er angenommen. Dirk und Vera sprachen über Kinder. Sogar das Rauchen habe er eingeschränkt. Bis gestern Abend. Da kam der Einberufungsbefehl zur Armee. Die Nationale Volksarmee verlangte nach ihm. Gerade jetzt, wo das mit Mutter und Vater so beschissen und mit Vera so fantastisch lief. Ich wollte nur noch weg, ersehnte Trubel, Tanz, Abwechslung und ja auch Alkohol. Dirk war nicht in der Lage, mich zu begleiten. Mit wem konnte ich Berlin unsicher machen? Ich rief ein paar Leute an, die aber auch alle schon verplant waren. In meinem Telefonbüchlein blieben nur noch U V W X Y Z. Bei V wurde ich fündig. Vera. Sie hörte sich so normal an. Dirk wäre gestern mit ihr bei seiner Mutter im Krankenhaus gewesen. Heute wolle er allein hin. Deshalb habe sie nichts vor. Sehr gern würde Vera mit mir den Abend verbringen. Wieder fielen mir zuerst die Veränderungen an ihr auf. Sie war runder. Nicht schwanger oder fetter oder so, nein – runder. Die Schatten auf ihrem Gesicht zeichneten sich weicher ab. Sie war fraulicher geworden. Hatte nicht mehr diese Mädchenfigur. Bei unserer letzten Begegnung hatte sie dicke Winterklamotten angehabt. Und die Figur eines Mädchens, das nicht immer satt wird oder nicht immer den Teller leer isst. Sicher, das ist ein blöder Omaspruch, aber mir fällt nichts Besseres ein, um es zu beschreiben. Jetzt, in der ersten Aprilsonne, trug sie ein hellblaues, verteufelt kurzes Kleid. Ihre kleinen Füße steckten in Wildledersandalen. Über den Schultern hatte sie ihre Jeansjacke. Ihre Haare waren lang gewachsen. Immer noch Kastanie. Nur eine kleine Spange an der linken Schläfe hielt die wallende Pracht von ihrem Gesicht fern. Ihr Gesicht war runder. Wie soll ich es anders beschreiben? Sie hatte den Weg von der sportlichen Zierlichkeit zu fraulicher Eleganz beschritten. Erfolgreich beschritten. Wir hatten uns verabredet. Für elf Uhr dreißig in der Kollwitzstraße. Wir wollten, wie früher schon einmal, einen Spaziergang über den jüdischen Friedhof machen. Wir waren beide pünktlich. Wir redeten wenig. Wir wiesen den anderen auf kleine Entdeckungen in der jungen Frühlingsnatur hin. Wir betrachteten uns verschmitzt mit Teenagerblicken. Am Märchenbrunnen kauften wir Eis, und wandelten dann über den Alexanderplatz. Durchquerten die Leipziger Straße, um zum Berliner Ensemble zu spazieren. Dort besuchten wir Veras Mutter. Sie freute sich sichtlich, mich zu sehen. Sie war augenscheinlich erstaunt, dass wir Händchen hielten. Ich sollte warten, während sich die Frauen leise tuschelnd verdrückten. Was war hier los? Geschah irgendetwas mit mir? Färbte Veras unbekümmerte Leichtigkeit auf mich ab? Vera war so gelöst, so unschuldig, so frei. Ihre Mutter so nervös. So geheimnisvoll. Ich wartete im Büro der Mutter. Nach zwanzig Minuten erschienen die Frauen. Vera hatte also wieder den Fundus des Theaters plündern dürfen. Sie hatte eine grüne Strumpfhose angezogen. Darüber ein knallrotes Kleid mit zwei riesigen, aufgesetzten, rechteckigen Taschen. Die Taschen waren gelb. Wie eine liebestolle Ampel. Das Kleid war testosteronfördernd kurz. Ich liebte es. Ihre Haare trug sie jetzt in einem rotzfrechen Pferdeschwanz. Dadurch, dass ihr Gesicht jetzt völlig frei war, kamen ihre wundervoll gewölbten Lippen ans Tageslicht. Ihre Augen überstrahlten das jetzt offene Antlitz und warfen Unschuld in den Frühlingstag. Unwillkürlich ging ich zwei Schritte zurück. Drei Schritte. Das Zimmer war zu Ende. Keck. Das ist der richtige Begriff. Keck. Sie sah keck aus. Sie schaute keck. Gemeinsam mit Veras Mutter aßen wir in einem kleinen Restaurant in der Oranienburger Straße. Jetzt, wo ich so nah an Veras Gesicht war, entdeckte ich zu meinem Erstaunen erst, dass sie nicht geschminkt war. Das war pure Natur. Ich liebte ein Mädchen, besser gesagt, eine Frau, die am schönsten in natura war. Ihrer Mutter konnte das nicht entgehen. Ich bekam ein schlechtes Gewissen. Nicht nur, weil ihre Mutter das Essen zahlte. Nicht nur, weil es offensichtlich war, dass ich in die Freundin meines Freundes verliebt war. Nein, ich wusste auch, dass Dirk Vera wieder belogen hatte. Er würde seine Mutter heute nicht besuchen, sondern seinen Rausch ausschlafen. Oder weiter trinken. Ihre Mutter musste wieder zur Arbeit. Jetzt nicht mehr Händchen haltend gingen wir in Richtung der Museumsinsel, um dann doch einen Schwenk in Richtung des Monbijouparks zu machen. Ich lag mit meinem Kopf auf ihrer linken Schulter. Sie lag mit ihrem Kopf auf meiner linken Schulter – Ohr an Ohr. Das hatten wir früher schon gemacht, wenn wir in den Himmel sahen, um die Umrisse von Wolken zu deuten. Bei uns im Garten. In Veras Wohnung auf der Dachterrasse, am Orankesee beim Baden. Im Ruderboot in Güstrow. Das war die Zeit zum Spinnen. Zum Fantasieren, zum Zukunft malen. Wir begannen immer damit, dass wir uns Ohr an Ohr legten und die Augen schlossen. Dann musste einer eine Melodie summen, die der andere fortsetzen sollte. Dirk fand es immer albern. Vera liebte es. Ich liebte es. Ich liebte sie. Wir mochten Stunden in den ersten wärmenden Strahlen dieses Frühlings gelegen haben, als die Sonne hinter den, an den Park grenzenden, Häusern verschwand. Wir machten uns auf den Weg. Händchenhaltend. Einer der schattenwerfenden Gebäudekomplexe war ein Krankenhaus. Das Krankenhaus, in dem Mutter Färber lag. Dirks Mutter. Das fiel mir jetzt erst auf. Ob er es noch geschafft hatte? Nein, Dirk nicht. Aber jemand anderes. Ich erkannte den forschen Schritt einer Frau auf der anderen Seite der Wiese, auf der wir lagen. Die Frau ging unten an der Spree entlang. Eigentlich hatte ich jetzt keinen Bock auf diesen Zufall. Ich lotste Vera, ohne ihr etwas zu sagen, in die entgegengesetzte Richtung. Doch Gaby hatte uns schon entdeckt. Sie stellte sich uns in den Weg und nicht zur Rede. Vera wollte mich nicht loslassen. Ich löste meine Hand dennoch aus der ihren. Gaby sandte nur Blicke. Wir standen im Dreieck. Nach ewigen Sekunden des Schweigens sagte Vera nur zu Gaby, dass wir Freunde seien, nicht mehr. Gaby fing bitterlich an zu weinen. Nicht jedoch wegen uns. Ihre Mutter sollte heute in der Nacht zum dritten Mal operiert werden. Allerdings in einer Klinik in Westberlin. Die Möglichkeiten in der Charité waren alle erfolglos geblieben. Verwundert hinterfragten wir, weil uns nicht klar war, dass es die Möglichkeit einer OP im Westen der Stadt gab. Sie erklärte uns, dass die katholische Gemeinde aus unserem Stadtbezirk etwas Geld dazu gab und auch die Verwandten aus dem Westen finanziell halfen. Das es sowas gab? Waren unsere Ärzte jetzt nicht mehr gut genug? Ich fühlte eine bittere Empörung in mir. Wir begleiteten Gaby bis zur Straßenbahn und verabschiedeten uns. Schweigend setzten wir unseren Spaziergang fort. Immer wieder musste ich an die Peinlichkeit denken, dass unsere Medizin nicht so gut seine sollte, wie die im Kapitalismus. Wir liefen durch die Hackeschen Höfe, genehmigten uns eine Pause am Neptunbrunnen, auf dem Alex, um dann auf ein Bier in die Zillestuben einzukehren. Wir saßen direkt am Fenster. Die Straßenlaternen waren schon lange an. Die Werbung für die Jugendtageszeitung „Junge Welt“ krönte einen der schrecklicheren Neubauten am Rande des Alexanderplatzes. Vera fragte mich, was an all diesen Erlebnissen dieses Tages nicht stimmte. Ich wusste, dass an diesem Tag im Jahr 1905, die Weltausstellung in Lüttich eröffnet worden war. Auf das Heute bezogen, hatte ich keine Ahnung. In meiner grenzenlosen Einfalt hatte ich nicht erfasst, worum es ihr ging. Wieder einmal. Sie sah mich lange und bestimmt an. Dann sagte sie nur das eine Wort. Seinen Namen. Er hatte ihr gesagt, dass er heute seine Mutter besuchen wollte. Deshalb hatte sie auch nichts vorgehabt, konnte mit mir unterwegs sein. Abends, dass wusste sie, wollten Dirk und ich mit alten Kumpels in den BEWAG-Club. Jetzt war es bereits dunkel. Dirk war nicht bei seiner Mutter gewesen. Und jetzt war Dirk nicht mit Bert im Club. Was also war los? Sie wollte die Antwort jetzt. Wollte mit mir und Dirk reden. Sie wollte mit mir zu Dirk nach Haus. Es war die längste U-Bahnfahrt meines jungen Lebens. Sie sprach kein Wort und ich wusste, dass ich die Schnauze zu halten hatte. Gaby war schon wieder zu Haus und immer noch nicht beruhigt. Dirk sei in der „Ampel“. Sogleich wandten wir uns zum Gehen, als Gaby Vera an die Hand nahm. Gaby sah uns abwechselnd an und beschwor uns, Dirk das nicht anzutun, er würde zerbrechen, würde am Alkohol zugrunde gehen. Vera solle nicht mit ihrem Bruder Schluss machen. Die Ampel war eine Kneipe der übleren Sorte. Vera sah Dirk sofort. Ich hörte ihn nur grölen. Er weinte bitterlich wegen der Ungerechtigkeit der Welt. Dass er Vera liebe und seine Mutter bald sterben werde und ihm jetzt, wo er wieder zum Fusel gegriffen habe, nur seine Schwester bleiben würde. Denn Vera würde ihn doch bestimmt verlassen. Mit den beiden letzten Annahmen sollte er sich täuschen. Es kam anders herum. Es dauerte drei Stunden, bis ich Dirk im Bett hatte. Vera war bereits nach ein paar Minuten rückwärts aus der Kaschemme verschwunden. Er weinte. Er sträubte sich. Er wurde ungerecht. Er brach zusammen. Meine Eltern waren sowieso nicht zu Hause, also blieb ich einfach bei Dirk. Gaby und ich saßen auf dem Balkon. Nebeneinander auf der Bank. Eingemummelt in eine alte Steppdecke. Sie erzählte mir von Dirk und den letzten Monaten. Erzählte von den Stunden des Bangens am Bett des besoffenen Bruders und denen am Bett der Mutter. Dem verständnislosen Warten am leeren Bett des Vaters. Sie berichtete von den Gesprächen mit Vera. Gaby befürchtete immer, dass Vera wegen der besseren Stelle, des besseren Verdienstes irgendwann von Dirk ablassen würde. Vera beruhigte sie jedes Mal. Für Dirk war Vera die einzige Konstante in seinem Leben. Nur wegen ihr hatte er sich die andere Arbeitsstelle gesucht. Wegen Vera trank er nur noch Bier und verzichtete auf die harten Sachen. Er rauchte zu Haus gar nicht mehr. Wegen seiner Liebe zu Vera. Ich hörte zu. Ich war verliebt in die Freundin meines besten Freundes. Und ich schlief in dieser Nacht mit seiner Schwester. Als ich nur noch sechs Tage bis zu meiner Entlassung aus dem Wehrdienst übrig hatte, kam der Brief von Vera. Sie entschuldigte sich, weil sie einfach nicht in der Lage gewesen war, mir an diesem Abend in der Kneipe zu helfen. Sie hatte lange mit Gaby gesprochen. Über mich und über Dirk. Auch über Dirks Mutter. Sie hatte sich mit Dirk verlobt. Veras Mutter war nicht begeistert und ihr Vater außer sich. Als angehende Medizinerin wolle sie einen Lagerarbeiter durchbringen? Das würde kein Mitglied der Familie verstehen können. Wieder las ich die Hilferufe der Freundin. Was sollte ich tun? Bei der Armee gab es nicht eben mal schnell so einen Urlaub nebenher. Schon gar nicht mit dieser Begründung. In einer Woche wäre ich zu Haus. Dann könnte ich helfen. Das schrieb ich ihr und war der festen Überzeugung, dass es so sein würde. Einen Abend später erhielt ich einen Anruf von Dirk. Da das Gespräch längst weg war, als die Heerscharen von Wachhabenden mich endlich darüber informiert hatten, rannte ich zum Med.-Punkt und wählte Dirks Nummer. Beim zweiten Klingeln hörte ich ihn weinen. Sein Vater sei in der Nacht von einem Motorrad angefahren worden. Es ginge ihm sehr schlecht. Der Schädel sei offen. Gaby sei jetzt bei ihm, er würde sie in zwei Stunden wieder ablösen. Nach einer Sauftour von nahezu vier Wochen, wollte der Vater wieder nach Haus und war genau vor dem Musikgeschäft in der Schönhauser Allee / Ecke Stolpische Straße von dem Motorrad erwischt worden. Nur vierzig Meter vor der eigenen Wohnung. Über seine Mutter könne er nichts sagen, die sei immer noch in dem Westberliner Klinikum. Ja, er werde Gaby grüßen. Ich solle mich melden, wenn ich wieder da sei. Er werde mich dann aber nur kurz sehen können. Kein Wort der Begründung. Und dann fiel es mir ein. Ich kam am Montag nach der Armeezeit nach Haus und ab Mittwochabend sollte er das sozialistische Vaterland verteidigen. Fliegender Wechsel. Wir hatten nur ein paar Stunden. Scheiße. Das Gespräch wurde durch Dirk beendet. Etwas fehlte. Vera. Wir hatten kein Wort über Vera gesprochen.