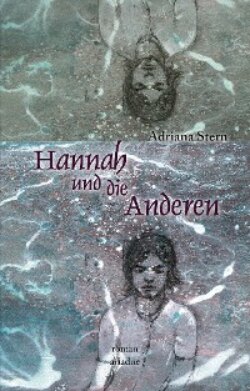Читать книгу Hannah und die Anderen - Adriana Stern - Страница 5
Auf der Flucht 1. Kapitel, in dem Hannah durch die Straßen irrt und jemanden mit merkwürdigen Meinungen kennen lernt
ОглавлениеSie sah auf die Telefonnummer, die sie mit kalten, klammen Fingern in ihren Händen hielt.
Sie zitterte am ganzen Körper. Vor Kälte? Oder aus Angst? Sie wusste es nicht. Verzweifelt wühlte sie in ihrem Kopf nach einem Sinn, weshalb sie jetzt hier in der Telefonzelle stand, um diese Nummer zu wählen.
Für einen Augenblick sprangen ihre Gedanken heraus aus der Enge der Zelle. Bilder vom Pausenhof ihrer Schule tauchten vor ihr auf. Wie sie dort saß – auf dem Holzrand des Sandkastens in der hinteren Ecke des Schulhofs – und die stellvertretende Klassenlehrerin, gleichzeitig Vertrauenslehrerin der Schule, vor ihr stand und auf sie herabsah.
Sie erinnerte sich noch genau an ihre Panik, während sie versuchte, nach außen ganz ruhig und gefasst zu wirken. Immer wieder die gleichen panischen Versuche einzuordnen, wie sie in eine bestimmte Situation geraten war. Immer wieder die gleichen Fragen, über die sie sich den Kopf zerbrach.
Was um Himmels willen ist geschehen?
»Hannelore, vielleicht möchtest du ein paar Broschüren mitnehmen?« Ein auffordernder Blick – vielleicht war er auch ermutigend gemeint – traf Hannah, und gegen die innere, ihr schon vertraute wilde Verzweiflung ankämpfend sah sie der Lehrerin voll ins Gesicht.
»Wirklich, Frau Liesban. Es ist nichts. Es ist … es ist alles in Ordnung. Ich … ich komme ganz gut klar. Ehrlich. Es besteht bestimmt kein Grund zur Besorgnis.«
Trotzdem hatte Hannah dann einen Stapel Broschüren in ihrem Rucksack verstaut. Wohl eher, damit Frau Liesban sie mit weiteren Fragen verschonte, auf die Hannah sowieso keine Antwort gewusst hätte.
Zu Hause hatte sie die Telefonnummern mehrerer Mädchenhäuser auf einen Zettel geschrieben und den Zettel in ihrem Portemonnaie verstaut. Vorsichtshalber, hatte sie gedacht, ein wenig erstaunt über ihr Handeln zwar, aber na ja. Sie verstand halt nicht immer, was sie tat und warum.
Und hier stand sie nun. In irgendeiner Telefonzelle, hundertfünfzig Kilometer von zu Hause entfernt. Mit dem Rest des Zettels in der Hand, auf dem nur noch die Nummer des Mädchenhauses dieser Stadt übrig geblieben war. Die anderen Nummern hatte sie abgerissen und in einem Gully versenkt.
Sie sah sich die Nummer an. Eine einfache, eine völlig harmlose Telefonnummer. Trotzdem spürte sie ihren Puls rasen wie nach einem Tausend-Meter-Lauf.
Oh Gott, was tue ich hier nur? Verzweifelt sah sie durch das regennasse Zellenglas in das unergründliche Dunkel draußen.
Die kennen mich doch gar nicht. Die werden mich einfach für verrückt erklären.
»Du willst doch immer nur im Mittelpunkt stehen. Hör auf, dir ständig diese abgedrehten Geschichten auszudenken und damit alle Leute verrückt zu machen, die mit Sicherheit Besseres zu tun haben, als sich mit deinen Hirngespinsten zu befassen«, hörte sie die warnende Stimme der Mutter in ihrem Kopf und ließ mutlos die Hand mit dem Hörer sinken.
Wer weiß, vielleicht hatte die Mutter ja Recht. Was konnte sie, Hannah, denen vom Mädchenhaus schon erzählen? Ja, was eigentlich? Erneut stieg Panik in ihr auf, und ein abgrundtiefes Gefühl von Sinnlosigkeit sprang sie aus dem Dunkel der Großstadt an.
»Trotzdem. Ich kann nicht zurück. Ich habe keine andere Wahl«, sprach sie sich selbst Mut zu. »Ich muss es einfach tun. Ich muss. Seit Tagen denke ich an nichts anderes mehr. Schließlich bin ich doch abgehauen von zu Hause! Ich habe es doch tagelang geplant. Nachdem …« Hannah schrie erschrocken auf.
Nein, nein, ich will das gar nicht wissen. Nein, ich … ich kann das nicht. Ich will das nicht. »Verdammt, Hannah, jetzt reiß dich endlich zusammen«, sagte sie schließlich wütend.
Sie nahm den Telefonhörer wieder fest in die Hand. Hielt ihn an ihr Ohr. Sah sich die Nummer auf dem zerrissenen Zettel an und wählte sie langsam und konzentriert Ziffer für Ziffer.
Sie hörte das Klingelzeichen. Einmal, zweimal – es würde niemand rangehen, es würde niemand da sein. Immer war es so. Niemand erreichbar …
Sie hörte, wie der Anrufbeantworter sich einschaltete und eine Frauenstimme sagte: »Hallo. Du bist verbunden mit dem Notruf für Mädchen. Im Moment können wir leider nicht ans Telefon gehen. Du kannst es in einer halben Stunde noch einmal versuchen. Nach dem Signalton besteht auch die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen. Wir rufen zurück, sobald der AB abgehört wird.«
Sie hörte die Pause, dann den Signalton, dann nichts mehr.
Die Gedanken überschlugen sich in ihrem Kopf. Sie hatte plötzlich wieder Angst vor ihrer eigenen Stimme. Auch das kannte sie schon. Diese Angst, die Kontrolle zu verlieren …
Sie sah den Regen draußen an der Scheibe hinunterlaufen. Sie hörte das Schlagen der Elternhaustür in ihrem Kopf. Wie einen Pistolenschuss. Dann Leere.
Ich muss etwas sagen, dachte sie verzweifelt. Das Band würde zu Ende sein, bevor sie etwas gesagt hätte. Und dann? Sie würde die Nummer verlieren. Sie wusste, sie konnte nicht mehr nach Hause zurück. Es war unmöglich. Unmöglich.
»Hallo«, hörte sie sich sagen und erschrak tatsächlich vor ihrer Stimme. »Ich brauche Hilfe, ich weiß nicht, wohin, ich … man kann mich nicht anrufen. Ich bin in einer Telefonzelle, ich habe keine Uhr. Eine halbe Stunde, ich weiß nicht, wie lange das ist. Ich habe kein Geld, ich weiß nicht …«
Das Band brach ab und sie ließ den Hörer fallen. Ihr wurde schwarz vor Augen und die Umgebung verschwamm mehr und mehr vor ihrem Blick. Sie taumelte innerlich zurück. Immer weiter und weiter und weiter.
Etwas benommen versuchte ein Junge, sich zu orientieren.
Aha, kombinierte er. Telefonzelle! Großstadt! Sehr gut!
Er sah den Hörer am Kabel gleichmäßig hin und her schwingen. Ein Telefongespräch hatte wohl nicht stattgefunden, sonst stünde er nicht hier.
Und jetzt? Würden sie Hannah zu Hause schon vermissen? Würden sie bereits nach ihr suchen?
Er lachte. Arschlöcher, alle, dachte er und gab der Telefonzellentür einen heftigen Tritt. Dann eben nicht. Ich komm auch ohne die klar. Sozialarbeiter! Lächerlich.
Der Regen hatte etwas nachgelassen und er versuchte herauszufinden, wo genau er inzwischen gelandet war.
Gut hat sie das hinbekommen mit dem Abhauen, dachte John zufrieden und warf noch einen letzten Blick zurück auf die Telefonzelle, bevor er sich zum Gehen wandte. Und sie ist tatsächlich hier angekommen. Geil! Dann kann das Abenteuer Großstadt ja beginnen.
In dieser Stadt war er nur einmal gewesen, während einer Schülerdemo gegen irgendetwas, woran er sich nicht mehr erinnern konnte.
Lehrer, dachte er verächtlich. Als hätten die mir jemals etwas beibringen können. Jedenfalls nicht auf meiner Schule …
Er sah einen Polizeiwagen an der nächsten Straßenecke und dachte: Scheiße, Scheiße, die suchen mich bestimmt schon überall!
Er warf kurz einen Blick in alle Richtungen und lief los. Er bog zweimal rechts, einige Male links ab. Er lief immer weiter, ohne ein klares Ziel vor Augen. Er ließ sich einfach von seiner Intuition leiten. Irgendwann würde schon irgendetwas passieren. Das war bisher nie anders gewesen. Er musste nur lange genug weitergehen und nicht aufgeben.
John dachte an den Abend zurück, über den Hannah eben in der Telefonzelle nicht hatte nachdenken wollen. Er fand es richtig, dass sie sich damit nicht weiter belastete. Dafür gab es schließlich andere. Ihn zum Beispiel, der sich von seinem Vater nichts gefallen ließ.
Na ja, okay, für ihn war das auch nicht so schwierig wie für die Mädchen. Auf ihn hatte der Vater fast immer gut reagiert. Kumpelhaft eben, wie es sein sollte zwischen Vater und Sohn. Kein Problem also. Eine Menge hatte John von ihm gelernt. Lauter praktische Handwerkssachen, die ihm ganz sicher von Nutzen sein würden. Erklären, das konnte sein Vater wirklich erstklassig. Besser als jeder Lehrer, der ihm bislang begegnet war.
Aber an diesem Abend war er zu weit gegangen. Er hatte ihn, John, geschlagen. Nein, nicht nur einmal mit der flachen Hand. Immer wieder mit der Faust ins Gesicht. Der Alte war regelrecht ausgerastet. Warum, das wusste John nicht, und niemand von den Anderen hatte es ihm erzählt.
Aber in der Nacht war die Entscheidung gefallen. Hannah musste abhauen. Es wurde jetzt lebensgefährlich für sie alle. Wenn der Vater sogar vor ihm, John, den Respekt verloren hatte, dann hatte niemand mehr etwas zu lachen.
Hannah war für die Flucht am besten geeignet. Weil sie als Einzige keine Ahnung hatte. Sie wusste einfach nichts. Nichts von den Gefahren. Nichts von der Geschichte.
So hatten sie es beschlossen. In ihrer Panik. Nach diesem 15. Geburtstag, der eigentlich keine andere Entscheidung mehr offen gelassen hatte. Wenn jemand es schaffen konnte, alles noch irgendwie zum Guten zu wenden, dann nur jemand, der nichts von dem wusste, was vorher war. Ja, und seitdem also gab es Hannah.
Und – er hatte Recht behalten. Sie hatten es wirklich geschafft. Kluges Mädchen, dachte er erleichtert und sah sich in der Straße um.
Diese Stadt ist so groß, dass sie mich nicht finden werden. Der Gedanke erfüllte ihn mit Zuversicht. Die Gegend gefiel ihm. Alte, hell und gemütlich beleuchtete Häuser. Junge Leute mit Kindern auf den Bürgersteigen. Ein nettes kleines Café an der Straßenecke. Ein Trödelladen neben einem Antiquariat. Ein Bäcker gegenüber auf der anderen Straßenseite.
Hier ist es gut, dachte John. Ab hier kann Hannah weitermachen. Er ließ seinen Blick noch einmal durch die Straße wandern und schloss dann die Augen.
Im Laufen hatte sie Mühe, ihre Gedanken zu sortieren. Geld hatte sie keins mehr und sie kannte keinen Menschen in dieser lauten, unfreundlichen Stadt.
Vielleicht war es doch keine so gute Idee, hierher zu flüchten. Vielleicht hat mich die Mutter von Stephanie ja angelogen und es stimmt überhaupt nicht, dass sie einem Mädchen beim Notruf helfen. Und außerdem, überlegte sie weiter, was hatte die Mutter von Stephanie überhaupt für eine Ahnung. Selbst wenn sie bis vor eineinhalb Jahren wirklich in München gelebt hatte, was wusste sie schon davon, wer einem Mädchen in einem ganz anderen Teil von Deutschland helfen würde? Und da, wo sie selbst herkam, da gab es zwar ein Jugendamt, aber nicht für solche Mädchen wie sie. Ein Mädchen aus guten Verhältnissen, wie es so schön heißt.
Hannah hörte ein höhnisches Lachen hinter sich und drehte sich erschrocken um. Aber … da war niemand. Verwirrt schüttelte sie den Kopf.
Nein, solche Mädchen wie sie hatten auf dem Jugendamt nichts verloren.
Während Hannah immer weiter und weiter ging, suchte sie in ihrem Kopf nach vernünftigen und vor allem triftigen Gründen, weshalb sie von zu Hause weggelaufen war. Scheiße, ihr fiel nichts ein!
Ihr Vater, stellvertretender Schuldirektor am Gymnasium, war ein angesehener Mann und die Leute liebten ihn geradezu. Erst im letzten Jahr war er vom Bürgermeister für seine Verdienste im Bereich der Freizeitpädagogik ausgezeichnet worden.
Und ihre Mutter? Sie arbeitete seit einiger Zeit wohl wieder in ihrem Beruf als Heimerzieherin.
Nur vage erinnerte sich Hannah an die Zeit vor ihrem fünfzehnten Lebensjahr. Nein, eigentlich konnte sie sich an diese Zeit überhaupt nicht erinnern.
Sie erinnerte sich nicht an eine Mutter, die zu Hause auf die Kinder wartete, die aus der Schule heimkamen und ein warmes Mittagessen bekamen. Sie erinnerte sich lediglich an eine Frau, die ihr fremd erschien, mit der sie nichts anfangen konnte und die behauptete, ihre Mutter zu sein.
Hannah zuckte die Achseln. Was bedeutete das schon? Mutter?
Mit ihrem Vater, da war es schon anders. Manchmal nahm er sie am Wochenende in seinem Mercedes mit an einen See, weit weg von zu Hause. Ein wunderschöner See mit tiefblauem Wasser mitten in einem Naturschutzgebiet, wo er eine Jagdhütte besaß.
Aber er jagte dort nicht.
Ein leises Weinen irgendwo in ihrem Innern ließ Hannah zusammenzucken und stumm wischte sie sich die Tränen aus dem Gesicht, die heiß über ihre Wangen liefen, ohne dass sie sich traurig fühlte. Nur ein wenig beklommen, aber weshalb konnte sie nicht sagen.
Sie liebte den See und sie liebte es, dort mit ihrem Vater stundenlang am Ufer zu sitzen und zu angeln. Dann erfüllte es sie manchmal plötzlich mit Stolz, dem stellvertretenden Schuldirektor ihres Gymnasiums so nah zu sein. So nah, dass sie ihn in der Nacht sogar schnarchen hören konnte.
Also, fasste Hannah ihre Gedanken entschlossen zusammen. Was? Was hätte ich dem Jugendamt sagen sollen? Die stumme Frage hallte endlos in ihrem Kopf wider, und verwirrt hielt sie im Laufen inne.
Ja, es hatte so etwas wie einen Termin beim Jugendamt gegeben. Hannah dachte mit tiefer Scham an ihren Besuch dort zurück. Wie peinlich es ihr gewesen war, als sie plötzlich nicht mehr sagen konnte, weshalb sie eigentlich gekommen war. Und die Frau vom Jugendamt war offensichtlich vollkommen verwirrt gewesen. Sie hatte tausend Fragen gestellt, auf die Hannah keine Antwort wusste.
Kurz nach ihrem 15. Geburtstag musste das gewesen sein. Also ungefähr vor einem halben Jahr. Sie wusste es nicht mehr genau.
Sie ertappte sich immer wieder dabei, wie sie versuchte, Ereignisse zeitlich zuzuordnen. Es versetzte sie in Panik, wenn sie das Gefühl bekam, den Überblick über die Zeit zu verlieren. Sie verbrachte manchmal Stunden damit, mühsam zusammenzusetzen, was wann in ihrem Alltag geschehen war, und sie fühlte sich erst wieder sicher, wenn es ihr gelungen war, einen Tag zeitlich ohne Lücken zu rekonstruieren.
Manchmal, wenn jemand so etwas sagte wie: »Meine Güte, die Zeit ist ja wieder wie im Flug vergangen«, fühlte sie sich für einen Moment erleichtert. Offensichtlich kannten auch andere Menschen dieses Phänomen mit der Zeit, die manchmal verschwunden ist. Einfach so. Und wenn es andere auch kannten, dann war mit ihr vielleicht doch alles in Ordnung?
Ja, jedenfalls war er kurz nach ihrem 15. Geburtstag gewesen, dieser Besuch beim Jugendamt, an den sie sich nicht wirklich erinnern konnte. Nur an dieses peinliche Ende, wo sie am liebsten im Erdboden versunken wäre.
Aber ihr Tagebuch erzählte mehr davon, was beim Jugendamt Thema gewesen war. Sie hatte es eingesteckt, gestern Morgen, zu dem anderen Fluchtgepäck. Ein komisches Tagebuch. Beim Lesen übersprang sie oft ganze Seiten. So auch jene Seiten, die angefangen hatten mit: »Heute Nachmittag war ich beim Jugendamt …«
In diesem Tagebuch gab es so viele Sätze, mit denen Hannah nichts anfangen konnte. In einer steilen, nach links geneigten schmalen Schrift, die ihr fremd erschien, die sie aber auch aus ihren Deutschaufsätzen kannte. Und in anderen Schriften, manchmal sogar in anderen Farben. Bunt und verwirrend insgesamt. Hannah wollte nicht darüber nachdenken. Nein, lieber nicht.
Nun ja, sann sie. Die anderen in der Klasse hatten wahrscheinlich Recht. Sie war anders. Seltsam. Leicht bis mittelschwer durchgeknallt. Verhaltensgestört, wie ihr Onkel meinte, der Kinder- und Jugendtherapeut war und so was dann ja wohl beurteilen konnte.
Und obwohl Hannah eigentlich nichts mehr von ihrem Besuch beim Jugendamt wusste, war sie sich sicher gewesen, dort nichts erzählt zu haben. Was auch? Es gab ja wohl nichts, was einer Dame vom Jugendamt irgendwie gefährlich vorkommen konnte.
Und dann war die Dame vom Jugendamt zu einem Hausbesuch gekommen, weil sie den Bericht der Jugendlichen besorgniserregend gefunden hatte, wie sie sagte. Hannah wäre damals erneut am liebsten im Erdboden verschwunden.
Zwei Wochen war das jetzt her. Zwei Wochen, die ihr erschienen waren wie eine Ewigkeit. Während sie weitergrübelte, nahm sie ihren Weg durch die Straßen der Stadt wieder auf.
»Ja, ja, meine Tochter hatte schon immer ein bisschen zu viel Phantasie. Sie will etwas Besonderes sein und ständig im Mittelpunkt stehen. Ihr Onkel schenkt ihr, glaube ich, einfach zu viele Kriminalgeschichten.«
Die Frau vom Jugendamt hörte geduldig zu. Weder sie noch ihre Mutter schienen die Anwesenheit der Tochter überhaupt zu bemerken. Auch wenn die Frau vom Jugendamt ab und zu verwunderte Blicke in ihre Richtung warf.
Aber Hannah blieb stumm wie ein Fisch. Ja, genau so fühlte sie sich. Wie ein Fisch hinter einem dicken Panzerglas, der nicht sprechen kann und den sowieso niemand hören könnte, selbst wenn er Worte finden sollte. Das Wasser war viel zu tief …
»Hannelore, würdest du Frau Krebs und mir noch einen Kaffe kochen«, wandte sich die Mutter an sie, die jetzt wohl die wohlerzogene Tochter spielen sollte. Daran sollte es nicht scheitern! Sie war sofort aus dem Wohnzimmer und in die Küche gestürzt.
Eine ihr völlig unvertraute Wut hatte sie plötzlich gepackt und sie versuchte erschrocken, sich wieder in den Griff zu bekommen. Stattdessen verbrühte sie sich beim Kaffeekochen die rechte Hand.
Die Mutter sah es, als sie eine viertel Stunde später den Kaffee in die kleinen goldumrandeten Kaffeetassen goss, und zeigte der Frau vom Jugendamt die Verbrennung. »Da sehen Sie selbst. Meine Tochter fügt sich alle ihre Wunden selbst zu. Sie ist einfach ungeschickt und sie wollte schon immer von zu Hause weg.«
Dann sah die Mutter Hannah an. »Nicht wahr, Hannelore? Dein Elternhaus ist dir nicht gut genug. Du denkst, du hast was Besseres verdient. Aber glaube mir, du kannst froh sein, keine Eltern zu haben, die dich schlagen und zu Hause einsperren. Was man da heutzutage alles in der Zeitung liest. – Möchten Sie noch einen Kaffee?«, fragte die Mutter freundlich und wandte sich wieder der Frau vom Jugendamt zu.
»Ach, nein danke«, antwortete die Frau, und zu Hannah gewandt: »Ich habe gehört, du hast Schwierigkeiten in der Schule? Du hast in der letzten Zeit häufiger den Unterricht geschwänzt und mit deinem Fahrrad schon mehrere Unfälle verursacht. Woran liegt denn das, Hannelore? Was ist los mit dir?« Erwartungsvoll sah sie Hannah an.
In Hannahs Kopf formten sich Worte, Sätze, Gedankenfetzen. Eine wilde Verzweiflung und der Wunsch laut zu schreien und der Mutter zu widersprechen. Aber nichts von alldem konnte die dicke Panzerglasscheibe durchbrechen, und wie von einem anderen Planeten aus sah Hannah der Frau vom Jugendamt ins Gesicht.
»Stimmt das? Du bist ohne Führerschein mit dem Klasse-1-Motorrad deines Bruders durch die Gegend gefahren? Warum, Hannelore?« Die Frau beugte sich zu ihr vor. Sie sah verwirrt und ein wenig beunruhigt aus.
»Willst du jetzt nicht mehr mit mir reden?«, fragte sie dann und musterte Hannah aufmerksam.
Hannah schüttelte stumm den Kopf. Sie hörte einen lauten Knall, mit dem sich ein Sargdeckel über ihr schloss.
Von sehr weit weg sah sie noch, wie sich die Mutter und die Frau freundlich voneinander verabschiedeten und die Mutter der Sozialarbeiterin für ihre Bemühungen dankte und sich gleichzeitig dafür entschuldigte, dass sie wegen Hannah so viel unnötige Arbeit gehabt habe.
Wie gesagt. Das war kurz nach ihrem 15. Geburtstag passiert. Mehr fiel ihr nicht ein.
Ich muss sofort etwas essen, dachte Hannah unvermittelt. Ich verhungere sonst noch mitten auf dieser elenden Straße. Und zwar noch heute Nacht, wenn ich nicht vorher erfroren bin.
Im gleichen Augenblick erregte ein Laden an der Ecke Hannahs Aufmerksamkeit. Es war eine Buchhandlung mit vielen Plakaten an den Schaufenstern. Da war sie wieder, diese Telefonnummer.
Komisch, dachte sie, während sie in ihrer Jackentasche und dann noch mal in ihren Jeanstaschen kramte, ich hab die Nummer echt in der Zelle liegen lassen.
Sie sah sich das Plakat genau an. Ja, da stand es. Genau so, wie es die Mutter von Stephanie ihr erzählt hatte. In großen bunten Buchstaben stand es dort auf dem Plakat.
Hallo!
Willst du weg von zu Hause? Hältst du es dort nicht mehr aus? Suchst du einen Raum, in dem du sicher bist und dir jemand zuhört? Wo du in Ruhe darüber nachdenken kannst, was du selber willst? Und wo du über deine Sorgen reden kannst? Weißt du nicht mehr wohin? Hast du Angst und brauchst Hilfe? Einen Schlafplatz, etwas zu essen? Dann ruf uns an. Wir sind Frauen, die Mädchen in Notlagen unterstützen. Wir beraten dich, und wenn du willst, dann kannst du auch eine Zeit lang bei uns wohnen, bis du für dich eine Lösung gefunden hast.
Mädchenhaus
Die Telefonnummer wurde dann noch einmal in großen roten Zahlen wiederholt. Hannah fand nichts zu schreiben. Na ja, dachte sie, ich habe sowieso kein Geld mehr. Die Telefonkarte hatte sie auch in der Zelle vergessen. Verzweiflung stieg langsam in ihr auf und sie spürte den Kloß im Hals so deutlich, dass sie glaubte, daran zu ersticken.
Die Tür des Ladens öffnete sich und Hannah trat erschrocken einen Schritt zur Seite. »Tschüß, Janne, dann bis übermorgen«, hörte sie eine Frauenstimme direkt vor sich und ehe sie richtig mitbekam, was geschah, lag sie schon auf dem Boden.
»Oh Scheiße, das tut mir Leid, ich hab dich überhaupt nicht gesehen. Hast du dir wehgetan?« Ein besorgtes Gesicht beugte sich über sie. »Komm, ich helfe dir aufstehen«, sagte die Stimme, und eine Hand wurde ihr entgegengestreckt.
»Geht schon«, murmelte Hannah ohne aufzublicken.
»Mensch, du bist ja total nass«, sagte die Frau. »Willst du nicht einen Moment reinkommen?«
Hannah nickte. Ihr fiel sowieso nichts Besseres ein, außerdem spürte sie plötzlich, dass ihr Knie wehtat und ihr bei dem Sturz offensichtlich doch etwas passiert war.
»Hey«, hörte sie eine andere Stimme, die von Janne, wie sie später erfuhr, »ich hätte nicht gedacht, dass ich dich so schnell wiedersehe.« Und dann, nach einer Pause: »Was ist denn passiert?«
»Ich habe vor der Tür ein Mädchen umgerannt. Ich glaube, sie hat sich verletzt«, antwortete die Frau. »Ich heiße übrigens Marissa, es tut mir echt Leid. Kann ich irgendwas tun? Setz dich doch erst mal. Dein Knie blutet ja. Scheiße«, sagte sie noch einmal, und Hannah setzte sich auf den angebotenen Stuhl.
»Sag mal, wohnst du hier irgendwo in der Nähe?«, fragte Janne, die hinter dem Ladentisch hervorgekommen war. »Du bist ja ganz nass. Ich könnte dich nach Hause bringen.«
Hannah riss erschrocken die Augen auf. Sie schrie es fast. »Nein, nein, bloß nicht. Ich … ich komm schon alleine klar. Lasst mich doch einfach in Ruhe.« Entsetzt über ihren Ausbruch hielt Hannah sich unwillkürlich den Mund zu.
Janne und Marissa sahen sich an. »Ich bring dir ’nen Kaffee. Oder willst du lieber Tee?«, fragte Janne und sah Hannah nun direkt an.
Sie sieht irgendwie nett aus, dachte Hannah erleichtert und sagte: »Ein Kaffee wäre toll.«
»Meinst du, ich kann jetzt gehen?«, fragte Marissa und Janne nickte.
»Na klar, kein Problem«, und mit einem Ich-schaff-das-schon-Blick wies Janne zur Ladentür.
Dann saßen sie sich schweigend gegenüber, und Hannah fühlte sich immer unbehaglicher.
»Was ist denn das hier für ein Laden?«, fragte sie in die Stille, als sie den ersten Schluck Kaffee getrunken hatte.
»Das ist ein Frauenbuchladen.«
»Wie?«, meinte Hannah und sah Janne neugierig an.
»Na ja«, begann Janne, »hier kommen nur Frauen hin und kaufen Bücher, die von Frauen geschrieben sind. Männer dürfen hier nicht rein, und Bücher, die von Männern geschrieben sind, verkaufen wir auch nicht.«
»Und wieso nicht?«, fragte Hannah weiter, froh, dass Janne ihren Ausbruch offensichtlich gar nicht richtig mitbekommen hatte.
»Viele Frauen haben festgestellt, dass sie sich an Orten, wo keine Männer sind, oft wohler fühlen und dort ihre Ruhe haben. Und dann sind Frauenzentren entstanden und eben auch Frauenbuchläden.«
»Und die Mädchen?« Hannah entspannte sich etwas. Ihr gefiel der warme, gemütliche Buchladen. Und der Kaffee schmeckte gut.
»Mädchenbücher haben wir auch. Und ein paar Häuserblocks weiter gibt es ein Mädchencafé.«
»Draußen hängt ein Plakat«, meinte Hannah und musterte Janne vorsichtig. »Da steht was drauf von ’nem Mädchenhaus.«
Janne nickte zustimmend und setze sich auf einen zweiten Stuhl. Sie steckte sich eine Zigarette an. »Willst du auch eine?«
Hannah musste lächeln. »Ich bin noch keine sechzehn«, sagte sie.
»Na und, manche Mädchen rauchen schon mit zehn, und du sitzt schließlich nicht hier, weil ich dich erziehen soll, oder?«
»Nee, natürlich nicht. Ich lass mich sowieso von niemand erziehen.« Hannah sah ein wenig kampflustig aus.
»Interessierst du dich für das Mädchenhaus?«, fragte Janne.
»Ist doch für Mädchen, oder?«, konterte Hannah.
»Ja, ist für Mädchen.« Janne schwieg eine Weile, dann sagte sie: »Das wäre klasse gewesen, wenn es so was schon vor zehn Jahren gegeben hätte. Einen Ort, wo man hinkann, wenn man es zu Hause nicht mehr aushält.«
»Wieso, sind deine Eltern gemein zu dir gewesen?«
»Ich finde«, sagte Janne, »für die Aufnahme im Mädchenhaus hätte es auf jeden Fall gereicht.«
Hannah hatte mehr als interessiert zugehört. Wer weiß, Janne schien nicht zu den Erwachsenen zu gehören, die Mädchen sowieso nicht ernst nahmen. Vielleicht konnte sie ihr sogar weiterhelfen.
»Was muss denn zu Hause passiert sein, um ins Mädchenhaus zu kommen?« Hannahs Herz klopfte wild. Sie hoffte sehr, dass ihre Frage zwar nach Interesse, aber gleichzeitig wie beiläufig klang.
Janne überlegte einen Moment, als müsste sie nach den richtigen Worten erst suchen. »Also«, sie zögerte, »Mädchen, die zu Hause geschlagen werden, können ins Mädchenhaus gehen. Auch, wenn Mädchen einfach Angst vor ihren Eltern haben und das nicht so richtig erklären können. Wenn die Eltern den Mädchen ständig alles verbieten und sie sich nie mit ihren Freundinnen und Freunden treffen dürfen oder nie raus dürfen am Wochenende in die Disco oder ins Jugendheim. Wenn sie zu Hause ständig oder überhaupt bestraft werden.«
»Und«, fragte Hannah, »wie beweisen die Mädchen das dann?«
»Also beweisen«, überlegte Janne, »beweisen müssen sie das nicht. Ist doch klar, dass kein Mädchen ohne Grund von zu Hause wegläuft. Nur Mädchen, denen es schlecht geht, kommen überhaupt auf die Idee, ins Mädchenhaus zu gehen.«
Janne sah Hannah an. »Du kannst ruhig deine nassen Klamotten ausziehen und da drüben über die Heizung hängen. Ich glaube, vom Frauenflohmarkt letzte Woche steht da drüben noch eine große Kleiderkiste. Vielleicht passt dir ja was davon.«
Hannah sah Janne überrascht an. »Du brauchst überhaupt nicht zu denken, mit mir wär irgendwie was. Ich hab bloß grade keine Lust, nach Hause zu gehen. Sonst nix.«
»Ist okay«, sagte Janne. »Ich dachte nur, vielleicht schmeckt dir der Kaffee besser, wenn du was Trockenes anhast. Die Sachen liegen hier eh nur rum. Die gehören niemandem mehr. Sind auch ein paar Sachen von mir dabei. Die Hosen wären dir vielleicht einen Tick zu groß, aber sonst – ich bin nicht viel größer als du. Und ich würde mich freuen, wenn dir was davon gefällt.«
»Wieso?«, wollte Hannah wissen.
»Ich mag dich irgendwie. Ich glaube deswegen«, sagte Janne. Hannah musterte sie mit zweifelndem Blick und Janne schien es zu bemerken, denn sie fügte hinzu: »Ich finde es einfach gut, was du mich alles fragst. Es gefällt mir, wenn Mädchen ihren eigenen Kopf haben. Und genau so kommst du mir vor.«
Janne sah auf, als eine Frau den Laden betrat. Fast entschuldigend sagte sie: »Meine Pause ist offensichtlich zu Ende. Du kannst einfach hier bleiben und dich umgucken, solange du willst. Dir noch Kaffee kochen. Und wie gesagt, die Kleiderkiste steht rechts in der kleinen Küche in der Ecke.«
Janne begrüßte die Frau und setzte sich hinter den Ladentisch. Sie schien Hannah nicht mehr weiter zu beachten. Das war Hannah nur recht.
Sie ging in die Küche, die einen gelben Boden hatte. Irgendjemand hatte Wellen in bestimmt zwanzig verschiedenen Blautönen an die Wände gemalt. Hannah gefiel die Küche. Sie setzte neues Kaffeewasser auf und suchte die Kleiderkiste.
»Wow!« Anerkennend pfiff sie durch die Zähne. »Das sind ja tolle Klamotten.«
Sie fand vier Jeans, die ihr einigermaßen passten und die tolle Farben hatten. Sie suchte sich mehrere T-Shirts und drei Sweatshirts aus. In einen bordeauxroten Nicki verliebte sie sich sofort, und sie beschloss, einen blauschwarz gestreiften Pullover, den Nicki und eine grünschwarz gestreifte Jeans gleich anzuziehen.
»Du, Janne, habt ihr vielleicht zufällig auch eine Dusche?«
»Ja, zufällig ist eine Dusche im kleinen Bad neben der Küche. Brauchst du sonst noch irgendwas?«
Hannah schüttelte den Kopf, trug die neuen Anziehsachen wie einen Schatz ins Bad und duschte fast eine halbe Stunde lang heiß. Sie fand Shampoo und Duschgel und mehrere große, warme, bunte Frottehandtücher, und ihre Laune besserte sich mit jeder Minute, die sie in dem Laden verbrachte. Die neuen Sachen passten ihr eigentlich ganz gut.
Gut, dass Janne so klein ist, dachte sie und verteilte ihre nassen Sachen auf den verschiedenen Heizkörpern im Laden. Ihre kurzen Haare trockneten schnell. Hannah hatte plötzlich das Gefühl, unendlich viel Zeit zu haben. Sie setzte den Wasserkocher erneut auf, weil das Wasser für den Kaffee mittlerweile nur noch lauwarm war, sang, ohne es zu merken, eine Melodie vor sich hin und bot Janne schließlich einen frisch aufgebrühten Kaffee an.
»Die Sachen stehen dir echt gut«, sagte Janne bewundernd. »Ich mach übrigens in einer halben Stunde den Laden zu.« Prüfend sah sie Hannah an. »Wenn du willst, kannst du deine Sachen über Nacht hier lassen. Morgen sind sie bestimmt trocken, dann kannst du sie wieder abholen.«
Hannah erschrak. Daran hatte sie überhaupt nicht gedacht. Dass der Laden schließen könnte. Dass Janne bestimmt was Besseres zu tun hatte, als sich den Rest ihres Lebens mit ihr zu unterhalten.
Scheiße, was mach ich denn jetzt?, überlegte sie fieberhaft. Hannah war den Tränen nah, schluckte sie aber verbissen hinunter. Mir wird schon was einfallen, und fast trotzig sah sie Janne an.
Janne beobachtete Hannah und räusperte sich. »Du, darf ich dich mal was fragen?«
Hannah ließ sich nicht anmerken, ob sie damit einverstanden war. Sie fühlte sich in absoluter Hochspannung und unmittelbar bedroht. Als sie Janne nur schweigend anstarrte, fuhr Janne fort.
»Ich habe den Eindruck, als wäre es vielleicht eine gute Idee, im Mädchenhaus anzurufen. Wenn du das willst, dann kannst du das Telefon da vorne benutzen. Du kannst auch mein Handy haben und in der Küche telefonieren, wenn du lieber deine Ruhe haben willst.«
»Wieso soll ich da anrufen?«, fragte Hannah und fühlte sich elend. Ihre Panik stieg.
»Ich dachte, falls du nicht weißt wohin, wäre das vielleicht ein guter Ort.« Janne sah sie unsicher an. »Ich … es war nur so ein Gefühl. Als ob du im Moment keinen Ort hättest, wo du hinkannst.« Und weil Hannah immer noch nicht reagierte, fügte sie hinzu: »Ich kann mich ja auch irren.«
Hannah hörte wieder diesen Knall. Und spürte den Sargdeckel, der sich über ihr schloss.
Jemand sprang auf. Jemand, der nicht mehr Hannah war. Jemand, der ziemlich wütend war. Nur wütend und sonst gar nichts. Ihre Augen funkelten.
»Ach, was wissen Sie denn schon«, schrie sie. »Was soll ich denen denn erzählen? Meinen Sie vielleicht, mir glaubt jemand auch nur ein einziges Wort? Mir hat noch nie irgendjemand irgendwas geglaubt. Und Sie, Sie wollen mich doch auch bloß so schnell wie möglich wieder loswerden. Ich … ich kann denen nix erzählen. Ich … ich weiß einfach nichts … Ich kann nicht so tolle Worte machen wie Sie. Ich …«
Dezember brach ab. Wieso stand sie in diesem komischen Zimmer einer wildfremden Frau gegenüber? Was war jetzt bloß wieder passiert? Und wieso fragte die sie aus? War das etwa wieder so eine vom Jugendamt? Sie zitterte. In ihrer Wut hatte sie einen Stuhl umgerissen, der direkt hinter ihr stand. Tränen rannen ihr die Wangen hinunter, sie schmeckten salzig. Mit den Augen suchte sie die Tür. Ihr fiel ein, dass sie bestimmt eine Jacke getragen hatte und dass die noch irgendwo sein musste. Scheiße. Und so was wie einen Rucksack oder eine Tasche hatten sie normalerweise auch immer bei sich. Aber das war eigentlich auch egal. Die Frau sah ziemlich erschrocken aus. Sie war ebenfalls aufgesprungen. Ihre Stimme klang laut.
»Du brauchst keine tollen Worte, verdammt. Du sagst denen einfach, dass du da hinwillst. Das ist alles, was du tun musst. Du musst nix beweisen. Dein Gefühl reicht. Wenn du nicht nach Hause willst, dann hast du das Recht, dorthin zu gehen.«
Die Frau setzte sich wieder. Dezember hob den Stuhl auf und stellte ihn an die gleiche Stelle zurück. Sie sah sich in dem Zimmer um, als suche sie nach einem Halt oder einem Wort.
»Da ist niemand«, hörte sie sich sagen und fühlte sich plötzlich sehr klein.
Die Frau sah Dezember einen Moment lang an. Dann sagte sie: »Im Mädchenhaus ist immer jemand, sie sind Tag und Nacht da.«
»Nein. Das stimmt nicht. Jemand von uns hat schon angerufen und es war niemand da.« Sie verstummte entsetzt. Oh nein, dass hätte sie niemals, niemals sagen dürfen. Das hätte ihr nicht herausrutschen dürfen. Sie hatte sich verraten.
Dezember wurde schlagartig schlecht und sie hielt sich krampfhaft an der Stuhllehne fest.
Gut, jetzt hatte sie es also gesagt. Jetzt würde die Frau sie bestimmt rausschmeißen, sie anschreien oder vielleicht sogar … Dezember duckte sich.
»Hey«, hörte die Stimme der Frau, »es tut mir Leid, dass du nicht sofort jemanden erreicht hast. Stimmt, manchmal unternehmen die Frauen etwas mit den Mädchen und sind dann nicht da. Oder sie sprechen gerade mit einem Mädchen und wollen nicht unterbrochen werden. Aber sie sind dann nie lange weg und man kann später noch einmal anrufen.«
»Aber ich soll eine Nummer sagen, wo die mich erreichen können. Ich habe aber keine.« Dezember schwieg.
»Wir könnten zusammen den Laden aufräumen und vorher rufst du im Mädchenhaus an und hinterlässt die Nummer hier. Und wir bleiben so lange hier, bis dich jemand zurückruft. Was hältst du von der Idee?«
Dezember war plötzlich unendlich müde. Sie konnte überhaupt nicht mehr denken. Immer noch drehte sich alles, und ihr wurde noch übler. Sie hörte tausend Stimmen in ihrem Kopf, die ihr unterschiedliche Sachen sagten. Welche, die unglaublich wütend waren. Andere, die einfach lachten, sie auslachten.
»Ich kann nicht mehr«, sagte Dezember und ließ sich auf den Boden fallen.