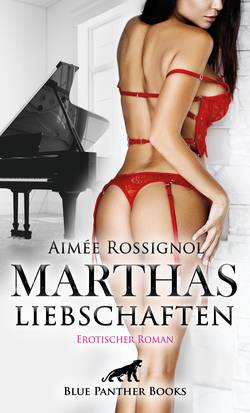Читать книгу Marthas Liebschaften | Erotischer Roman - Aimée Rossignol - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDienstag
Heute ist der Tag, an dem ich »Übermorgen kommt Monsieur Frechat« sagen darf und vielleicht erwache ich deshalb mit klopfendem Herzen und einem unbestimmten Gefühl der Erregung. Als ich die Bettdecke zum Lüften über das Fensterbrett hänge, kommt ein kleiner feuchter Fleck auf dem Laken zum Vorschein. Nachdenklich streiche ich mit dem Finger darüber.
In diesem Bett habe ich mit niemandem bisher geschlafen und verspüre auch nicht die geringste Lust, es mit jemandem zu teilen. Weniger, weil ich es nicht will, als vielmehr, weil ich glaube, dass es niemanden gibt, der ein guter Mitschläfer ist.
Es klingt so leicht: Tisch und Bett teilen. Aber was heißt das denn? Ein schlafender Körper neben sich, der dabei Geräusche macht, atmet, im schlimmsten Fall schnarcht. Ein anderer Mensch, der sich im Schlaf bewegt, sich hin und her wirft, an fremden Decken zieht und Kopfkissen okkupiert, die nicht ihm gehören. Also so war es mit Luc. Schlafen. Ein stundenweiser Zustand, der nur einen kurzen Zeitraum der Nacht andauerte. Meist kam Luc spät zu Bett, lange nach mir. Die Abendstunden gehörten ihm am Flügel, versunken in einer neuen Komposition.
Kurz darauf endete dann allerdings schon meine Nacht, entweder mit klappernden Zähnen, weil er mir meine Bettdecke weggezogen hatte oder mit schlaflosem Wachliegen und dem Lauschen auf sein gurgelndes Atmen.
Als ich das erste Mal seit langer Zeit hier in diesem Bett allein schlief, war ich irritiert von der Stille.
Noch einmal betrachte ich den feuchten Fleck. Leider kann ich mich an den dazugehörigen Traum nicht mehr erinnern. Ich wüsste gern, ob es jemand war, den ich kenne, der mich so erregt hat, oder ein Fremder.
Vielleicht war es der Gedanke an Monsieur Frechat. Irgendjemand an der Académie hat ihn mir damals empfohlen, ich weiß nicht mehr, wer. Er sei gut und schnell. Er würde nicht viel reden, aber er hätte gute Ohren. So oder so ähnlich hat man über ihn gesprochen. Und als er dann vor mir stand, war ich überrascht. Ich hatte jemanden erwartet, wie Lucs Klavierstimmer. Alt, vornübergebeugt, eben jemanden, der so aussieht, als hätte er Blüthner noch persönlich gekannt. Monsieur Frechat dagegen stand groß und aufrecht vor meiner Tür, kaum älter als Vierzig, mit vollen rot-braunen Locken. Über der Schulter eine Tasche aus alter LKW-Plane und die Stirn in sorgenvolle Falten gelegt. Ein kurzes »Bonjour, Madame« und dann hatte er sich schon an mir vorbei den durch den Flur geschoben.
Es war, als hätte er den Flügel riechen können. Zielsicher folgte er allen Ecken und Biegungen meines Flures bis ins Wohnzimmer. Kein »Ach, da ist er ja!« oder »Ah, Madame, ein schönes Instrument!«, nein, nur ein stiller Blick und ein langer breiter Finger, der über das Holz strich.
Ich folgte der Bewegung mit meinen Augen, nur, um dann Monsieur Frechat so unauffällig wie eben möglich zu mustern. Ein kantiges Gesicht, eingerahmt von dunklem Bartschatten, eine grade Nase und schmale Lippen, die er aufeinanderpresste. Ob er schön ist, hatte ich mich gefragt und keine Antwort gefunden. Luc, mit seinen ebenmäßigen Zügen hat ein gefälliges Gesicht, ein breites Lachen, amüsierte Augen. An Monsieur Frechat ist nichts gefällig, nichts leicht und beim Stimmen sieht er so aus, als wäre sein Tun ein Frondienst, den er an der Menschheit ableisten müsste, aber nichts ist, was ihm auch nur im geringsten Freude bereitet.
Trotzdem blieb ich damals im Wohnzimmer. Niemals zuvor habe ich einem Klavierstimmer bei der Arbeit zugesehen, denn außer, dass wir beide dasselbe Instrument bedienen, wenn auch auf unterschiedliche Arten, haben wir doch wenig Berührungspunkte.
Leise setzte ich mich in den alten Ohrensessel neben der Tür und legte die Hände in den Schoß. Falls ihn meine Anwesenheit überraschte, ließ er es sich nicht anmerken. Beinahe stoisch nahm er sein Tun auf, ohne mir Beachtung zu schenken, ohne zu sprechen.
Wer einmal eine Stimmung gehört hat, weiß, dass die Töne, die dem Instrument dabei entlockt werden, nichts mit einem ästhetischen Anspruch an ihre Reihenfolge zu tun haben. Mit anderen Worten, es ist nicht eben ein Vergnügen. Es war also sicher nicht das Klangerlebnis, das mich andächtig in meiner Position verharren ließ, nein, mir war, als hätte ich keine andere Wahl. Mir war, als müsse ich ihm zusehen und den zügigen und geschickten Handgriffen beiwohnen, als wäre es ein Staatsakt, bei dem ich die Ehre hatte, zugegen zu sein.
Um die Mittagszeit schließlich, als die Sonne am höchsten stand und ein kleiner Lichtstrahl sich in seinem Haar fing, trat er einen Schritt zurück.
Kein »ich bin fertig«, kein Wort, kein Blick für mich, nur einen sehr langen Augenaufschlag für das Instrument.
Ich weiß nicht genau, was ich mir dachte, als ich an ihm vorbei auf den Hocker glitt und meine Finger über die Tasten legte. Nicht Chopin, nicht Rachmaninow, nein, ein altes Volkslied spielte sich fast wie von selbst.
»À la claire fontaine«.
Ein Lied über den Verlust der Liebe, über das Nachtrauern und über das Leid. Er legte mir seine Hand auf die Schulter. Seine Hand war schwer wie eine Pranke, schwer wie eine Bärentatze und doch gab mir das Gewicht, das er in diesen Griff legte, eine seltsame Ruhe, das weiß ich noch. Eine Weile verharrten wir so, nachdem der letzte Ton verklungen war. Er roch nach Holz und nach Seife. Als seine Lippen mein Haar berührten, schloss ich die Augen und bog meinen Kopf zurück, bis ich mich gegen seinen warmen Bauch lehnen konnte. Mir war, als müssten wir den nächsten Schritt nicht überlegen, aber ein wenig aufschieben. Fast kam ich mir vor, als wäre ich wieder ein Kind. Ich erinnere mich an das Gefühl der unbestimmten herzklopfenden Vorfreude zu Weihnachten. Dann, wenn die Tür zum Wohnzimmer noch geschlossen war und ich wartete. »Warten auf das Glöckchen« nannte ich diesen Zustand. Fast war ich enttäuscht, wenn mein Großvater dann tatsächlich läutete und meine Mutter die breite Flügeltür öffnete, ein Lächeln auf dem Gesicht. Nur auf dem Weihnachtsbaum brannten Kerzen, sonst war das Zimmer dunkel. Natürlich hatte ich wenig Sinn für die Schönheit und den delikaten Christbaumschmuck. Alles, was zählte, waren die unzähligen kleinen und großen Pakete darunter.
Genauso kam ich mir in meinem Wohnzimmer auch vor. Kurz davor, etwas sehr Kostbares auszuwickeln.
Ich glaube, Monsieur Frechat war es dann, der einen warmen Finger unter mein Kinn schob und meinen Kopf anhob, bevor sich sein großer Körper nach vorn neigte und mich küsste.
Für einige Sekunden lagen unsere Lippen nur aufeinander. Bewegungslos, regungslos. Aber dann war ich diejenige, die den Mund öffnete und von seiner Wärme kostete. Fast schien mir, als würde er Worte in den Mund murmeln.
Er war es, der seine Finger unter meine Bluse schob und ganz sacht über meinen Rücken strich. Eine Berührung, unvermutet zart, die mich erschauern ließ.
Danach war alles anders. Es hätte der Kuss sein können, der alles veränderte, aber er war es nicht. Seine Finger auf meiner Haut beendeten das atemlose Warten, die Stille vor dem Startschuss. Danach war alles Gier und Verlangen. Ich weiß gar nicht mehr, wer wen auszog, aber ich erinnere mich an das Gleiten von Stoff auf meiner Haut, zwischen meinen Fingern. An das Geräusch, als eine Naht riss. Ich glaube, es war sein Hemd.
Unsere Lippen klebten aufeinander, als gäbe es keinen anderen Ort für sie, nur unwillig unterbrochen davon, dass Kleidung über den Kopf gezogen werden musste.
Das Klingeln meines Handys schrillt schonungslos in meine Erinnerungen und ein Blick auf die Uhr sagt mir außerdem, dass es Zeit ist, den Kaffee aufzusetzen. Mit einer Hand halte ich das Smartphone ans Ohr, während ich mit der anderen den Wasserkocher in die Spüle stelle.
»Hallo?«, melde ich mich gedankenlos.
»Madame Pelletier, ich bin es noch einmal, Audric Brunault.«
Ach ja, Audric. Hartnäckig, wirklich hartnäckig, denke ich und hebe den gefüllten Wasserkocher auf seinen Standfuß.
»Ich sagte, nein, Monsieur Brunault, kein Klavierunterricht für Erwachsene.«
»Ach bitte, Madame Pelletier! Sie sind meine einzige Chance!«
Das entlockt mir dann doch ein Lächeln. »Nanu, gibt es seit Neuestem keine Klavierlehrer mehr in Paris außer mir?«
»Nein, nein, Sie verstehen das nicht. Bitte, nur eine Probestunde! Ich zeige Ihnen, dass ich ein großartiger Schüler sein werde. Sie werden es leicht haben mit mir, ich bin eben kein Kind mehr. Ich werde üben!«
Vielleicht ist es der Gedanke an Monsieur Frechat, der mich milde stimmt. Vielleicht kann ich es auch nicht ertragen, dass noch ein Mann, außer Luc an mir zerrt. Ich seufze. »Also schön. Eine Probestunde und das ist kein Ja, verstehen Sie das?«
»Oui, Madame Pelletier! Danke, danke!«
»Heute um sieben. Und bitte pünktlich!«
»Selbstverständlich und danke, danke, danke!«
Ich drücke auf den roten Hörer, gieße den Kaffee auf und summe dabei »À la claire fontaine«.
***
Die vormittäglichen Ballettstunden an der Académie schleppen sich so dahin, unterbrochen von kurzen Pausen, die ich im sonnigen Hof unter der alten Kastanie verbringe. Luc ruft zwei Mal an, aber ich drücke ihn weg. Erst auf dem Heimweg nehme ich seinen Anruf entgegen.
Inzwischen hat sich der Himmel mit dunklen Wolken bezogen und hier und da fällt ein Tropfen auf das Kopfsteinpflaster.
»Ich bin in Eile, Luc, was gibt es?«
»Warum gehst du nicht ran, Martha? Ich könnte sterbend in meiner Wohnung liegen und du drückst meine Anrufe weg!« Lucs Stimme klingt belegt und kratzig. Daher weht der Wind. Er ist krank. Mit einem Schlag bin ich ganz im Hier und Jetzt, bleibe stehen und drücke die Tüte mit dem Baguette, das ich vorhin gekauft habe ein wenig fester an meine Brust. Jetzt gilt es, auf der Hut zu sein.
»Du stirbst aber nicht und ich muss arbeiten.«
»Du musst gar nichts, Martha. Du müsstest nicht arbeiten gehen, wenn du wieder bei mir einziehen würdest. Und ich brauche dich jetzt. Mehr denn je.« Nach einer kurzen Pause fügt er hinzu: »Vielleicht ist es auch nicht mehr für lange.«
Ich sage dazu nichts und hole stattdessen tief Luft.
Luc ist nie krank, er ist sterbenskrank. Eine Erkältung ist für ihn immer eine Bronchitis, wenn nicht gar eine beginnende Lungenentzündung. Kopfschmerzen kommen auf keinen Fall vom übermäßigen Alkoholgenuss am Abend vorher, sondern sind mindestens ein Gehirntumor. Meist auch unheilbar.
»Martha? Bist du noch da?«
»Ich kann dich hören, Luc.«
»Martha, ich glaube, diesmal ist es etwas Ernstes. Das hatte ich noch nie. Mein Hals ... da ist etwas angeschwollen und meine Augenlider flattern. Wenn ich mich vorbeuge, dann habe ich das Gefühl, mir platzt der Schädel und dann noch das: Ein bellender Husten und es kommt grüner Schleim aus meiner Nase.« Er räuspert sich und hustet mir demonstrativ ins Ohr. »Martha, kannst du kommen?«, setzt er flüsternd hinzu.
»Nein, kann ich nicht und werde ich nicht. Wenn du krank bist, geh zum Arzt. Oder besser noch: Lös eine Aspirin in Wasser auf und trink das. Du wirst sehen, es hilft! Und jetzt entschuldige mich, ich habe noch Schüler.«
»Du bist eine grausame Frau. Ich weiß nicht, was ich an dir finde!«, schnieft er beleidigt ins Telefon.
»Das weiß ich auch nicht, Luc. Gute Besserung!« Ich atme aus. Es gab Zeiten, da habe ich an seinem Bett gesessen, jeden rasselnden Atemzug bewacht, der er tat. Angstvoll, sorgenvoll. Es hat eine Weile gedauert, bis ich Lucs Neigung zur Hypochondrie durchschaute. Tage, die ich mit ihm im Wartezimmer verschiedener Ärzte zugebracht habe. Jedes Mal kam er aus dem Sprechzimmer geschlurft mit der Miene eines Menschen, der gefasst dem Äußersten entgegensieht und einem augenrollenden Arzt, der hinter ihm den Kopf schüttelte. Töpfeweise habe ich Hühnersuppe gekocht und ihm dampfende Schüsseln ans Bett getragen. Das vermisse ich sicher nicht.
Und trotzdem ist da etwas in mir. Eine Sorge, die lauert, einen Punkt, den er in mir trifft. Was es ist, weiß ich nicht. Aber es ist etwas, mit dem ich mich nicht beschäftigen will und was ich wegschiebe.
In meiner Küche reiße ich hungrig das Baguette in Stücke und schlinge die Happen abwechselnd mit Salami herunter. Mein erster Schüler klingelt, als ich noch kaue. Es gibt sie schon, die stillen Stunden, in denen ich überlege, ob eine Rückkehr zu Luc nicht auch eine Möglichkeit ist, aber so schnell, wie der Gedanke durch meinen Kopf zieht, verwerfe ich ihn wieder. Lieber noch drei Schüler mehr, als jetzt halbstündlich seine durchgeschwitzten Laken wechseln.
***
Es ist kurz vor sieben, als ich den kleinen Maurice verabschiede und Schritte auf der Treppe höre, gerade, bevor ich die Tür schließen will.
Ach ja, Audric. Das muss er sein. Leichtfüßig und jung, zwei Stufen auf einmal nehmend. Er ist kaum außer Atem, als er schließlich auf meinem Treppenabsatz ankommt.
»Danke noch einmal, Madame Pelletier!«
Ich trete zur Seite und winke ihn hinein. Er nickt mir zu, senkt dann den Blick und schiebt seine runde Brille ein Stück die Nase hoch.
»Bonsoir, Monsieur Brunault.«
»Ach bitte«, er bleibt im Flur stehen und dreht sich zu mir um, »Audric. Sagen Sie Audric zu mir.«
»Also schön, Audric. Der Flügel steht im Wohnzimmer, immer geradeaus und dann um jede Ecke.«
Hastig und ein wenig schlaksig schiebt er sich um die Ecken und bleibt schließlich vor dem Instrument stehen, legt umständlich seine Schultertasche ab und zieht einige Blätter aus ihr hervor, bevor er sich auf den Hocker fallen lässt.
Schweigend setze ich mich auf den Stuhl daneben und lege die Hände in den Schoß. Fahrig dreht Audric an den Reglern, die die Höhe des Hockers verstellen. Er fährt hoch, dann wieder ein wenig herunter, legt die Hände auf die Tasten und nimmt sie wieder weg. Er wirft mir einen flüchtigen Seitenblick zu, dann rückt er noch einmal seine Brille zurecht.
»Madame Pelletier, ich würde den Walzer No 7 von Balakirev spielen.«
Für einen Moment bin ich überrascht. Das hatte ich nicht erwartet. »Tatsächlich?«, entfährt es mir und Audric nickt bekräftigend.
Ein nicht ganz leichtes Stück.
»Na, dann ...« Ich lehne mich ein wenig zurück.
Audric atmet tief ein und dann huschen seine Finger überraschend sicher und flink über die Tasten. Ich spüre, wie beim Spielen eine Anspannung von ihm abfällt. Seine schmalen Schultern werden lockerer, seine Ellenbogen lösen sich vom Körper. Und er spielt nicht einmal schlecht. Ein wenig langsam vielleicht, an einigen Stellen fehlt ihm die Fingerfertigkeit und ein wenig die Übung, aber alles in allem wirklich recht passabel.
Auf der dritten Seite unterbreche ich ihn. »Bien«, sage ich leichthin und lasse offen, ob ich sein Spiel meine oder einfach nur andeuten will, dass es jetzt reicht. Ich angele aus dem Notenstapel meinen heißgeleibten Ravel.
»Hier.« Ich beuge mich vor und stelle das Notenpapier auf den Ständer. Audrics Atem streift meine Wange. Kühl, jung und klar wie Frühlingsmorgen in den Tuilerien. Für einen winzigen Moment lang tut er mir leid, weil er so jung ist und weil alles noch so wichtig für ihn ist. Ist nicht genau das das Privileg der Jugend? Keine Prioritäten setzen zu müssen? Vielleicht ist es auch kein Mitleid, vielleicht ist es ein klitzekleines bisschen Neid.
»Rück ein Stück«, sage ich und gleite links neben ihm auf den Hocker. »Ich fange an.«
Audrics Körper strahlt Wärme aus und den unbestimmten Duft nach frischem Regen auf warmem Asphalt, anders kann ich es nicht beschreiben.
Ich spiele langsamer, als das Stück eigentlich gespielt gehört, um Audric die Chance zu geben, sich mit den Noten vertraut zu machen. Es ist nicht schwer, eigentlich müsste er es vom Blatt spielen können und doch holpert und stolpert er durch die Melodie. Ich runzele die Stirn und schließlich breche ich nach wenigen Takten ab.
»Wo ist das Problem?«, frage ich und Audric nimmt die Hände von den Tasten und zuckt mit den Schultern.
»Ich weiß nicht«, murmelt er schließlich nach einer langen Pause, in die die kleine Uhr auf dem Beistelltisch trotzig tickt.
Zögernd lege ich meine Hand auf seinen Arm. »Warum eigentlich der Klavierunterricht, Audric?«
»Ach ...« Er lässt den Kopf hängen und zuckt wieder mit den Schultern. »Es hat eh keinen Sinn.«
Ich weiß nicht recht, was ich dazu sagen soll und brumme einfach nur unbestimmt und hoffentlich anteilnehmend.
Audric atmet schwer aus und gerade, als ich glaube, dass er etwas Entscheidendes sagen will, presst er seine Lippen fest aufeinander und schluckt, was auch immer er mir mitteilen wollte, einfach hinunter.
Einen Augenblick sitzen wir schweigend nebeneinander, dann sieht er auf und in seinem Blick liegt das zutrauliche Hoffen eines Welpen.
»Wird es reichen, Madame Pelletier?«
Fragt sich nur wofür. »Gerade ist eine Stunde freigeworden. Montagabend um sieben. Passt dir das, Audric?«
»Ja, das ist mir sehr recht!« Ein Lächeln huscht über sein Gesicht und ich drücke ihm den Ravel gegen seine junge Brust.
»Hier. Üb das bis zur nächsten Stunde. Du überweist das Geld für die Stunden im Voraus. Wenn du weniger als vierundzwanzig Stunden im Voraus absagst, behalte ich das Geld für die ausgefallene Stunde, wenn du eher absagst, behalte ich die Hälfte.« Warum ich das sage, weiß ich nicht. Ich bin sonst nicht so streng.
»Sehr wohl, Madame.«
»Guter Junge und jetzt geh.« Monsieur Frechat kommt übermorgen und ich bin sehr erregt, füge ich im Geiste hinzu.
»Bonsoir!« Audric geht nicht, er eilt durch meinen Korridor und ich höre die Tür hinter ihm klappen.
Ein seltsamer Junge, denke ich und das ist er. Ein großer Junge. Ein attraktives Gesicht mit schönen Augen. Bei schönen Augen muss ich wieder an Monsieur Frechat denken. Hat er schöne Augen? Ist dieses dunkle verschwommene Braun schön? Auf jeden Fall ist es mit kleinen schwarzen Punkten gesprenkelt. Eigentlich sind Monsieur Frechats Augen wie ein frisch umgegrabener Gartenboden. Erde, ein wenig Lehm, feuchte Kühle. Sie haben etwas Beruhigendes, wie ein Blumenbeet im Sommer nach einem Schauer.
***
Später in der Badewanne widerstehe ich dem beinahe übermächtigen Drang, mich zu berühren, meine eigenen Finger auf meiner Haut zu spüren. Ich widerstehe, wenn auch schwerlich, aber ich will all mein Verlangen, all mein Sehnen für Monsieur Frechat aufheben. Ich will ausgehungert sein und mir nehmen, was ich möchte.
***
Gegen zehn ruft Luc noch einmal an, aber ich kann nicht. Ich habe mich nackt ins Bett gelegt, obwohl es nicht sehr warm ist. Ich spüre einen kühlen Wind durch die zugigen Holzfenster. Er streicht über meine Haut und stellt wie von Geisterhand feine Härchen auf, fast wie eine Hand, die mich sanft streichelt. Ich liege nur so da, wälze mich von einer Betthälfte auf die andere, rolle mich zusammen, strecke mich wieder aus. Aus einzelnen Tropfen der Lust wird fast ein Bach. Der Gedanke an Donnerstag sprudelt zwischen meinen Beinen wie eine muntere kleine Quelle.