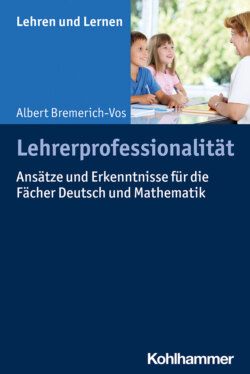Читать книгу Lehrerprofessionalität - Albert Bremerich-Vos - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zusammenfassung
ОглавлениеAls Fazit lässt sich festhalten, »dass einerseits von einer Negativselektion in das Lehramtsstudium generell nicht gesprochen werden kann.« (Rothland, 2014, S. 341) Andererseits ist nicht zu verkennen, dass bei kognitiven Fähigkeitstests und Abiturdurchschnittsnoten (zumindest) Studierende für ein Lehramt in der Sekundarstufe I erheblich schlechter abschneiden als Studierende für ein Lehramt am Gymnasium. Die Abiturnote ist nicht nur ein starker Prädiktor von Studienleistungen, sondern auch noch von Noten am Ende des Vorbereitungsdienstes. Zur Vorhersage der Qualität des Unterrichts dagegen trägt sie nicht bei.
Die Befunde deuten darauf hin, dass Lehramtsstudierende primär intrinsisch motiviert sind. Das fachliche Interesse, der Umgang mit Kindern und Jugendlichen und das Motiv, soziale Verantwortung zu übernehmen, sind bei ihnen deutlicher ausgeprägt als bei anderen Studierenden und bei SI-Studierenden wiederum stärker als bei Gymnasialen. Extrinsische Motive wie die Länge der Schulferien, der Beamtenstatus und das Gehalt spielen zwar auch eine Rolle, sind aber nachrangig. Im Vergleich mit anderen Studierenden sind Lehramtsstudierende weniger an intellektuell-forschenden Tätigkeiten interessiert, wobei nach Fächern und Lehrämtern zu differenzieren ist.
Im Hinblick auf Persönlichkeitsmerkmale wie die sogenannten Big Five unterscheiden sich Lehramtsstudierende nicht von anderen Studierenden. Fachunabhängig begünstigt insbesondere Gewissenhaftigkeit den Studienerfolg. Vor allem emotionale Stabilität (negativ: Neurotizismus) und auch noch Gewissenhaftigkeit und Extraversion bewahren vor emotionaler Erschöpfung und tragen zu beruflicher Zufriedenheit bei. Offenheit für neue Ideen und (ästhetische) Erfahrungen dürfte bei Gymnasialen ausgeprägter sein als bei Nicht-Gymnasialen. Belege für einen Zusammenhang zwischen einzelnen oder mehreren der Big Five und der Unterrichtsqualität oder dem Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler sind im deutschsprachigen Raum dagegen noch nicht erbracht worden.
1 Cohens d als ein Maß für die Stärke eines Effekts bezeichnet die Differenz der Mittelwerte zweier Gruppen, geteilt durch die gemittelte Standardabweichung. Die Standardabweichung ist eine Maßzahl für die durchschnittliche Abweichung der Einzelwerte vom Mittelwert einer Verteilung. Wenn die Werte normalverteilt sind, dann bedeutet eine Effektstärke von d= 1.00, dass eine durchschnittliche Schülerin bzw. ein durchschnittlicher Schüler am Gymnasium bessere Noten hat als mehr als 80 Prozent der Nicht-Gymnasialen. d-Werte ab 0.20 können als kleiner, ab 0.50 als mittlerer und ab 0.80 als großer Effekt angesehen werden. Die Berechnung von d oder eines anderen Maßes für die Effektstärke ist wichtig, weil bei großen Stichproben auch sehr kleine Effekte statistisch signifikant sein können. Wird zusätzlich die Effektstärke angegeben, kann beurteilt werden, inwiefern ein signifikanter Befund auch praktisch bedeutsam ist.
2 Korrelationen können Werte zwischen -1 und +1 annehmen. Bei Werten größer als 0 liegt ein positiver Zusammenhang vor, bei Werten unter 0 ein negativer. Werte ab etwa 0,3 (bzw. -0,3) zeigen mittlere, ab 0,5 (bzw. -0,5) starke Zusammenhänge an. Bei den Big Five handelt es sich um Konstrukte bzw. latente Variablen. Sie liegen den verschiedenen Indikatoren bzw. beobachtbaren (manifesten) Variablen zugrunde, d. h. den Antworten auf die Items, die jeweils zu einer latenten Variablen gehören. Bei den manifesten Variablen ist immer mit einem mehr oder weniger großen Messfehler zu rechnen, sie können nicht »perfekt« gemessen werden. Auch Zusammenhänge von manifesten Variablen sind damit »messfehlerbehaftet«. Die Korrelationen zwischen latenten Variablen in einem Strukturmodell (z. B. zwischen Gewissenhaftigkeit und Extraversion) sind dagegen »messfehlerbereinigt«. Es werden »wahre« Werte korreliert und die Korrelationen fallen höher aus als die zwischen manifesten Variablen.