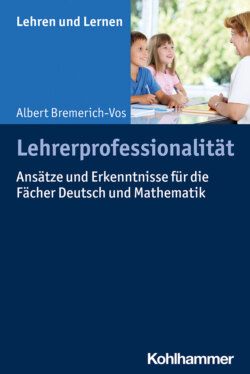Читать книгу Lehrerprofessionalität - Albert Bremerich-Vos - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Einleitung
ОглавлениеLehrkräfte in der Schule sind in erster Linie Fachleute für das Lehren und Lernen. Sie haben in der Regel mindestens zwei Fächer und Bildungswissenschaften studiert und das Referendariat erfolgreich abgeschlossen. Was macht ihre Professionalität aus? Wie die Antworten auch immer ausfallen: Auszugehen ist von den mit dem Beruf verbundenen Anforderungen. Deren Festlegung ist zum einen eine Aufgabe der Bildungspolitik. Ihr kommt die Kultusministerkonferenz nach, indem sie »Standards für die Lehrerbildung in den Bildungswissenschaften« und »Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung« bestimmt und von Zeit zu Zeit aktualisiert. Zum anderen sind die mit der Lehrertätigkeit verbundenen Anforderungen Gegenstand der Diskussion in einer Reihe von wissenschaftlichen Disziplinen, z. B. in der Schulpädagogik, der Bildungssoziologie, der Pädagogischen Psychologie und in den mit den Schulfächern korrespondierenden Fachwissenschaften und -didaktiken.
Ewald Terhart (2011) hat vorgeschlagen, drei Ansätze zur Bestimmung von Professionalität im Lehrerberuf zu unterscheiden:
• Im Kontext des berufsbiographischen Ansatzes wird Professionalität in erster Linie als Entwicklungsproblem aufgefasst. Hier werden etwa Studien- und Berufswahlmotive thematisiert, die Übernahme eines beruflichen Habitus nach dem Referendariat und Fragen, die mit der Verknüpfung von privatem Lebenslauf und beruflichem Werdegang bis zum Ende der Berufstätigkeit zu tun haben.
• Gemeinsam ist Varianten des strukturtheoretischen Ansatzes, dass die beruflichen Anforderungen an Lehrkräfte als in sich widersprüchlich dargestellt werden. Diese Widersprüche können nicht aufgehoben werden. Professionalität zeigt sich in der Fähigkeit, reflektiert mit ihnen umzugehen und dabei jederzeit ein Scheitern vor Augen zu haben.
• Vertreter eines kompetenztheoretischen Ansatzes bemühen sich um die Bestimmung des fachlichen, fachdidaktischen und pädagogischen Wissens und Könnens von Lehrkräften, ihrer Überzeugungen und weiterer ihrer Merkmale mit dem Ziel, deren Beitrag zu Effekten auf Schülerseite nachzuweisen, u. a. zum Lernerfolg.
Wie mit jedem Versuch, ein Forschungsfeld überschaubar zu machen, sind mit Terharts Vorschlag Vor- und Nachteile verbunden. Für ihn spricht z. B., dass sich Beiträge zum struktur- und zum kompetenztheoretischen Ansatz auch in methodischer Hinsicht deutlich unterscheiden.
Alle Arbeiten, die sich dem strukturtheoretischen Ansatz zuordnen lassen, sind qualitativ, hermeneutisch bzw. rekonstruktiv ausgerichtet und primär soziologisch zu verorten. Nachteilig wäre es aber, würde man nur sie berücksichtigen. Denn es gibt auch andere qualitative Studien zu Aspekten von Lehrerprofessionalität, die nicht strukturtheoretisch, sondern z. B. gesprächsanalytisch oder ethnographisch ausgerichtet sind.
Der kompetenztheoretische Ansatz hat seine Wurzeln in der Psychologie, u. a. in der Expertiseforschung. In den einschlägigen Arbeiten werden in der Regel nicht wenige »Fälle« interpretiert, sondern große Gruppen getestet bzw. befragt und die Befunde werden quantitativ-statistisch ausgewertet.
Anders als die Publikationen zu diesen beiden Ansätzen sind diejenigen, die man nach Terhart dem berufsbiographischen Ansatz zuordnen könnte, in methodischer Hinsicht disparat, d. h. einmal quantitativ, einmal qualitativ ausgerichtet. Deshalb folge ich in diesem Punkt seinem Vorschlag nicht, greife aber Fragestellungen, um die es hier geht, an verschiedenen Stellen auf. Auch im von Terhart, Bennewitz & Rothland herausgegebenen »Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf« (2014) wird nicht von einem berufsbiographischen Ansatz gesprochen. Es enthält aber u. a. einen Beitrag zum sogenannten Persönlichkeitsansatz. Persönlichkeit wird hier als »Ensemble relativ stabiler Dispositionen« (Mayr, 2014, S. 191) verstanden und es wird u. a. gefragt, ob Personenmerkmale zu finden sind, die zur Erklärung des Erfolgs von Lehrkräften beitragen. In Kapitel 2.3 dieses Buchs wird auf diesen Ansatz eingegangen.
Die Forschung zur Lehrerprofessionalität ist ein weites, für einen Einzelnen m. E. mittlerweile zu weites Feld, um mit dem alten Briest aus Fontanes Roman zu sprechen. Deshalb waren in mehrfacher Hinsicht Beschränkungen angezeigt:
• Von Ausnahmen abgesehen, kommen hier Studien aus den letzten 15 Jahren zur Sprache.
• Zwar ist die internationale Diskussion lebhaft und verzweigt, ich konzentriere mich aber auf Texte in deutscher und englischer Sprache, die von deutschsprachigen Autorinnen und Autoren verfasst wurden. Deren Auswahl ist subjektiv – aber nur zum Teil. Es gibt nämlich einige »Meilensteine«, d. h. Publikationen, die für die Debatte über Lehrerprofessionalität besonders anregend waren und sind.
Wenn die Studien zur Lehrerprofessionalität nicht wie häufig bildungswissenschaftlich orientiert sind, sondern einen Fachbezug haben, dann dominiert die Mathematik. Wollte man eine Rangliste aufstellen, dann kämen an zweiter Stelle die naturwissenschaftlichen und erst dann geisteswissenschaftliche Fächer. Mir als Deutschdidaktiker liegt das Fach Deutsch besonders am Herzen. Deshalb konzentriere ich mich im Folgenden im Wesentlichen auf Arbeiten zu (zukünftigen) Mathematik- und Deutschlehrkräften.
• Ausgespart sind Arbeiten zu Lehrkräften, die Mathematik oder Deutsch in der Grundschule unterrichten. Im Zentrum stehen Studien zu Sekundarstufenlehrerinnen und -lehrern.
• Lehrkräfte haben nicht nur zu unterrichten, sondern z. B. auch Eltern zu beraten und sich an der Entwicklung ihrer Schule zu beteiligen. Hier steht das Unterrichten im Zentrum, aber einige seiner Aspekte bleiben ausgespart. So bleibt z. B. ausgeklammert, was professionelles Handeln im Zeichen von Inklusion und Digitalisierung ausmachen könnte. Für eine mehr als oberflächliche Erörterung dieser Fragen fehlte der Platz.
Klaus-Jürgen Tillmann (2014, S. 314) resümierte, nachdem er mehrere Beiträge zum Stand der Forschung zum Lehrerberuf knapp referiert und kommentiert hatte, ernüchtert, dass sich die Verfechter eines qualitativen Ansatzes auf der einen und diejenigen, die einen primär quantitativen Zugang bevorzugen, auf der anderen Seite wenig zu sagen hätten. »Dies bestätigt die These, dass es hier offensichtlich zwei klar voneinander getrennte wissenschaftliche Arenen mit deutlich anderen Akteuren gibt, die sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit kaum aufeinander beziehen.« Es gibt zwar einige Versuche, Brücken zu bauen, aber Tillmanns Fazit hat im Großen und Ganzen auch heute noch Bestand. Ich habe mich bemüht, beiden »Richtungen« gerecht zu werden, mich von Fall zu Fall aber auch nicht vor Wertungen gescheut.