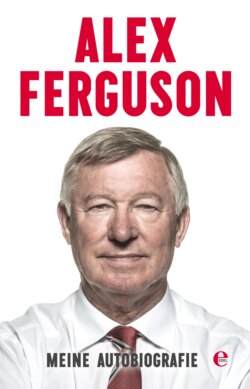Читать книгу Meine Autobiografie - Alex Ferguson - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 2
WURZELN IN GLASGOW
ОглавлениеDas Motto des schottischen Ferguson-Clans lautet: Dulcius ex asperis, was sinngemäß so viel heißt, wie »Süßer nach Schwierigkeiten«. Dieser Wahlspruch leistete mir in meinen 39 Jahren als Fußballtrainer immer gute Dienste. In der gesamten Zeit, von den kurzen vier Monaten 1974 bei East Stirlingshire bis zu Manchester United im Jahr 2013, sah ich trotz vieler Widrigkeiten den Erfolg am Horizont immer aufscheinen. Mich Jahr für Jahr immer wieder neuen Aufgaben zu stellen, war von der Überzeugung getragen, dass wir jeden Herausforderer besiegen würden.
Vor Jahren las ich einen Artikel über mich, in dem es hieß: »Alex Ferguson hat es im Leben wirklich zu etwas gebracht, obwohl er aus Govan stammt.« Man beachte den herabwürdigenden Halbsatz! Aber eben weil ich im Werftenviertel von Glasgow aufgewachsen bin, habe ich im Fußball so viel erreicht. Die Herkunft sollte niemals ein Hindernis für den Erfolg sein. Ein bescheidener Start ins Leben kann sogar eher eine Hilfe sein als ein Hemmnis. Wenn Sie sich erfolgreiche Menschen ansehen, werfen Sie auch einen Blick auf deren Elternhaus und suchen dabei nach Hinweisen auf ihre Energie und ihre Motivation. Die Herkunft aus einer Arbeiterfamilie war für viele meiner besten Spieler im Verlauf ihrer Karriere keineswegs ein Hindernis. Im Gegenteil, sie war häufig der Grund für ihre hervorragenden Leistungen.
In meiner Zeit auf der Trainerbank stieg ich auf vom Trainer von Jungs, die in East Stirling sechs Pfund pro Woche verdienten, bis ich schließlich Cristiano Ronaldo für 80 Millionen Pfund an Real Madrid weiterreichte. Meine Mannschaft in St. Mirren verdiente 15 Pfund in der Woche, und die Spieler mussten sich im Sommer selbst über Wasser halten, weil sie befristete Verträge hatten. Die Höchstsumme, die in Aberdeen ein Spieler der ersten Mannschaft in meinen acht Jahren bei Pittodrie verdiente, waren 200 Pfund pro Woche. Diese Obergrenzen hatte Dick Donald, der Vorstandsvorsitzende, festgelegt. Die Einkommensspanne der vielen tausend Jungs, die ich in beinahe vier Jahrzehnten trainiert habe, reichte also von sechs Pfund pro Woche bis zu sechs Millionen Pfund im Jahr.
Vor längerer Zeit erhielt ich einen Brief von einem Mann, der mir schrieb, dass er in den Jahren 1959/60 in Govan in den Docks gearbeitet hatte und damals immer in ein bestimmtes Pub gegangen war. Er erinnerte sich daran, dass eines Tages ein junger Typ mit einer Sammelbüchse in das Lokal kam und für eine Streikkasse sammelte und dabei eine recht aufwieglerische Rede hielt. Das Einzige, was er von diesem jungen Mann wusste, war, dass er bei St. Johnstone Fußball spielte. Der Brief schloss mit der Frage: »Waren Sie das?«
Zunächst konnte ich mich an diesen kurzen Ausflug in die Politik gar nicht mehr erinnern, doch mir ging der Brief nicht aus dem Kopf, und schließlich fiel mir ein, dass ich in unserem Viertel tatsächlich durch die Pubs gezogen war, um für den Streik Geld zu sammeln. Ich hatte es nicht etwa auf ein politisches Amt abgesehen und mein Gebrüll als »Rede« zu bezeichnen, hieße, ihm rhetorische Qualitäten zuzuschreiben, die es mit Sicherheit nicht besaß. Ich erinnere mich dass ich wie ein Idiot wirres Zeug geredet hatte, nachdem man im Pub meinte, ich sollte meine Bitte um Geld doch begründen. Wahrscheinlich waren alle bereits ordentlich angetrunken und in der Stimmung, den wirren Erklärungen des jungen Spendensammlers zu den Gründen seiner Aktion zuzuhören.
Pubs spielten in meinen jungen Jahren eine ganz wesentliche Rolle. Meine erste Geschäftsidee bestand darin, mein sehr bescheidenes Einkommen dafür zu nutzen, mir als Absicherung für die Zukunft eine Konzession für ein Pub zu beschaffen. Mein erstes Lokal befand sich an der Kreuzung Govan Road und Paisley Road West und wurde meist von Hafenarbeitern besucht. In den Pubs lernte ich sehr viel über Menschen, ihre Träume, ihre Wünsche und ihre Frustrationen, und das half mir später, die Welt des Fußballs besser zu verstehen, auch wenn ich das damals noch nicht wissen konnte.
In einem meiner Pubs gab es beispielsweise einen Wembley Club, deren Mitglieder über zwei Jahre kleine Beträge einzahlten, um zum Spiel England gegen Schottland nach Wembley fahren zu können. Ich würde am Ende den Betrag, der sich angesammelt hatte, verdoppeln, und sie konnten dann für vier oder fünf Tage nach London fahren. So war zumindest die Theorie. Ich selbst würde dann am Tag des Spiels zu ihnen stoßen. Mein bester Kumpel Billy fuhr meist am Donnerstag nach Wembley und kam erst nach sieben Tagen wieder zurück. Diese ungeplante Verlängerung seines Aufenthalts führte bei ihm jedes Mal zu einem ausgewachsenen Familienkrach.
Eines Donnerstags nach einem Samstagsspiel in Wembley läutete bei mir zu Hause, als das Telefon. Anna, Billys Frau, wollte wissen, wo Billy steckte. Ich stellte mich ahnungslos. Etwa 40 unserer Kneipengäste waren in London unterwegs, und ich konnte unmöglich wissen, warum Billy weggeblieben war. Doch für die einfachen Leute meiner Generation war die Fahrt zu einem großen Fußballmatch nach London so etwas wie eine kleine Pilgerreise, und allen ging es sowohl um den Kameradschaftsgeist als auch um das Spiel selbst.
Das Pub, das wir an der Main Street führten, lag im Stadtteil Bridgeton, einem der größten Protestantenviertel Glasgows. Am Samstag vor dem Oraniermarsch kam der große Tam, ein Postbote, zu mir und sagte: »Alex, die Jungs wollen wissen, um welche Zeit du am Samstag aufmachst. Wegen des Marsches. Wir fahren nämlich nach Ardrossan« (an der schottischen Westküste; A.d.Ü.). »Die Busse fahren um zehn Uhr los«, erklärte Tam. »Alle Pubs haben geöffnet. Du musst unbedingt auch aufmachen.«
Ich war perplex. »Wann soll ich denn aufmachen?«
»Um sieben«, meinte Tam.
Ich war also am Samstagmorgen um 6:15 Uhr zusammen mit meinem Vater, meinem Bruder Martin und dem kleinen italienischen Barkeeper vor Ort. Wir hatten uns reichlich mit Getränken eingedeckt, weil mir Tam geraten hatte: »Deck dich mit reichlich Vorrat ein, du wirst jede Menge Getränke absetzen.« Ich öffnete also um sieben Uhr. Bald war das Pub berstend voll mit gut gelaunten, lärmenden Oranieren. Sogar die Polizei kam vorbei, sagte aber kein Wort.
In der Zeit von sieben bis halb zehn hatte ich 4000 Pfund eingenommen – mit doppelten Wodkas und ähnlichem. Mein Vater saß da und schüttelte den Kopf. Ab halb zehn waren wir dann damit beschäftigt, das Lokal für unsere Stammgäste herzurichten. Wir mussten das Pub regelrecht sauber schrubben. Aber immerhin hatten wir zusätzlich 4000 Pfund in der Kasse.
Ein Pub zu führen, war harte Arbeit. Aber im Jahr 1978 war für mich Schluss damit. Als Trainer von Aberdeen blieb mir keine Zeit, mich mit Betrunkenen herumzuschlagen oder mich um die Buchhaltung zu kümmern. Viele gute Geschichten aus jener Zeit sind mir in lebhafter Erinnerung geblieben. Man könnte ein ganzes Buch darüber schreiben. Die Hafenarbeiter kamen am Samstagvormittag mit ihren Frauen ins Pub, nachdem sie am Freitagabend ihren Lohn bekommen hatten, und deponierten das Geld in meinem Safe hinter der Theke. Am Freitagabend fühlte man sich vorübergehend irgendwie als reicher Mann. Schließlich wusste man nicht, ob das Geld im Safe oder in der Kasse deines war oder es ihnen gehörte. In der Anfangszeit zählte Cathy das Geld immer auf dem Teppich. Am Samstagvormittag war es dann wieder verschwunden, denn die Männer kamen und holten es wieder ab. Die Notizen zu diesen Transaktionen bezeichneten wir als Schuldbuch.
Eine Stammkundin, sie hieß Nan, war besonders geschickt darin, die Wege des Geldes ihres Mannes zu verfolgen. Sie redete wie die Hafenarbeiter. »Du hältst uns wohl alle für blöd?«, sagte sie und fixierte mich dabei.
»Wieso?«, fragte ich, um Zeit zu gewinnen.
»Du hältst uns wohl für blöd? Das Schuldbuch, ich will es sehen.«
»Nein, du kannst das Schuldbuch nicht sehen«, improvisierte ich. »Es ist tabu. Der Steuerprüfer hat was dagegen. Er prüft es jede Woche. Du kannst da nicht reingucken.«
Nan drehte sich, inzwischen etwas kleinlaut, zu ihrem Mann und fragte: »Stimmt das?«
»Hm, weiß nicht«, antwortete er.
Der Sturm hatte sich inzwischen etwas gelegt. »Wenn ich herausfinde, dass der Name von meinem Mann da drin steht, komme ich nie mehr hierher«, verkündete Nan schließlich.
Das sind so kleine Erinnerungen aus meinen jungen Jahren, die ich oft in Gesellschaft von rauen, aber häufig charakterstarken Leuten verbrachte. Von taffen Leuten eben. Hin und wieder kam ich mit einer Beule am Kopf oder einem blauen Auge nach Hause. So war das Kneipenleben nun mal. Wenn es zu wild wurde und es zu Handgreiflichkeiten kam, musste man dazwischen gehen und für Ordnung sorgen. Wenn man versuchte, die Kontrahenten zu trennen, kassierte man hin und wieder auch mal einen Kinnhaken. Im Rückblick war es dennoch ein wunderbares Leben – voller Dramen und Komödien.
Ich erinnere mich noch heute an einen Mann namens Jimmy Westwater, der hereinkam und nach Atem rang. Er war schon ganz fahl im Gesicht. »Um Himmels willen, ist alles in Ordnung?«, rief ich. Jimmy hatte sich in Schantungseide gewickelt, um sich aus den Docks zu schleichen, ohne erwischt zu werden. In einen ganzen Ballen Schantungseide. Aber er hatte sich darin so fest eingewickelt, dass er kaum noch Luft holen konnte.
Ein anderer Jimmy, den ich eingestellt hatte und der das Lokal tiptop in Ordnung hielt, tauchte eines Abends mit einer Fliege um den Hals auf. Einer meiner Stammgäste konnte es nicht fassen: »Eine Fliege in Govan? Das muss ein Scherz sein!« Eines Freitagabends kam ich ins Pub und stellte fest, dass jemand in der Bar tütenweise Vogelfutter verkaufte. In diesem Teil von Glasgow hielt jeder Tauben.
»Was ist das denn?«, wollte ich wissen.
»Na Vogelfutter, was sonst.« Als wäre die Antwort das Selbstverständlichste von der Welt.
Ein junger Ire namens Martin Corrigan brüstete sich gerne damit, jede Aufgabe im Haushalt perfekt erledigen zu können. Geschirr und Besteck spülen, den Kühlschrank reinigen – alles, was eben so anfällt. Ein anderer kam hereinspaziert und fragte: »Brauchst du ein Opernglas? Ich bin absolut pleite.« Er zog ein schönes, in Pergamentpapier eingewickeltes Opernglas hervor. »Einen Fünfer«, meinte er.
»Unter einer Bedingung«, antwortete ich. »Einen Fünfer, wenn du hier was trinkst. Und nicht zu Baxters rübergehst.« Er war ein netter Kerl, der einen Sprachfehler hatte. Ich bekam also das Opernglas, und er gab drei Pfund gleich wieder an der Theke aus.
Wann immer ich eine meiner Neuerwerbungen mit nach Hause brachte, drehte Cathy fast durch. Ich erinnere mich, dass ich einmal mit einer sehr hübschen italienischen Vase heimkam, die Cathy später in einem Laden für zehn Pfund entdeckte. Das Problem bestand darin, dass ich für unsere 25 Pfund bezahlt hatte. Ein andermal kam ich in einer nagelneuen, wirklich gut aussehenden Wildlederjacke heim.
»Wie viel?«, fragte Cathy.
»Sieben Pfund«, antwortete ich strahlend.
Zwei Wochen später wollten wir zu einer Party ihrer Schwester gehen. Ich schlüpfte also in die Jacke, stellte mich ganz stolz vor den Spiegel und bewunderte meine neue Anschaffung. Man kennt das ja, wie Männer an den Ärmeln ziehen, damit die Jacke auch richtig sitzt. Genau das machte ich auch – und hatte die beiden Ärmel plötzlich in der Hand. Da stand ich nun mit einer ärmellosen Jacke.
Cathy krümmte sich vor Lachen, während ich brüllte: »Den bringe ich um!« Die Jacke war nicht einmal gefüttert.
In meinem Billardzimmer hängt ein Bild von Bill, meinem besten Freund. Das war vielleicht ein Typ, dieser Billy! Er konnte nicht einmal eine Tasse Tee kochen. Als wir einmal, nachdem wir auswärts essen waren, zu ihm nach Hause kamen, sagte ich: »Stell doch mal den Wasserkessel auf den Herd, wir machen uns einen Tee.« Er verschwand und blieb eine Viertelstunde weg. Als ich ihn suchen ging, fand ich ihn beim Telefonieren mit seiner Frau, die er fragte: »Anna, wie geht das mit dem Teekochen?«
Eines Abends ließ Anna eine Fleischpastete für ihren Mann im Ofen, während Billy sich den Film Flammendes Inferno anschaute. Als Anna nach zwei Stunden wiederkam, quoll Rauch aus der Küche.
»Um Himmels willen, hast du denn den Herd nicht ausgeschaltet? Hier ist alles voller Qualm!«, schrie sie.
»Ich dachte, der käme aus dem Fernseher«, brüllte Billy. Er hatte es für einen Spezialeffekt des Films gehalten.
Billys Haus war ein beliebter Treffpunkt, wo sich früher oder später jeder einfand. Doch er war nicht als Billy bekannt. Alle nannten ihn McKechnie. Seine beiden Söhne, Stephen und Darren, waren tolle Jungs, und sie haben mit meinen Söhnen noch immer engen Kontakt. Billy gibt es nicht mehr. Aber ich denke noch oft an ihn und an den Spaß, den wir hatten.
Ich habe noch immer einen harten Kern von Freunden aus jener Zeit. Duncan Petersen, Tommy Hendry und Jim McMillan waren vier Jahre alt, als sie mit mir zusammen in den Kindergarten gingen. Duncan wurde Klempner, arbeitete für Imperial Chemical Industries in Grangemouth und ging sehr früh in Rente. Er besitzt ein hübsches, kleines Haus in Clearwater, Florida, und bereist mit seiner Frau gern die Welt. Tommy, der in jüngster Zeit ein paar Probleme mit dem Herzen hatte, war ebenso wie Jim Ingenieur. Der vierte aus unserer Runde, Angus Shaw, pflegt jetzt seine kranke Frau. John Grant, dem ich ebenfalls sehr nahe stehe, ist in den 1960er-Jahren nach Südafrika ausgewandert. Seine Frau und seine Tochter betreiben dort einen Großhandel.
Als ich als junger Mann das Team von Harmony Row verließ, waren die Jungs aus Govan sauer auf mich. Sie fanden es blöd, dass ich die Mannschaft verließ und zu den Amateuren von Drumchapel wechselte. Mick McGowan, der Harmony Row damals leitete, sprach nie mehr ein Wort mit mir. Er trug mir den Wechsel ewig nach. Er war ein eingefleischter Harmony-Row-Fan und ignoriert mich seither. Aber wir Jungs aus Govan gingen bis zum Alter von 19 oder 20 noch immer zusammen aus, und alle hatten zu dieser Zeit die erste Freundin.
Allmählich lebten wir uns aber auseinander. Ich heiratete Cathy und zog nach Simshill. Auch die anderen heirateten. John und Duncan spielten von 1958 bis 1960 mit mir zusammen bei Queen’s Park. Doch als Trainer blieb mir neben dem Job nur noch wenig Zeit für andere Dinge. Das war jedenfalls beim St. Mirren FC so. Aber die Verbindung riss nicht komplett ab. Etwa zwei Monate, bevor ich Aberdeen 1986 verließ, rief Duncan an und sagte, dass er im Oktober seine Silberhochzeit feiern würde. Ob Cathy und ich kommen wollten? Natürlich nahmen wir die Einladung gerne an. Das war zu jener Zeit, als ich an einem Wendepunkt meines Lebens stand. Die ganzen Jungs waren zum Fest gekommen, und wir fanden wieder zusammen. Alle hatten inzwischen Familien gegründet, und wir hatten uns zu reifen Männern entwickelt. Ich ging einen Monat später zu United, aber wir sind seither in engem Kontakt geblieben.
Mit 19 oder 20 kommt es ganz allmählich zu Veränderungen in den Lebensgewohnheiten, aber die Jungs aus Govan hielten weiterhin zusammen. Zwar führte ich inzwischen ein komplett anderes Leben, doch ich habe mich nie von ihnen abgewendet. Mein Leben hat sich einfach nur anders entwickelt. Ich betrieb zuerst zwei Pubs, war dann Trainer von St. Mirren und schließlich kam 1978 der Job bei Aberdeen.
Diese Freundschaften gaben mir bei Manchester United Kraft. Alle Freunde versammelten sich in unserem Haus in Cheshire, wir aßen ausgiebig, sangen und legten schließlich die alten Platten auf. Sie alle waren gute Sänger. Doch als ich an die Reihe kam, hatte der Wein schon dazu geführt, dass ich meine Sangeskünste stark überschätzte und meinte, Frank Sinatra beinahe das Wasser reichen zu können. Ich hatte keinerlei Zweifel, dass ich meine Zuhörer mit einer schönen Interpretation von Moon River erfreuen würde. Nachdem ich kaum zwei Takte gesungen hatte und die Augen aufmachte, war keiner mehr im Zimmer. »Ihr kommt her und schlagt euch mit meinem Essen den Bauch voll, und dann haut ihr ab, während ich singe, und schaut im Zimmer nebenan fern«, nörgelte ich. »Das hören wir uns nicht an. Das ist Scheiße«, war die Antwort.
Sie sind alle ganz normale, bodenständige Männer. Die meisten sind seit über 40 Jahren verheiratet. Gott, wie die mich runterputzen und fertig machen können. Ich nahm es ihnen aber nicht übel, weil sie mir so ähnlich sind. Sie sind vom gleichen Schlag. Sie sind mit mir aufgewachsen. Und sie haben mich auch unterstützt. Wenn sie zu einem Spiel kamen, waren wir meist die Sieger. Doch wenn wir ein Spiel versemmelten, dann sagten sie verständnisvoll: »Das war ein hartes Stück Arbeit«, nicht etwa »Das war Mist«, sondern »Das war ein hartes Stück Arbeit«.
Meine Freunde aus Aberdeen bleiben mir immer sehr nahe. Wenn ich eines über Schottland gelernt habe, dann dies: Je weiter nach Norden man kommt, umso verschlossener werden die Menschen. Sie brauchen länger, um Freundschaften zu schließen, aber dann ist diese Verbindung sehr tief.
Je mehr ich mich in den Job bei United hineinkniete, desto weniger Zeit blieb mir für mein privates Umfeld. Ich ging am Samstagabend kaum mehr aus. Der Fußball war für mich anstrengend genug. Wenn die Spiele um 15 Uhr angepfiffen wurden, kam ich meist erst gegen Viertel vor neun heim. Das war der Preis des Erfolgs: 76 000 Menschen, die alle zur gleichen Zeit nach Hause fuhren. Der Wunsch auszugehen ließ nach. Dennoch gewann ich ein paar gute neue Freunde: Ahmet Kurcer, Manager des Alderley Edge Hotels, Sotirios, Mimmo, Marius, Tim, Ron Wood, Peter Done, Jack Hanson, Pat Murphy und Pete Morgan, Ged Mason, den wunderbaren Harold Riley und natürlich die Leute aus meinem Stab, die immer loyal zu mir hielten. James Mortimer und Willie Haughey waren alte Kumpel aus meiner Heimatstadt, dann gab es Martin O’Connor und Charlie Stillitano in New York und Eckhard Krautzun in Deutschland. Das waren alles gute Menschen. Wir verbrachten gemeinsam schöne Abende, wenn wir noch Energie zum Ausgehen hatten.
Zu Beginn meiner Karriere in Manchester freundete ich mich mit Mel Machin an, der Trainer von Manchester City war und schon bald, nachdem sie uns 5:1 besiegt hatten, gefeuert wurde. Als Grund wurde angeführt, wenn ich mich recht entsinne, dass Mel nicht freundlich genug in die Kameras gelächelt habe. Mir wäre schon längst gekündigt worden, hätte so etwas bei United je eine Rolle gespielt. John Lyall, der Trainer von West Ham, war in jenen Tagen für mich ein Fels in der Brandung. Ich kannte bei Weitem nicht alle Spieler in England und war mir auch nicht sicher, wie gut die Scouting-Abteilung von United tatsächlich arbeitete. Häufig rief ich John an, und er schickte mir Berichte über Spieler, die meine eigenen Unterlagen oft gut ergänzten. Ich konnte mich auf ihn verlassen und vertraute ihm selbst vieles an. Wenn er mir sagen wollte, dass United gerade nicht gut spielte, dann mahnte er: »Ich sehe keinen Alex Ferguson in dieser Mannschaft.«
Jock Wallace, der temperamentvolle ehemalige Trainer der Rangers, sagte mir eines Abends etwas Ähliches: »Ich sehe keinen Alex Ferguson in dieser Mannschaft. Du solltest Alex Ferguson besser wieder zurückholen.« Diese Männer boten mir ihren Rat an, weil sie wussten, dass man auf unsere Freundschaft bauen konnten. Solche Freundschaften sind für mich die besten und wichtigsten im Leben. Bobby Robson war Trainer der englischen Nationalmannschaft, deshalb war unsere Beziehung am Anfang etwas anders, doch auch wir freundeten uns an. Lennie Lawrence war ein weiterer Freund aus dieser Zeit und ist es immer noch.
Bobby Robson und ich nahmen in Portugal, wo er zunächst Porto und dann Sporting Lissabon trainierte, anlässlich Eusébios Abschiedsspiel wieder engen Kontakt auf. Éric Cantona hatte bei diesem Spiel sein Debüt. Bobby kam aus unserem Hotel, und ich werde nie vergessen, wie er sich an Steve Bruce wandte und zu ihm sagte: »Steve, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Ich hätte dir eine England-Kappe aufsetzen sollen, und ich entschuldige mich dafür.« Und das im Beisein aller Spieler.
Vieles von dem, was ich am Ende meiner Laufbahn wusste, habe ich in jener Anfangszeit gelernt, manchmal ohne es zu merken. Lange bevor ich mich in Richtung Süden zu United aufmachte, hatte ich bereits viel über die Menschen gelernt.
Häufig betrachten Außenstehende die eigene Branche oder die Welt drum herum anders als man selbst, und manchmal muss man sich der Realität anpassen. Bei Davie Campbell war es so ein Fall. Ich hatte den Spieler beim St. Mirren trainiert. Er konnte zwar laufen wie eine Gazelle, aber kein Kaninchen in die Falle locken. Als ich ihn mir eines Tages in einer Halbzeitpause deshalb gerade zur Brust nehmen wollte, ging die Tür auf und sein Vater erschien: »Davie, mein Sohn, du spielst hervorragend, gut gemacht!«, verkündete er und verschwand wieder. So unterschiedlich kann der Blick auf die gleiche Sache sein.
Eines Tages waren wir mit der Mannschaft von East Stirling in Cowdenbeath, hatten aber vor der Abfahrt nicht auf die Wettervorhersage geachtet. Das Spielfeld war hart wie Beton. Also fuhren wir ins Zentrum von Cowdenbeath und kauften zwölf Paar Baseballstiefel. Damals hatten die Fußballschuhe noch keine Gummisohlen. Zur Halbzeit lagen wir bereits 3:0 im Rückstand. Während der zweiten Spielhälfte klopfte mir plötzlich Billy Renton, ein ehemaliger Mannschaftskamerad, auf die Schulter und sagte: »Alex, ich will dir nur kurz meinen Sohn vorstellen.« Völlig entgeistert raunzte ich ihn an: »Billy, um Himmels willen, wir verlieren gerade 3:0.«
Genau an diesem Tag war der gegnerische Trainer Frank Connor, ein Typ mit sehr eigenem Temperament, bei einer Spielsituation der Meinung, dass der Schiedsrichter parteiisch gegen seine Mannschaft gepfiffen hätte und schleuderte deshalb voller Wut die Trainerbank aufs Spielfeld. Darauf ich: »Verdammt noch mal, Frank, ihr gewinnt doch gerade 3:0!«
»Eine Sauerei ist das!«, gab Frank zurück. Das war die Art von Emotionen, mit denen ich es oft zu tun hatte.
Dabei fällt mir die Geschichte von Jock Stein und seinen Streitereien mit Jimmy Johnstone ein. Jimmy war ein hervorragender Spieler und legendärer Trinker. Eines Nachmittags nahm Jock Stein Jimmy zur Strafe dafür, dass er nicht in einem europäischen Auswärtsspiel spielen wollte, aus dem Match. Als Jimmy vom Platz kam, schrie er ihn an: »Du einfüßiger Bastard, du dämlicher«, kickte gegen den Unterstand und rannte durch den Tunnel. Der große Jock hinterher. Inzwischen hatte sich Jimmy in der Kabine verbarrikadiert.
»Mach die Tür auf!«, brüllte Jock.
»Nein, dann verdrischt du mich«, heulte Jimmy.
»Mach diese verdammte Tür auf!«, brüllte Jock weiter. »Ich warne dich.«
Jimmy riss die Tür auf und sprang direkt in eine Wanne, die dort rumstand und voll heißen Wassers war.
Jock: »Komm raus da!«
»Nein, ich komme nicht raus.«
Unterdessen lief draußen auf dem Spielfeld das Match weiter. So ist das.
Die Arbeit als Trainer ist eigentlich eine niemals endende Folge von Herausforderungen. Ein großer Teil davon besteht im Umgang mit diversen menschlichen Schwächen. So zum Beispiel, als einige Spieler der schottischen Nationalmannschaft nach einem feuchtfröhlichen Abend beschlossen, einige Boote zu kapern und loszurudern. Das endete damit, dass Jimmy Johnstone, dem kleinen Jinky, die Ruder abhanden kamen und er von der Ebbe aufs Meer hinausgetragen wurde, während er noch immer vor sich hin grölte. Als die Nachricht schließlich Celtic Park erreichte, wurde Jock Stein darüber informiert, dass Jinky von der Küstenwache im Firth of Clyde aus einem Ruderboot gerettet worden war. Darauf Jock scherzhaft: »Hätte er nicht ersaufen können? Wir hätten ihm einen ehrenvollen Abschied verpasst, uns um Agnes gekümmert, und ich hätte immer noch Haare auf dem Kopf.«
Jock war einfach urkomisch. Ich erinnere mich noch, wie wir während unserer gemeinsamen Zeit bei der schottischen Nationalmannschaft im Mai 1985 England im Wembley-Stadion mit 1:0 besiegten und dann nach Reykjavik flogen, um gegen Island anzutreten, und wir sehr zufrieden mit uns waren. Nach unserer Ankunft fand sich der Trainerstab zu einem Festessen zusammen, das aus Garnelen, Lachs und Kaviar bestand. Big Jock trank niemals Alkohol, aber ich drängte ihn, zur Feier unseres Sieges über die Engländer wenigstens ein Glas Weißwein zu trinken.
Beim Spiel gegen Island schafften wir gerade einmal ein 1:0. Unsere Leistung war eine einzige Katastrophe. Danach kam Big Jock mit einem vorwurfsvollen Blick zu mir und meinte: »Siehst du? Das lagt nur an dir und deinem blöden Weißwein.«
Obwohl ich mich auf all diese Erfahrungen stützen konnte, tastete ich mich in meiner Anfangszeit bei Manchester United vorsichtig voran. Meine Temperamentsausbrüche waren dabei mitunter hilfreich, denn wenn ich die Beherrschung verlor, kam meine Persönlichkeit erst richtig zum Tragen. Ryan Giggs ist ebenfalls ein aufbrausender Mensch, aber eher langsam. Meine Hitzköpfigkeit war häufig ein recht nützliches Instrument. Sie sorgte dafür, dass ich respektiert wurde und half mir, meine Autorität durchzusetzen. Sie machte den Spielern, aber auch dem Trainerstab klar, dass ich mich nicht an der Nase rumführen lasse.
Es gibt immer Leute, die gegen dich antreten und dir die Stirn bieten wollen. Schon in den ersten Tagen bei East Stirling hatte ich eine eindrucksvolle Auseinandersetzung mit unserem Mittelstürmer, der der Schwiegersohn von Bob Shaw war, einem der Vereinsbosse.
Einer meiner Spieler, Jim Meakin, kam zu mir, um mich darüber zu informieren, dass seine ganze Familie an einem Septemberwochenende verreisen würde. Das sei so Tradition.
»Was meinst du damit?«, fragte ich.
»Na ja, dass ich am Samstag nicht spielen werde«, kam von Jim zurück.
»Tja, ich sag dir was«, erwiderte ich, »wenn du am Samstag nicht antrittst, brauchst du dir erst gar nicht die Mühe machen wiederzukommen.«
Also spielte er und fuhr direkt danach zu seiner Familie nach Blackpool.
Am Montag bekam ich einen Anruf: »Boss, ich habe eine Panne und bin liegen geblieben.« In Carlisle, wenn ich mich recht entsinne. Er muss mich wohl für blöd gehalten haben. Ich schaltete blitzschnell und sagte: »Ich kann dich nicht gut verstehen, gib mir deine Nummer, ich rufe zurück.«
Schweigen.
»Du brauchst gar nicht erst wiederzukommen«, bekam er dann noch von mir zu hören.
Bob Shaw vom Vorstand war richtig sauer auf mich. Und das wochenlang. Sogar der Vorstandsvorsitzende bekniete mich: »Alex, bitte, schaff mir Bob Shaw vom Hals und lass Jim wieder spielen.«
Darauf ich: »Kommt nicht in Frage, Willie, er ist draußen. Du willst mir doch nicht etwa sagen, dass ich meinen Job vernünftig machen kann, wenn die Spieler selbst entscheiden, wann sie in Urlaub fahren?«
»Ich sehe das Problem, aber sind drei Wochen nicht genug?«, fragte er.
In der darauf folgenden Woche kam er in Forfar nach mir auf die Toilette, stellte sich neben mich und grummelte: »Bitte, Alex, wenn du nur einen Funken christliches Mitgefühl im Leib hast.«
Nach kurzer Überlegung antwortete ich: »In Ordnung.«
Spontan gab er mir einen Kuss. »Was machst du denn da, du alter Sack?«, rutschte es mir raus. »Gibst mir in einer öffentlichen Toilette einen Kuss!«
Im Oktober 1974 begann für mich der nächste Abschnitt meiner Lehrzeit, als ich beim St. Mirren FC zu arbeiten begann. Gleich am ersten Tag entdeckte ich ein Foto im Paisley Express. Ich bemerkte, dass der Mannschaftskapitän auf dem Bild eine Geste hinter meinem Rücken machte. Am folgenden Montag zitierte ich ihn in mein Büro und verkündete ihm: »Du kannst ablösefrei zu einem anderen Verein wechseln, wenn du willst. Hier ist kein Platz mehr für dich. Du wirst nicht mehr aufgestellt.«
»Warum?«, wollte er wissen.
»Wenn du das Victory-Zeichen hinter einem Trainer machst, sagt mir das, dass du weder ein erfahrener Spieler noch eine reife Persönlichkeit bist. Wenn ich nach einem Mannschaftskapitän suche, dann halte ich nach einem reifen Kerl Ausschau. Was du veranstaltet hast, war einfach kindisch. Also verschwinde.«
Es ist unabdingbar, sich Respekt zu verschaffen. Schon Big Jock sagte mit Blick auf die Spieler zu mir: »Schließe sie nie ins Herz, weil sie dich bescheißen werden.«
In Aberdeen hatte ich es mit allen möglichen Regelverstößen zu tun. Ich habe viele dabei erwischt, und im Nachhinein lacht man sich über ihre Reaktionen halb tot.
»Ich?«, fragten sie dann meist und guckten dich dann ganz beleidigt an.
»Genau du.«
»Ach, ich habe einen Kumpel besucht.«
»Tatsächlich? Drei Stunden lang? Und warst am Ende besoffen?«
Mark McGhee und Joe Harper stellten mich mehrfach auf die Probe. Und dann war da beim St. Mirren FC noch Frank McGarvey. Eines Sonntags im Jahr 1977 kamen 15 000 Fans zu einem Pokalspiel in den Fir Park, das wir aber 2:1 verloren. Motherwell warf uns aus dem Pokalwettbewerb, und der SFA, der Scottish Football Association, wurde zugetragen, ich hätte behauptet, dass der Schiedsrichter überfordert gewesen wäre.
An diesem Sonntagabend läutete bei mir zu Hause das Telefon. Mein Freund John Donachie war am anderen Ende der Leitung und sagte: »Ich wollte es dir vor dem Spiel nicht erzählen, weil ich wusste, dass du ausflippen würdest, aber ich habe McGarvey am Freitagabend im Pub gesehen, sternhagelvoll.« Ich rief bei ihm zu Hause an. Seine Mutter war am Apparat. »Ist Frank da?«
»Nein«, antwortete sie, »er ist in der Stadt. Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
»Sie können ihm ausrichten, dass er mich anrufen soll, sobald er nach Hause kommt. Ich bleibe auf. Ich gehe erst ins Bett, wenn ich mit ihm geredet habe.« Um 23:45 Uhr klingelte das Telefon. Es piepte in der Leitung, deshalb wusste ich, dass er von einem Münzapparat aus anrief. »Ich bin zu Hause«, sagte Frank. »Aber es piept in der Leitung«, erwiderte ich.
»Ja, wir haben in unserem Haus ein Münztelefon«, erklärte er mir. Das entsprach zwar der Wahrheit, aber ich glaubte ihm nicht, dass er von dort aus anrief.
»Wo warst du am Freitagabend?«
»Daran kann ich mich nicht erinnern«, antwortete er.
»Ich sag es dir. Du warst in der Waterloo Bar. Dort warst du. Du bist gesperrt, und zwar auf Lebenszeit. Du brauchst gar nicht erst wiederzukommen. Du bist raus aus dem schottischen U21-Team. Ich streiche dich. Du wirst in deinem ganzen Leben nie mehr auflaufen.« Und damit legte ich auf.
Am folgenden Morgen rief mich seine Mutter an. »Mein Frank trinkt nicht. Sie müssen ihn verwechselt haben.«
Ich erwiderte ihr: »Das glaube ich nicht. Ich weiß, dass jede Mutter immer nur das Beste in ihrem Sohn sieht, aber fragen Sie ihn doch mal selbst.«
Drei Wochen lang ließ ich ihn auf Lebenszeit gesperrt, und die anderen Spieler murrten heftig.
Wenig später stand ein entscheidendes Ligaspiel gegen Clydebank auf dem Plan, und ich sagte zu meinem Assistenten, dem großen Davie Provan: »Ich brauche ihn für dieses Spiel.« In der Woche vor dem Spiel gegen Clydebank fand das Vereinsfest im Rathaus von Paisley statt. Als ich mit Cathy reinkam, sprang Frank plötzlich hinter einer Säule hervor und bettelte: »Geben Sie mir noch eine Chance.« Das war ein Geschenk des Himmels, denn ich hatte mich schon gefragt, wie ich ihn wieder in die Mannschaft holen konnte, ohne mein Gesicht zu verlieren, und da kommt er plötzlich hinter einer Säule hervor. Ich sagte zu Cathy, dass sie schon einmal weitergehen solle, während ich Frank gegenüber meinen strengsten Tonfall anschlug: »Ich habe dir gesagt, dass du in deinem Leben nie mehr spielen wirst.« Tony Fitzpatrick, der uns beobachtet hatte, kam hinzu: »Chef, geben Sie ihm noch eine Chance, ich garantiere, dass er sich in Zukunft benimmt.«
»Sprechen wir morgen früh darüber«, blaffte ich. »Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.« Und ich schritt triumphierend in den Saal, um mich zu Cathy zu gesellen. Das Spiel gegen Clydebank haben wir dann 3:1 gewonnen, und Frank erzielte zwei Treffer.
Wenn man es mit jungen Leuten zu tun hat, muss man versuchen, ihnen Gefühl für Verantwortung zu vermitteln. Falls es ihnen gelingt, ihrer Energie und Begabung noch Charakterstärke hinzuzufügen, kann das der Anfang einer großartigen Karriere sein.
Als ich als Trainer zu arbeiten begann, war mir meine Entschlussfreudigkeit immer eine große Hilfe. Ich hatte nie Angst davor, Entscheidungen zu treffen, selbst als ich als Schuljunge eine Mannschaft aufstellen sollte. Schon damals legte ich fest: »Du spielst hier, du spielst da.« Willie Cunningham, einer meiner ganz frühen Trainer, stöhnte immer: »Du weißt, dass du echt nervig bist.« Dabei wollte ich mit ihm nur über Taktiken reden und fragte ihn deshalb: »Sind Sie sicher, dass Sie wissen, was Sie da tun?«
»Eine Nervensäge, das bist du«, antwortete er.
Die anderen Spieler saßen drum herum, hörten sich meine Einwände an und rechneten damit, dass ich wegen Aufmüpfigkeit gleich rausfliegen würde. Ich konnte aber immer eine Entscheidung fällen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber Tatsache ist, dass ich schon als Junge Organisator, Ausbilder und Mannschaftsaufsteller war. Mein Vater war ein einfacher Arbeiter, sehr intelligent, aber bei Weitem keine Führungspersönlichkeit, deshalb kopierte ich auch nicht etwa ein elterliches Vorbild.
Andererseits weiß ich, dass ein Teil von mir einsam und verschlossen ist. Als ich im Alter von 15 Jahren nach einem gewonnenen Spiel der Glasgower Schülermannschaft gegen ein Team aus Edinburgh als stolzer Torschütze heimkam – der damals schönste Tag meines Lebens –, berichtete mein Vater, dass ein großer Verein Interesse an mir hätte und mit mir reden wolle. Meine Antwort verblüffte uns beide: »Ich will jetzt ausgehen. Ich will ins Kino.«
»Was ist los mit dir?«, fragte er.
Ich wollte mich einfach zurückziehen. Und ich weiß bis heute nicht, weshalb ich so reagiert habe. Ich musste für mich allein sein. Mein Vater war so stolz, und auch meine Mutter hatte sich riesig gefreut und meinte: »Das ist so fantastisch, mein Sohn.« Sogar meine Großmutter war ganz aus dem Häuschen. Gegen die Schülermannschaft von Edinburgh ein Tor zu machen, war eine große Sache. Trotzdem musste ich mich erst mal in mein eigenes kleines Reich zurückziehen.
Von damals bis heute habe ich ein langes Stück Weges zurückgelegt. Als ich 1986 bei Manchester United anfing, war Willie McFaul Trainer von Newcastle United. Manchester City wurde von Jimmy Frizzell trainiert, und George Graham saß bei Arsenal auf der Bank. Ich mag George. Er ist ein guter Mann, ein großartiger Freund. Als ich mit Martin Edwards Probleme wegen meines Vertrags hatte, war Sir Roland Smith Vorsitzender des Ligaausschusses. Hin und wieder konnte der Ausschuss Schwierigkeiten machen. Man musste warten, bis bestimmte Themen auf die Tagesordnung gesetzt wurden. Eines Tages schlug Sir Roland vor, dass Martin, Maurice Watkins, der Vereinsanwalt, und ich uns auf der Isle of Man treffen sollten, um meinen neuen Vertrag auszuhandeln. George erhielt bei Arsenal ein Salär, das doppelt so hoch war wie meines.
»Ich gebe dir meinen Vertrag, wenn du willst«, sagte George.
»Bist du sicher, dass dir das nichts ausmacht?«, fragte ich.
Und so fuhr ich mit Georges Vertrag in der Tasche auf die Isle of Man. Martin Edwards war in meinen Augen ein guter Vorstandschef. Er war stark. Sein Problem bestand jedoch darin, dass er meinte, jeder Penny, den er ausgeben musste, wäre sein eigener. Er bezahlte einen nur so, wie er es für angemessen hielt. Das ging nicht nur mir so, sondern auch allen anderen.
Als ich ihm Georges Vertrag zeigte, wollte er es nicht glauben. »Rufen Sie David Dein an«, schlug ich ihm vor. Das tat er, und David Dein, der Chairman von Arsenal, bestritt, dass George die im Vertrag genannte Summe bekam. Es war eine Farce. George hatte mir seinen von David Dein unterzeichneten Vertrag gegeben. Wären Maurice und Roland Smith nicht gewesen, hätte ich den Job an diesem Tag hingeschmissen. Ich war schon fast im Begriff abzureisen.
Die Geschichte hat natürlich ein Fazit, wie alle anderen Geschichten in meinen 39 Jahren an vorderster Front: Man muss für sich selbst eintreten. Es bleibt einem nichts anderes übrig.